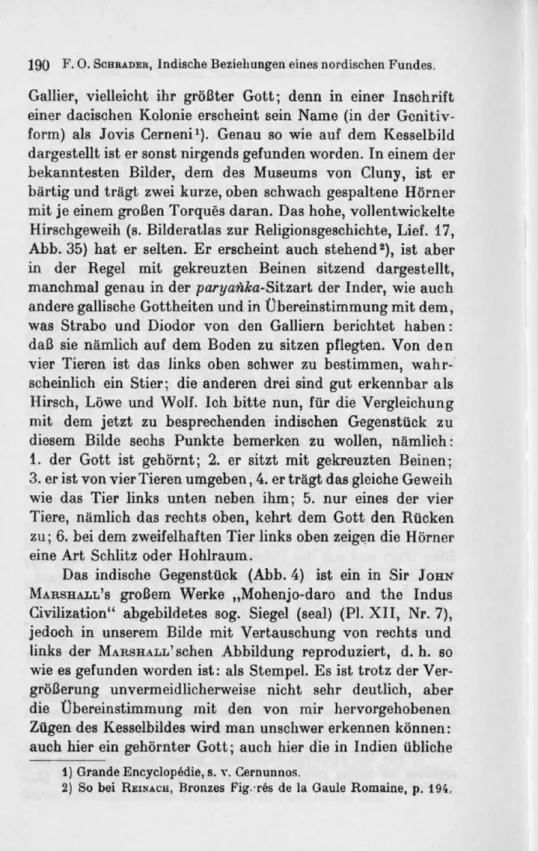Indische Beziehungen eines nordischen Fundes^).
Von F. Otto Schräder.
Eines der merkwürdigsten Stücke des Nationalmuseums
von Kopenhagen ist der große Silberkessel, der im Jahre
1891 bei Gundestrup im nördhchen Jütland gefunden wurde.
SopHus Mt)LLER hat ihm gleich nach seiner Auffindung im
ersten Bande der Nordiske Fortidsminder eine große Ab¬
handlung gewidmet und ihn dann nochmals in seinem bekann¬
ten, 1898 in deutscher Übersetzung erschienenen Buch „Nor¬
dische Altertumskunde" ziemlich eingehend behandelt. Von
Abhandlungen anderer Gelehrter über den Kessel ist die
jüngste und auch wohl bedeutendste die 1915 im dreißigsten
Bande des Jahrbuches des Kaiserlich Deutschen Archaeolo-
gischen Instituts (S. 1—36) erschienene von Fr. Drkxkl
(Frankfurt a. Main) „Über den Silberkessel von Gundestrup", mit der ganz kürzlich Sophus MtJLLER sich auseinandergesetzt
hat in einem Abschnitt (§ 21) seines Werkes Jernalderens
Kunst i Danmark" (Kjebenhavn 1933)
Der Kessel, von 69 cm Breite und 42 cm Höhe und
einem Gewicht von fast 9 kg, muß kultischen Zwecken
gedient haben, und zwar gehört er, wie ich glaube, in die
Kategorie der von Wolfgang Krause *) so genannten Frucht¬
barkeitskessel gewisser keltischer Sagen, die letzten Endes
offenbar alle auf die sicher schon urindogermanische Sage vom
Verjüngungsbrunnen zurückgehen. Der Kessel ist, wie ihn
1) Vortrag, gehalten am 31. August 1934 auf dem Siebenten
Deutschen Orientalistentage in Bonn, abgesehen von einigen späteren Verbesserungen.
2) Die Kelten (Religionsgeschichtliches Lesebuch, Heft 13), S. 28f.
186 O- Schräder, Indische Beziehungen eines nordischen Fundes.
Sophus Müller beschreibt, „in- und auswendig mit zahl¬
reichen Bildern bedeckt, unter denen sich viele nach gleich¬
zeitigen Darstellungen bei den klassischen Völkern und ihren
nächsten Nachbarn bestimmen lassen"; und die Bestimmun¬
gen sind derartig, ,,daß man von einer Kopierung oder doch
wenigstens von einer Nachbildung dessen, was die Verfertiger
des Kessels selbst gesehen hatten, sprechen kann". Wie bei
„allen anderen Bildern aus der Völkerwanderungszeit und den
nächsten auf sie folgenden Jahrhunderten", ist von den
Bildern „alles was sich bestimmen läßt, fremd": teils ,,aus der
klassischen Kunst hergeholt", teils „mit Sicherheit als gallo-
römisch" bestimmbar; „nicht eine einzige Figur läßt sich
nach der späteren nordischen Mythologie erkennen". Es ist
aber, meint S. M., kein Grund zu der Annahme vorhanden,
daß der Kessel nicht im Norden angefertigt sei — „allenfalls
könnte ja ein fremder Arbeiter nach Dänemark gekommen
sein oder ein Nordländer sich eine Zeitlang in Gallien auf¬
gehalten haben" — und er müsse „in die römische Periode
Dänemarks, wahrscheinlich in das 2. Jahrh. (n. Chr.) gesetzt
werden". Man hüte sich „vor einer wilden und ziellosen Jagd
nach Parallelen, die etwa gar bis nach Asien führt". Soweit
Sophus Müller (Nordische Altertumskunde, S. 160—163).
Dieser Auffassung ist widersprochen worden. Loeschcke hat
den Kessel in das 4. bis 3. Jahrh. vor Chr., Reinach ihn in das
5. bis 6. Jahrh. n. Chr. gesetzt. Jap. Stbenstrup hat in über¬
aus phantastischer Weise buddhistische Motive in ihm ge¬
funden (z. B. von den Selbstaufopferungen des Bodhisattva),
und A. Voss hat in einem interessanten, aber in der Haupt¬
sache nicht überzeugenden Aufsatz die Bilder auf den Mithras-
glauben zu beziehen versucht. Aber Reinach's Hinweis auf
gewisse Beziehungen des Kessels zur pontischen Kunst und
dem von ihm so genannten kelto-skythischen Stil hat weiter¬
gewirkt und Drexel bestimmt, den Kessel den Kelten der
unteren Donau zuzuweisen und dem ersten vorchristlichen
Jahrhundert, nämlich der Zeit des Mithradates Eupator,
dessen freundschaftliche Beziehungen zu jenen Donaukelten
geschichtlich bezeugt sind. Von dort sei der Kessel vermutlich
F. O. Schräder, Indische Beziehungen eines nordischen Fundes. 187
durch die Völkerwanderung an seinen nordischen Fundort
gelangt, ind em er die gleiche Straße gezogen sei wie im 6. Jahrh.
n. Chr. die von Südungarn nach Skandinavien zurückkehren¬
den Herulerscharen. Diese Annahme ist nach meinem Dafür¬
halten durch die wenigen Zeilen, die Sophus MtJLLKR gegen
sie geschrieben hat, noch nicht entkräftet worden, und sie
scheint mir die beste Grundlage zu bilden für die von mir
aufzuzeigenden indischen Motive des Kessels. Sollte aber
Sophus Müllkb recht haben und der Kessel tatsächlich „et
provinsiclt romersk Arbeide" sein, so müßte man eben für
jene Motive einen längeren Weg beanspruchen, sei es die
bekannte Donaustraße nach dem Rhein oder den Seeweg
nach Gallien.
Unter den Bildern des Kessels sind nun zwei, nämhch die
Bilder VIII und IX in Müller's Monographie, in denen ich
Beziehungen zu Indien, und zwar ganz verschiedener Art,
erkennen zu können glaube.
1. Betreffs des Bildes Nr. Vlll (unsere Abb. Nr. 1) hat
schon Drexel anmerkungsweise (loc. cit., S. 19) eine solche
Beziehung für möghch erklärt. ,,Es sei angemerkt", sagt er,
„daß in der persisch-indischen Kunst der Nachfolger Abekas
die Darstellung der Göttin ^rl als einer von zwei Elefanten,
die Wasser auf sie gießen, flankierten Hindufrau außerordent¬
lich beliebt ist (Grünwedel, Buddhistische Kunst in Indien
S. 40f.). Die Elefanten nähern sich ihr ganz in der Weise wie
auf dem Kessel. Ein Zusammenhang des Motivs erscheint
nicht ausgeschlossen. Übrigens stellen die Gundestruper Ele¬
fanten nach der Kleinheit ihrer Ohren den indischen Elefanten
dar". Diesen Worten zuzustimmen, verlockt vor allem die
Tatsache, daß in der ganzen Welt, Indien allein ausgenommen,
die Verehrung einer von Elefanten flankierten Göttin un¬
bekannt ist. Sri oder Laksmi, heute als Gemahlin des Gottes
Visnu und als Göttin des Glücks und der Schönheit verehrt,
ist bekanntlich das indische Analogon der Aphrodite anady-
omene, und eben als solche, nämlich als meerentstiegen und
von zwei felefanten mit heiligem Wasser begossen, erscheint
sie in dem uns hier interessierenden vielfach variierten Typus
188 F- O. Schbadeb, Indische Beziehungen eines nordischen Fundes.
der Gaja-Laksml oder „Elefanten-Laksmi". Dieser Typus
ist, wie GRüNWEDEusagt, „der älteste aller Hindugötter". Aber
in der ältesten Zeit ist Sri noch nicht die Gemahlin Visnus,
sondern eine selbständige Glücks- und Fruchtbarkeitsgöttin
und allem Anschein nach mehr vom Volke als von der arischen
Oberschicht verehrt — womit es offenbar zusammenhängt,
daß sie im l^gveda noch gar nicht vorkommt. Sie mag in
prähistorischem Zusammenhang stehen mit der großen Göttin
der alten Induskultur und der Magna Mater des westlichen
Orients, aber der Typus der Elefanten-Laksmi kann bis jetzt
nur als der historischen Zeit Indiens angehörig gelten. Daß
gerade diese indische Göttin nach Kleinasien und weiter
gelangen konnte, ist vielleicht nicht so wunderbar. Denn eben
diese Göttin war, wie wir namentlich aus der altbuddhistischen
Literatur wissen, außerordentlich populär, und Darstellungen
der Elefanten-Laksmi finden sich und fanden sich gewiß schon
früh auch auf profanen Gegenständen wie dem im Mün¬
chener Museum für Völkerkunde befindlichen Elfenbeinkamm
(Abb. 2). Und für Drexkl's Theorie könnte dazu vielleicht
noch in Betracht kommen, daß von allen indischen Göttinnen
nur Laksmi denselben sicher uralten Namen führt wie die
im pontischen Reiche des großen Mithradates verehrte Göttin,
nämlich Mä (ein Name, der auch in einem der Namen des
indischen Amor, nämlich Mäpatya „Sohn der Mä", erscheint).
Mit der indischen Vorlage haben möglicherweise auch etwas
zu tun die beiden keltischen Sonnen- oder Zeiträder, die im
Kcsselbilde unterhalb der Elefanten zu den Seiten der Göttin
angebracht sind; denn an den ungefähr entsprechenden
Stellen hat die Sri des östlichen Tores von Sanchi zwei
Kränze*).
Kaum der Erwähnung bedarf, daß das Kesselbild nicht
die indische Göttin darstellen soll; es ist selbstverständlich
1) Dass diese 6ri, wie Foucheb annimmt (M6moires conc. l'Asie
Orientale, I, p. 132f.), in Wahrheit Mäyä, die Mutter Buddhas, und nicht die Gaja-La]{8inl, sondern ihr Prototyp ist, vermag ich nicht zu glauben,
wenn F. auch darin recht haben mag, daß die Elefanten zuerst mit
Häriti, der buddhistischen Göttin der Fülle, aufgetreten sind.
F. O. ScBBABEB, Indische Beziehungen eines nordischen Fundes. 189
eine keltische Göttin, der hier zur Erhöhung ihrer Majestät
nach indischer Vorlage die Elefanten beigegeben worden sind.
Gegen die Notwendigkeit, das Kesselbild mit Indien in
Verbindung zu bringen, ließe sich nun freilich anführen, daß
im ägäischen Kulturkreise das Bild einer Göttin vorkommt,
die von zwei zu ibr aufbhckenden Löwen flankiert ist*).
Es handelt sich aber hier um eine stehend, nicht sitzend, und
auch sonst völhg anders dargestellte Göttin und eben nicht
um Elefanten ; und spätere Bilder der (sitzenden oder stehen¬
den) Magna Mater, in denen die Löwen ihr zugewandt er¬
scheinen, gibt es meines Wissens nicht*). Dennoch würde ich
mit weniger Zuversicht von einer indischen Vorlage des Kessel¬
bildes sprechen, besäße der Kessel nicht außerdem ein Bild
einer von Tieren umgebenen männlichen Gottheit, das gleich¬
falls nach Indien weist, wenn auch nach dem prähistorischen
Indien. Es tritt hier ein Zusammenhang zutage, de/ in seiner
Rätselhaftigkeit einer Überbrückung von Jahrtausenden und
Tausenden von Meilen erinnert an die kürzlich erwiesene
Ähnlichkeit der Schriftzeichen des alten Indusvolkes mit den¬
jenigen der Osterinsel.
2. Das Kesselbild Nr. IX (Abb. 3) zeigt, wenn wir — mit
welchem Recht, wird man sehen — die vier Phantasietiere
rechts außer Betracht lassen, einen von vier Tieren umgebenen
Gott mit Hirschgeweih, der in der rechten Hand einen großen
Ring trägt und mit der linken eine große Schlange hält. Der
Ring ist der gallische Torques, ein gewöhnlich als Halsschmuck
dienender Ring aus gewundenem Metall und mit Pufferenden ;
und diese drei Attribute: Hirschgeweih, Torques und Schlange
mit Widderkopf beweisen, daß wir hier den gallischen Gott
Cernunnos vor uns haben — einer der großen Götter der
1) S. die Abbildung 67 (auch 66) im „Bilderatlas zur Religions¬
geschichte", hrsg. von Hans Haas, 7. Lieferung (1925). Ich verdanke diesen Hinweis, wie auch den weiter unten auf das hohe Hirschgeweih
des Cernunnos im Altarbild von Vendeuvres, Herm Kollegen Kabl
Clemkn.
2) Von den gallischen Altertümern kommt dem Kesselbilde am
nächsten die Epona zwischen Pferdegruppen; s. Bilderatlas, Lief. 17,
Abb. 65.
190 F. O. Schräder, Indische Beziehungen eines nordischen Fundes.
Gallier, vielleicht ihr größter Gott; denn in einer Inschrift
einer dacischen Kolonie erscheint sein Name (in der Genitiv¬
form) als Jovis Cerneni*). Genau so wie auf dem Kesselbild
dargestellt ist er sonst nirgends gefunden worden. In einem der
bekanntesten Bilder, dem des Museums von Cluny, ist er
bärtig und trägt zwei kurze, oben schwach gespaltene Hörner
mit je einem großen Torques daran. Das hohe, voll entwickelte
Hirschgeweih (s. Bilderatlas zur Religionsgeschichte, Lief. 17,
Abb. 35) hat er selten. Er erscheint auch stehend"), ist aber
in der Regel mit gekreuzten Beinen sitzend dargestellt,
manchmal genau in der paryanka-Sitzart der Inder, wie auch
andere gallische Gottheiten und in Übereinstimmung mit dem,
was Strabo und Diodor von den Galliern berichtet haben :
daß sie nämlich auf dem Boden zu sitzen pflegten. Von den
vier Tieren ist das links oben schwer zu bestimmen, wahr¬
scheinlich ein Stier; die anderen drei sind gut erkennbar als
Hirsch, Löwe und Wolf. Ich bitte nun, für die Vergleichung
mit dem jetzt zu besprechenden indischen Gegenstück zu
diesem Bilde sechs Punkte bemerken zu wohen, nämlich:
1. der Gott ist gehörnt; 2. er sitzt mit gekreuzten Beinen;
3. er ist von vier Tieren umgeben , 4. er trägt das gleiche Geweih
wie das Tier links unten neben ihm; 5. nur eines der vier
Tiere, nämlich das rechts oben, kehrt dem Gott den Rücken
zu; 6. bei dem zweifelhaften Tier links oben zeigen die Hörner
eine Art Schlitz oder Hohlraum.
Das indische Gegenstück (Abb. 4) ist ein in Sir John
Marshall's großem Werke „Mohenjo-daro and the Indus
Civilization" abgebildetes sog. Siegel (seal) (PI. XII, Nr. 7),
jedoch in unserem Bilde mit Vertauschung von rechts und
links der Marshall' sehen Abbildung reproduziert, d. h. so
wie es gefunden worden ist: als Stempel. Es ist trotz der Ver¬
größerung unvermeidlicherweise nicht sehr deutlich, aber
die Übereinstimmung mit den von mir hervorgehobenen
Zügen des Kesselbildes wird man unschwer erkennen können :
auch hier ein gehörnter Gott; auch hier die in Indien übliche
1) Grande Encyclopedic, s. v. Cernunnos.
2) So bei Reinach, Bronzes Fig. rös de la Gaule Romaine, p. 194.
F. O. ScHBADKB, Indische Beziehungen eines nordischen Fundes. 191
Art des Sitzens mit gekreuzten Beinen; auch hier vier Tiere,
zwei zu jeder Seite des Gottes; auch hier Übereinstimmung
der Hörner des Gottes — in diesem FaUe Büffel-, nicht Hirsch¬
hörner — mit denen des hnks unten befindlichen Tieres; und
auch hier rechts oben das einzige dem Gotte den Rücken
zukehrende Tier, in diesem Falle ein Elefant, nicht ein Löwe;
und endlich 6. scheint es immerhin möglich, daß die Ohren
des links oben abgebildeten Rhinozeros in ihrer unverhältnis¬
mäßigen Größe und nur umrißartigen Andeutung die selt¬
samen Hörner des entsprechenden Tieres in dem Kesselbilde
hervorgerufen haben. Diese Darstellung der Ohren des Rhino¬
zeros, die alle Indusbilder dieses Tieres charakterisieren, ist,
nebenbei bemerkt, ganz kürzlich von einem bedeutenden
amerikanischen Archaeologen bei seinen mesopotamischen
Ausgrabungen wiedergefunden und als wichtiges Merkmal
für die Zeitbestimmung der Induskultur erkannt worden*).
Noch eine siebente, wenn auch möglicherweise rein zufällige
Übereinstimmung darf vielleicht erwähnt werden, nämlich
die der zwischen dem Elefanten und dem Tiger sichtbaren
Homo-Hieroglyphe mit dem Männchen, das etwas rechts von
der entsprechenden Stelle des Kesselbildes auf dem Delphin
reitet. Ferner ist noch zu bemerken, daß der indische Gott
zwar keinen Ring mit der Hand trägt, wohl aber mehrere
große Ringe nebst vielen kleinen an den Armen, und daß er,
wie der keltische, auch einen Leibgurt hat. Sein Gesicht da¬
gegen unterscheidet sich stark von dem des Kesselbildes:
eher als ein menschliches scheint es mir ein tierisches, etwa
das eines Tigers zu sein. Daß der Gott dreigesichtig ist, wie
Sir John Marshall behauptet, kann ich nicht finden, ist auch
für seine Identifizierung mit Siva nicht nötig, da der drei-
gesichtige Siva in der Hindukunst selten und spät ist. Der
nasenartige Vorsprung an beiden Seiten des Gesichtes könnte
eine Haarsträhne sein, vielleicht mit der kleinen kegelförmigen
Goldkappe, die zu den Schmucksachen Mohenjo-daros gehört
1) H. Frankpobt, The Indus Civilization and the Near East, S. 3
(im Bande VII der Leydener „Annual Bibliography of Indian A.rchae«
olog}'". 1934).
ZeltKhrUt d. D.U.O. Nene Folge Bd. Zm (Bd. 88) M
192 F- O- ScHRADBB, Indische Beziehungen eines nordischen Fundes.
und noch heute in Indien ebenso, an einer Haarsträhne
befestigt, getragen wird*).
Kann nun wohl eine so weitgehende Übereinstimmung
der beiden Bilder wie die von mir aufgezeigte für zufällig
erklärt werden? Gewiß, der Zufall bringt erstaunliche Dinge
zuwege, weihrscheinlich auf archäologischem nicht minder
als auf linguistischem Gebiet. Aber selbst, wenn auch nur die
Übereinstimmungen 4 und 5 vorlägen — gleiches Geweih des
Gottes mit dem des Tieres links unten; Rückenstellung des
Tieres rechts oben — würde ich mich nicht entschließen
können, diese für zufällig zu halten. Es ist aber natürlich so
gut wie ausgeschlossen, daß der uns vorliegende indische
Stempel in genau der gleichen Form und als mit Inschrift
versehener Stempel auch dem Hersteller des Kesselbildes
vorgelegen habe. Vielmehr sind Zwischenglieder anzu¬
nehmen, von denen eines dem keltischen Künstler in die
Hände gefallen ist. Zwischen Mithradates und den Donau¬
kelten gingen Gesandtschaften hin und her, und unter den
Geschenken, die diese brachten, könnte ein Gegenstand mit
dem Bilde des indischen Gottes gewesen sein. Wie dieser
Gott ins pontische Reich gelangen konnte, ist auch nicht
schwer sich vorzustellen. Wir wissen ja jetzt, daß Handels¬
beziehungen zwischen Mohenjo-daro und Mesopotamien tat¬
sächlich bestanden; und auf das frühzeitige Vordringen der
mesopotamischen Kultur nach Kleinasien hat kürzlich wieder
Eckhard Unger hingewiesen"). Den Weg über Persien
scheint mir aber auch der hochgehaltene Torques des Kessel¬
bildes zu verraten. Denn so in die Höhe gehalten statt von
der Hand herabhängend kommt er zwar auf einer gallischen
Münze (s. Anm. 1) aber auch in der achämenidischen Kunst
vor'). Man könnte freihch auch an den indischen Rosenkranz
1) S. bei Mabshall vol. II, p. 519 u. III, pl. CXLVIII, und vgl.
(für die Haarsträhne) die im „Bilderatlas zur Religionsgescnichte", Lief.
17, als Nr. 39 abgebildete gallische Münze.
2) In „Forschungen und Fortschritte", Bd. X, S. 231/2: „Naram- Sin von Akkad in Armenien".
3) S. das in der Revue Archeologique von 1880 auf S. 5 abgebildete
F. O. Schbadeb, Indische Beziehungen eines nordischen Fundes. 193
in vielen Darstellungen des Gottes Brahmä denken*). Aber
bei den Indern ist auch wiederum der hochstehende Rosen¬
kranz fremden Einflusses verdächtig, weil im Gegensatz zum
steifen Torques die aus lose aufgereihten Kügelchen bestehen¬
de japamälä gar nicht so gehalten werden kann.
Der Gott von Mohenjo-daro ist von Sir John Marshall
wahrscheinlich mit Recht für einen Vorläufer des Gottes
Siva erklärt worden. Daß der Dreizack des letzteren sich aus
des ersteren Hörnern und Kopfbedeckung entwickelt habe,
klingt phantastisch, wird aber plausibel durch die zangen¬
artige Form des Dreizacks in vielen Siva-Darstellungen. Die
Kopfbedeckung erinnert stark an den calathus des gallischen
sog. Hades wie des Zeus Serapis"). Zusammen mit Cernunnos
abgebildet ist in einem Falle das Sonnenrad, in einem anderen
die Stiermaske gefunden worden, und man hat hierin eine
Spur seiner ursprünghchen Identität mit dem Zeus von Kreta
zu erkennen geglaubt»). Es scheint sich hier die Möglichkeit
aufzutun, daß ein unbekanntes Bild des letzteren zwischen
dem indischen und dem gallischen Gott steht. Anderseits
braucht der indische Gott nicht autochthon zu sein, sondern
könnte (wenn auch nicht notwendig mit denselben Tieren)
auf ein mesopotamisches Urbild zurückgehen.
Basrelief. Daselbst auch eine Äußerung Bertrands über die von ihm
vermutete kultische Rolle des TorquEs im alten Persien.
1) Vgl. z. B. den holzgeschnitzten Brahmä des Mus6e Guimet.
(Glasenapp, Heilige Stätten Indiens, Tafel 18); ferner Gopinatha Rao, Elements of Hindu Iconography, vol. II, pl. CXLII und die im gleichen Bande abgebildete Sadäsivamürti (pl. CXIII, fig. 1).
2) Vgl. Codbcellb-Senedil, Les Dieux Gaulois d'apräs les monu¬
ments figures (Paris 1910), S. 103—109.
3) Encyclopaedia of Religion and Ethics, vol. XII, S. 453.
Von den folgenden Abbildungen sind Nr. 1 und 3 dem Werke
„Nordische Altertumskunde" von Sophus Mdlleb entnommen; Nr. 2
ist eine vom Museum für Völkerkunde zu München freundlichst zur
Verfügung gestellte Photographie des dort befindlichen Originals und
Nr, 4 eine vom Verleger, Herm Abthub Pbobsthain, gütigst gestattete
Wiedei^abe der Abb. Nr. 17 auf Tafel XII des Werkes von Sir John
Marshall, „Mohenjo-daro and the Indus Civilization".
„Tafsho Shinshu Daizokyo" oder kurz
„Taishö Issaikyö^'.
Von T. Matsumoto.
Ich brauche nicht hervorzuheben, welche Bedeutung
diese Ausgabe für die Wissenschaft hat. Nicht nur die Er¬
forscher des Buddhismus sind an ihr interessiert, sondern viel
weitere Kreise der Orientalisten im allgemeinen. Diese Aus-
g£ibe in 100 Bänden wird in kurzem vollendet sein. Es sei mir
als Mitarbeiter gestattet, hier kurz einige Erklärungen über
Form und Inhalt zu geben. Das Werk zerfällt in zwei Ab¬
teilungen: Die eigentliche Ausgabe des Tripitaka, in 85 Bän¬
den, und der Bilder-Atlas in 12 Bänden. Dazu kommen noch
drei Indexbände.
A. Die Ausgabe der Texte.
Es handelt sich um eine neue Ausgabe des Tripitaka in
Chinesisch. Die Texte sind neu kollationiert, revidiert, er¬
gänzt und neu geordnet. Dazu kommt eine große Zahl von
Originalabhandlungen chinesischer, koreanischer und japa¬
nischer Autoren. Die Herausgeber sind Prof. J. Takakusu
von der Kaiserlichen Universität zu Tokyo, Mitglied der
Kaiserlichen Akademie daselbst, und der am 26. Januar 1933
verstorbene Prof. K. Watanabe von der Taisho-Universität
zu Tokyo.
Die hier in dieser Ausgabe veröffentlichten Werke um¬
fassen 3053 Textnummern, die aus insgesamt 11970 Faszikeln
besteht. Es handelt sich dabei um chinesische Übersetzungen
aus dem Sanskrit, Päli und anderen indischen Dialekten,
ferner um Originalabhandlungen, die in China, Korea und