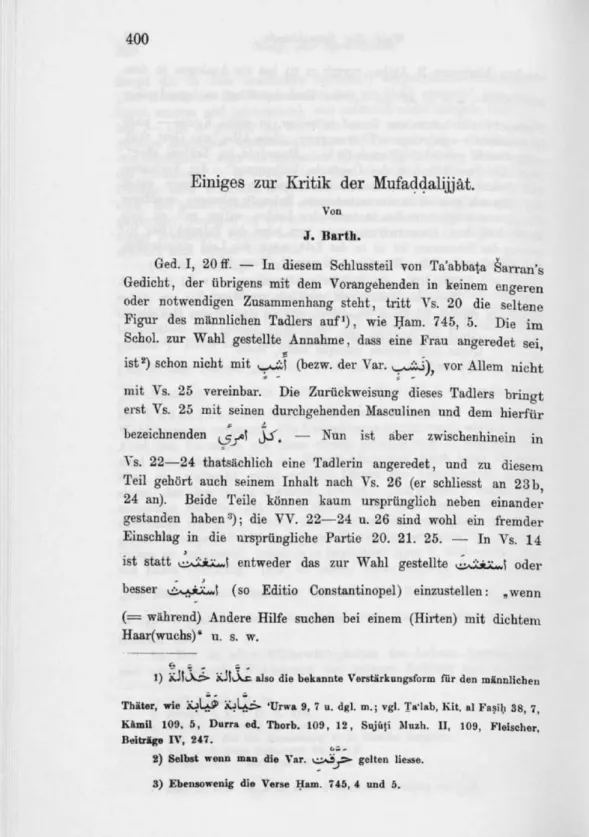Einiges zur Kritik der Mufaddalijjät.
Von J. Barth.
Ged. I, 20 flf. — In diesem Schlussteil von Ta'abbata Sarran's
Gedicht, der übrigens mit dem Vorangehenden in keinem engeren
oder notwendigen Zusammenhang steht, tritt Vs. 20 die seltene
Figur des männlichen Tadlers auf) , wie Ham. 745, 5. Die im
Schol. zur Wahl gestellte Annahme, dass eine Frau angeredet sei
s -
ist*) schon nicht mit (bezw. der Var. ^...oiJ)^ vor Allem nicht
mit Vs. 25 vereinbar. Die Zurückweisung dieses Tadlers bringt
erst Vs. 25 mit seinen durchgehenden Masculinen und dem hierfür
^ it
bezeichnenden \^^\ ^ . — Nun ist äber zwischenhinein in
Vs. 22—24 thatsächlich eine Tadlerin angeredet, und zu diesem
Teil gehört auch seinem Inhalt nach Vs. 26 (er schliesst an 23b,
24 an). Beide Teile können kaum ursprünglich neben einander
gestanden haben''); die VV. 22—24 u. 26 sind wohl ein fremder
Einschlag in die ursprüngliche Partie 20. 21. 25. — In Vs. 14
i
ist statt oJjtx*»! entweder das zur Wahl gestellte o'j:**.*».! oder
~ 3
besser (so Editio Constantinopel) einzustellen: „wenn
(= während) Andere Hilfe suchen bei einem (Hirten) mit dichtem
Haar(wuchs)' u. s. w.
1) x!IlX:>- iCJtiÄc also die bekannte Verstärkungsform für den männlichen Thäter, wie ÄjLa^ wL*^ 'ürwa 9, 7 u. dgl. m.; vgl. Ta'lab, Kit. al Fasih 38, 7, Kämil 109, 5, Durra ed. Thorb. 109, 12, Sujüti Muzh. II, 109, Fleischer, Beiträge IV, 247.
2) Selbst wenn man die Var. vixJj— »• gelten liesse.
3) Ebensowenig die Verse Ham. 745, 4 und 5.
Barth, Einiges zur Kritik der Mufaddalijjät. 401
Ged. II ist ein Fragment, das al-Mufaddal in dieser unver¬
ständlichen Zusammenhangslosigkelt nicht aufgenommen haben kann.
Es war nicht zweckmässig, dass Thorbecke (zu Vs. 2) über den
Anlass des Gedichts nur die Ansicht al-Marzüki's in Bc, mit welcher
Vs. 4 nicht vereinbar ist und (zu Vs. 5) eine ähnliche von Sa¬
wähid Mugni gab, dagegen die von Bekri 436 angedeutete, welche
durch Vers 4 bestätigt wird, nicht mitteilte. Es handelt sich
nach Bekrl um einen Kampf des öjLb [Bek. iUjiÄs»] iC*J^jS>
j^^JjtXJ! bei Zarüd (Vs. 3) gegen die B. Jarbü', zu denen unser
Dichter Kalhaba gehörte. Die Taglib mussten fliehen ; Kalhaba
konnte aber mit seinem Ross HolyiJt den Hazima nicht einholen,
weil dieses verwundet worden war; dadurch kam ihm darin \.Jlj3\
^ .vil iCLo- qJ zuvor. —• Hiermit trifi't in wesentlichen Funkten
die Notiz bei TA u. d. W. (auf Ibn Kelbi's Jwdl i«_>L«J! zurück¬
gehend) zusammen, wo nur die Angabe über den Unfall des Rosses
fehlt. Das Gedicht muss vorher von dem Kampf und dann von
dem Lobe der sgehandelt haben *). Die Reihenfolge der Verse
ist nun aber gestört; auch fehlt ausser dem Anfang etwa ein Vers.
Die verbliebenen Verse sind etwa so zu ordnen :
(2) Man meldete uns , dass wir angegriflen seien , als meine
Kamelin reichlich getrunken hatte ;
(3) ich liess sie schnell anschirren ;
(5)-) da erreichte den schnellen Lauf) der 'Arada ihre Ver¬
wundung*), als sie mich schon bis auf eines Fingers (Entfernung)
an Hazima herangebracht hatte ;
(4) die Pfeile, (die sie) an ihrem Hals und ihrer Kehle (getroffen hatten,) ghchen herausgerissenen Lauch-Stengeln.
(1) Wenn Du auch, o Haz., ihr entkommen bist (eigentlich:
entkommst), so hat sie doch, was hinter Dir war, verwüstet.
Vs. 6. 7 unverändert ; sie setzen aber vorber eine Angabe über
die Lässigkeit seiner Mitkämpfer seinem Ruf gegenüber (6^) voraus.
1) Ein kleines Lobgediclit Uber diese, das in Ed. Thorbecke fehlt, enthält i
die leider fragmentarische Ed. Constantinopel S. 11 (Wäfir, Reim fri—); in diesem finden sich die VV. 8. 9 von No. V ed. Thorb.
2) Vorher mag fehlen, dass die Feinde ibre Geschosse auf sie richteten oder dergleichen.
3) sLiüi (Mufd.) oder jLs,t (Saw. Mugni).
,0. »
4) Lies mit Bek. U-JÜ^; vgl. Vs. 4. Die La. 1 ;ir,i,.^ von Mufdd. geht eben¬
faUs an, wenn das „Hinken" Folge der Verwundung ist.
3 ■
>o >
Das Ged. IV des ^y Kju« handelt von einer Niederlage
der B. 'Amir, die sie seitens der von ihnen zuerst Überfallenen
B. Dubjän erlitten haben (Vs. 1. 2) und nach welcher sich ein
oder mehrere 'Ämiriten ') erhängten (Vs. 1 ; vgl. 'Urwa X), während
'Ämir b. al-Tufeil entfloh. Der Scholiast hier, wie der bei 'Urwa
)
wie auch Bekrl 420 beziehen das auf den lAth. IV, 482.
Aber unser Gedicht selbst weist vielmehr Vs. 16 auf den v^s-L« jljj
den lAth. IV, 483 als einen davon verschiedenen Schlachttag auf¬
führt und auf den er auch diesen Vorfall bezieht. Sind beide Namen
nicht etwa nur Benennungen der gleichen Schlacht, was man bei
anderen Kämpfen zuweilen bei lAth. anzunehmen Grund hat, so
ist nur lAth.'s Darstellung den anderen gegenüber richtig.
Das Gedicht ist stark in Unordnung und dadurch jetzt mehr¬
fach unverständlich. Die Anrede Oy^j Vs. 6 ist beziehungslos; si»
setzt den Vs. 16 schon voraus, wo der entflohene 'Ämir erst einge¬
führt wird ; Kiirzul ist das durch seine Schnelligkeit berühmte
Ross (s. VI, 2), das ihn rettete; —• Vs. 11 unterbricht mit seiner
direkten Rede die zusammengehörigen VV. 10. 12; — der Vs. 16
ist an seinem jetzigen Platz zusammenhangslos , schliesst dagegen
an 12'' an. Die ursprüngliche Ordnung der^ Verse ist etwa so
herzustellen: Vs. 1—5 (Verspottung der B. 'Ämir, Triumph der
Dubjän); dann 10. 12. 16. 13 (Lob des Pührers der Dubjän, des
Abü Asmä [= {^^\ io,b>- ^\ im*-^]» seiner Reiter¬
schar die Peinde zurücktrieb). Nun erst Vs. 14. 15. 6—9 die
Erwähnung ihrer Plucht und direkte Anrede des dabei entkommenen
'Amir b'lTufeil. Dahin mag auch Vs. 11 mit gleichfalls direkter
Anrede gehören: ,Du, o 'Ämir, müsstest (den Peinden) alle Eure
Kamele schenken , d. h. als Beute überlassen." — In anderem
Sinne verstanden , wäre Vs. 11 in unserem Gedichte nicht echt,
sondern aus einem Lobgedicht auf die Preigebigkeit eines Grossen
hierher verschlagen.
In dem Ged. VI (al-6umaih's) steht Vers 7—9 nicht an der
3 O~
richtigen Stelle. Das xj Vs. 7 korrespondiert mit 3<-'^«j
Vs. 2; beide Male wird Männern von den B. Ga'far b. Kiläb feige Plucht
vorgeworfen. Vs. 7—9 ist wohl hinter Vs. 3 einzufügen und kann
nicht durch den fremden Zug Vs. 5 ff"., die Erwähnung des von
ihnen treulos erschlagenen Gastes Hälid b. Nadla , von Vs. 1—3
getrennt sein. — Vs. 4 gehört entweder hinter Vers 6 oder hinter
Vs. 9. — In Vs. 6'' ist das ^y>. sinnlos; ebenso die Erklärung
1) Nach Bekri 420 al-Hakam b. al Tufeil; nach lAthir noch ausserdem ein Mann von den B. (ianij; dafür spricht aucb der Plural bei 'Urwa X, 3.
3 I
Bartli, Einiges zur Kritik der Mufaddalijjät. 403
des Schol. in Ed. Const.: ^^y^ ^jS^ f^ Lj]| J*.j^ l'ri's
ttLXiJt. — Vielmehr führt der Gegensatz von ji ^ auf (eine
Ahstraktbildung zu dem dem Persischen entlehnten Adjektiv ^y>):
„vreder Kälte noch Hitze hatte ihren Rücken runzelig gemacht."
In Gedicht VII (al-Hadira) sollen die Vss. 6—8 nach der
Stellung, in der sie sich befinden, die Schönheit der Geliebten, etwa
ihren Mund (vgl. Vs. 5) schildern ; ihr Inhalt lässt sich aber mit
dieser angeblichen Bestimmung nicht vereinbaren'). Sie bilden
m. B. vielmehr den Rest eines hier fremden Nasib, welcher von
den Zeltspuren handelte. Entscheidend ist die Übereinstimmung
, J
des a.j Vs. 8 mit dem Jjjk^J! ^_$<>J>^ >i>-»jiJ
Tarafa 19, 3 (Ahlw.), das dort zur Schilderung der Zeltreste dient.
Der ursprüngliche Zusammenhang unserer Verse war wohl: (Die
Spuren der Wohnstätte sind verwischt worden) 6. durch das Regen¬
wasser-) eines Nachtgewölks, dem der Ostwind reichlichen Regnen
aus dem Wasser einer dunklen Wolke mit herrlichem Born entzog;
7. der Guss einer gespaltenen Wolke von ihm (dem Gewölk)
hatte die Ebenen überflutet, und die Tropfen waren nach seinem
Abgang klar geworden ;
8. die Pluten hatten mit ibm (dem JsJLb) gespielt, und ihr
Wasser drang ein, indem es zu den Wurzeln der Hirwa' durchsickerte."
Vs. 27 gehört nicht an seine jetzige Stelle, sondern zu Vs. 21. 22.
- & . C 3
Ged. IX. — In Vs. 5 ist das ^^^kJlxj Oö in den beiden
vom Schol. zur Wahl gestellten Erklärungen kaum möglich. Ich
,-0* )
möchte vorschlagen "^yLC. Lic . . . ^y)-**^ tX» zu lesen:
„Du bethätigtest . . eine Vernachlässigung, Abwendung von mir."
- . i . , .
Für diese Verbindung von vgl. TA: oiLL»! Uj,^ (. . .
j! ÄJs-^L^b bbis .! ^.jS ^ yt\ OIas»! 'j*-**^' iO'^ ^^ic-
V*^'- Durch die Ungewöhnlichkeit dieser Bedeutung mag das
1) Das ÄJjL»« (jÄJjJiJ kann keine Ergänzung zur Ausmalung körperlicher Schönheit , spez. des Mundes seiu. Auch die Var. jjiaj^yü' giebt keine ver¬
ständliche Vergleichung.
o -
2) Das bedeutet ^ja^^ und (_>isjji/s nacb Gauh. und Kam.; vgl. Lane u. d. v^^
Corruptel entstanden sein. Wollte man zu dieser Änderung sich
nicht entschliessen, so würde gegen die Uberlieferung zu lesen sein
i ^ M „ 0>
;^jÄc. Läc i^jaJ^' lAs . . . ,du wurdest erkannt ... als Eine,
die uns vernachlässigte."
^ - O 3 C c
Gedicht XI. — Vs. 4 ergiebt das überlieferte LjJ ^
mit den in Vs. 5. 6 folgenden Ausnahmen . . . SjUj ^1, und dann
u 3 . ^ "
"^^^ entgegengesetzten Sinn von dem, was man nach allen
sonstigen Parallelen erwarten muss. Daher wissen die Erklärer mit
dem Nichts anzufangen ; siehe die Versuche in den Scholien. Es
C; - O^ Cl-
muss in Vs. 4'' urspr. ^^^äj-j j^') oder ein Synonym gestanden
3 , oE ģ
haben; vergl. dazu das zurückweisende ^^(j.aJ1 L« j^LXs in
Vs. 7^ — Vs. 21 ist unecht. Auf JtSJi ^ als 2. Pers. masc.
sg. müsste folgen: „mit einer Kamelin, welche ..." (wie oft, z. B.
X, 7 vgl. m. 7 *); als 3. Pers. fem. sg. müsste es den Nominativ
,eine Kam., welche . . .' (wie XLII, 7 u. ö.) nach sich haben. Nun
ist aber in Vs. 24 die Schilderung der Kamelin auf eine andere Art
eingeführt, die mit unserem Vers nicht vereinbar ist.
)
XIV, 1. Pür sty; lies, da nach Vs. 3 eine Prau angeredet ist,
j - ,
ju^j (für üÄjjj)- Richtig Ed. Const.
XVII, 12. Der Vs., den B nicht hat, steht jedenfalls an un¬
gehörigem Platze, würde aber hinter Vs. 4 gut passen. Die oLtj
jS^W , mit denen die Geliebte verglichen wird , werden von den
arab. Lexikographen und Schol. Ed. Const. als ^.,L.>*^s> v'jLaS"
v_ÄA>ai! Q*'"'^ oLaa^x;^ iJsLi^ erklärt. Aber in unserem Vers
> « JOJ
folgt darauf .„^^^W jjaiJ! Lpjwaij; das erweist, dass der Dichter
damit einen Baum -) meinte. Möglich ist dies auch bei Tarafa 5, 2.5,
, o£ c .
wenn dort (^.,oUj auf die banuti'l mahri und nicht auf die Frauen
selbst geht; immerhin wäre aber dort der doppelte Vergleich mit
1) Mit der beliannten poetischen Licenz, die das Metruin forderte, statt
^ o ,
OUj, vgl. Wright^ § 252; schon im Qoran 87, G ^.w-Lli bLs „vergiss nicht.'-' 2) Vgl. die bekannte Vergleichung mit Palmen, z. ß. 'Ahfal 242, 8; 259,4.
Barth, Einiges zur Kritik der Mufaddalijjät. 405
Gewächsen auffällig. — Zu oLäj!^ in unserem Vers, wenn er von
3
Bäumen handelt, vgl. ySUiJt ,the trees broke forth with leaves
(before the winter)" Lane u. d. W.
XX. In diesem Madh auf die B. Sa'd (Vs. 10 f. 41; s. auch
Vs. 5) von den B. Tamim (13), den eigenen Stamm des Salama (16),
hat schon Thorbecke Vs. 1—6. 26 beanstandet. Mir scheint Vs. 30
sehr zweifelhaft, da er wegen der Abhängigkeit des Verses 31 von
29 hier stört und die in ihm angedeutete Situation — der Bruch
eines Hilfsversprechens — eine andere ist als in Vers 29. 37 ff.,
wo ein erbitterter Kampf zwischen beiden Teilen herrscht und die
Rabi'a vom Stamm des Dichters deportiert werden.
XXVIII, 5. Statt ^'-1, lies Jyi als ^Jult Cy\y>- Vers 3.
Richtig Ed. Const.
XXXIV. Das versreiche Gedicht, welches nach Asma'i's Zeugnis
bei den Arabern besondere Auszeichnung genossen haben soll '), des
Suweid b. Abi Kähil-) als-Jaskuri, der sich je nach Lage der Ver¬
hältnisse nach seinem Stiefvater zu den Jaskur b. Bekr b. Wä'il"),
bald nach seiner Mutter zu den 'Abs und Dubjän hielt, spitzt sich
schliesslich zu einem Streitgedicht gegen einen offenbar recht starken
Gegner (Vs. 103—106)*) zu. Der jäh abbrechende Schluss Vs. 107
war wohl urspr. voller; er ist jetzt für seinen Zweck zu kurz. —
Die urspr. Einheit des Gedichts ist wegen des doppelten Nasib zu
bezweifeln. Vs. 1—7 enthält einen solchen in Bezug auf eine
Rabi'a, Vs. 16—19 den Teil eines solchen auf Salmä; an den letzteren
schliesst durch Vs. 20 die ganze Schilderung des Wüstenritts und
der Madh der B. Bekr (20—44) an und weiter durch Vs. 45 dio
erneute Schilderung der Geliebten 45—50. Während an dein
zweiten Nasib ein grosser Teil des Gedichts hängt, kann man den
ersten mit dem anderen Geliebtennamen ohne Beeinträchtigung des
Ganzen sich fehlend und das Gedicht mit v_5^1iJt ^j(3> Vs. 8 be¬
ginnend denken, wie XXXIX, 1 u. s. — Weiter ist Vs. 45 Dublette
zu Vs. 8; er ist an dieser Stelle wohl fälschlich wiederholt ; denn
auch die Verse 46—50 sind hier unpassend. Sie mü.ssten urspr.
1) Agh. XI, 171, l.Tff; angeblich schon in der (jläbilijja, wie Suweid auch Z. 12 zu den Muhadramün gezählt wird. Aber Suweid ward für seine Streitgedichte von 'Abdullah b. 'Amir b. Kureiz (starb i. J. 59 in Küfa) und 'Ämir b. Mas'üd al-Gumal.ii (i. J. 04 zum Statthalter Ibn Zubeirs in Küfa gewählt) bedroht, bezw. in's Gefängnis geworfen (Agh. XI, 173), so dass ein so frühes Entstehen des Gedichts so gut wie ausgeschlossen ist. Auch Vs. 60 und 63 zeugen dagegen.
2) Die Echtheit ist durch Vs. 107 besonders bezeugt, wie auch die seines Higä Agh. XI, 173, 10.
3) Sie verherrlicht er in unserem Gedicht; s. Vs. 30 ff.
4) Vs. 104a ist für diesen Gegner auffällig; man würde diesen Zug eher bei dem Typus Vs 67 tf. erwarten.
3 0 *
mit Vs. 8 ff., namentlich der Schilderung der Geliebten 18. 19
Terbunden gewesen sein. — Vs. 66—90 rühmt sich der Dichter
dass manche heimlichen Feinde in seiner Gegenwart ihren Hass
verbergen ; denn sie treffen sonst in ibm auf einen unangreifbaren
Felsen. Die Schilderung des feigen Feindes Vs. 66—81 wird aber
in unmöglicher Weise von den Vss. 74. 76. 77. 78 unterbrochen, in
denen der Dichter von sich spricht; diese Verse gehören an eine
andere Stelle, wie etwa hinter Vs. 90.
Im Einzelnen ist noch zu bemerken: Vs. 11 gehört wohl
hinter Vs. 9, an den er ebenso anschliesst, wie Vs. 12 an 10. —
i.e. c. O
Vs. 12 giebt ^JUauj keinen Sinn, denn dem jJLb ^^.i-Aj lö! würde
der Nachsatz fehlen ; lies mit der Var. im Schol. Ed. Constantinopel
^^^Äjyjuj ,und es quält mich, so oft ein Stem aafgeht". — Vs. 33
scheidet sich durch sein »wir, unser' von der Umgebung ab, wo
der Madh von den B. Bekr in 3. Pers. Plur. spricht; der Vers
schliesst an Vs. 60 ff. an. — Vs. 34 ist nur das passive oLxLi^
o.J
richtig wegen des Gegensatzes ^J.
Ged. XL. Dies Gedicht des al-Mui-aqqiS al-akbar war urspr.
5
wesentlich grösser, wie die Worte Agh. V, 192, 15 — HAjyiai
üJLjjJa — bezeugen und auch seine jetzige Verfassung erschliessen
lässt. Aber auch der verbliebene Theil ist in der Versordnung
mannigfach gestört. Hinter Vs. 2 ist wohl gleich Vs. 4 einzustellen,
der den Zweck der „Zurückhaltung' angiebt, während Vs. 3, der
wie Vs. 6 beginnt, die unentbehrliche Fortsetzung verloren zu haben
scheint. — Hinter oder doch nahe an Vs. 6 sind die jetzt ver¬
sprengten Verse 15. 16 anzufügen, wie auch die Verse 17. 18
hinter Vs. 10. 11. — Die zwei Zusatzverse bei L nach Vers 17
dürften ein urspr. Bestandteil des Gedichtes sein und hätten vor
Vs. 12 ihre passende Stelle. — Das in Vs. 8 angedeutete ist das
in Vs. 12—14 erzählte Erlebnis; diese Verse standen daher wohl
urspr. mit Vs. 8 in engerer Verbindung.
3 0*
407
Theorie der ursemitischen labiaUsierten Gutturale.
Ein Beitrag zur Verständigung über den Begriff Ursemitisch.
Von Hubert Grimme.
Einleitung, (i)
Seit geraumer Zeit gilt Arabien, vor allem der Higäz, wo der
Qorän und die Hauptmasse der altarabischen Gedichte ihre Heimat
haben, als Kibla für die semitische Sprachforschung. Was immer
sich als semitisch giebt, angefangen von den ältesten babylonischen
Denkmälern bis hinab zu jeglichem modernen Dialekte oder Sprach¬
reste, muss es sich gefallen lassen, besonders in seinem Lautbestande,
zum guten Teile auch in seiner Pormentwicklung und Syntax nach
dem Normaltypus des Altarabischen abgewogen und gewertet zu
werden. Man teilt damit dieser Sprache eine Rolle zu, als sei sie
in ihren wesentlichen Teilen der Abklatsch des um manch Jahr¬
tausend vor ihr anzusetzenden Ursemitischen. ,Die arabische Sprache', so liess sich noch vor kurzem C. H. Cornill (Der israel. Prophetis¬
mus, S. 10) vernehmen, ,hat für die wissenschaftliche Erforschung des
semitischen Sprachstammes die nämliche Bedeutung wie das Sanskrit
für die indo.germanische Sprachwissenschaft, ja eine noch viel höhere ;
denn das Arabische steht dem Ursemitischen noch weit näher als
das Sanskrit dem Urindogermanischen.' Gegen diese anerkannte
Schulmeinung ist bisher eine Opposition nur in sehr bescheidenem
Maasse und mit noch bescheidenerem Erfolge aufgetreten.
Zu der Bestimmtheit, mit der man das Altarabische als .s
älteste Kind des Ursemitischen hinstellt, steht im auffälligen Geg : i-
satz , wie wenig es gelingen will , seine Pormen in manchen sn-
geblich jüngeren Sprachen wiederzufinden. Ich brauche nicht auf
die Eigenheiten des Assyrischen, Äthiopischen oder gar Amharischen
hinzuweisen ; auch in den Grammatiken von näher an das Arabische
grenzenden Sprachen werden Massen von angeblich unregelmässigen
Bildungen teils als Wucherungen , teils als verkümmerte Triebe
hingestellt, weil sie kein Analogon im Arabischen haben. Noch mehr
werden Bedenken erregt, wenn man beobachtet, wie der semitischen
Lexikographie, wo sie sprachvergleichend vorzugehen wagt, bei
Bd. LV. 27