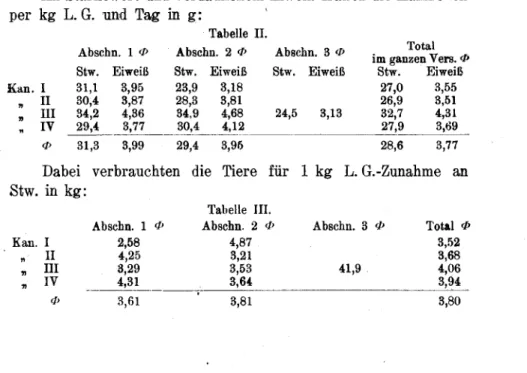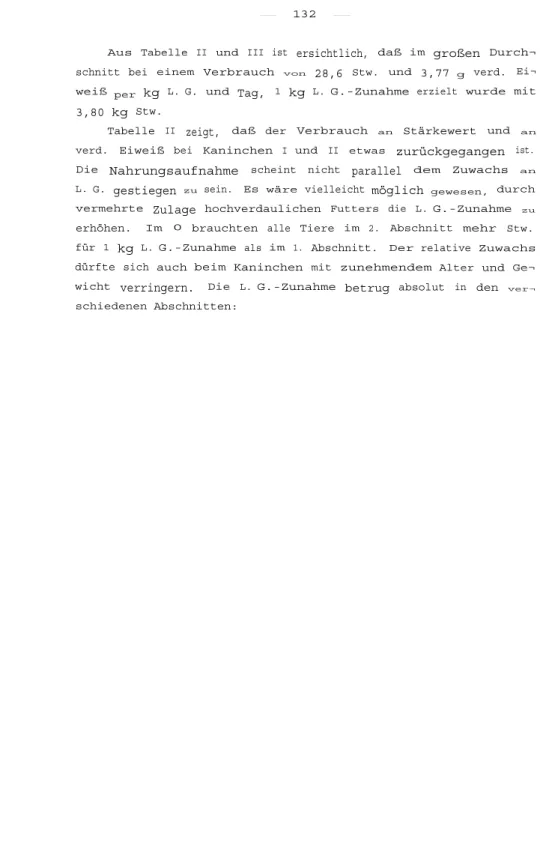Research Collection
Doctoral Thesis
Beiträge zum Stoffwechsel des Kaninchens
Author(s):
Meier, Kurt Publication Date:
1920
Permanent Link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000091429
Rights / License:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted
This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection. For more information please consult the Terms of use.
ETH Library
Beiträge zum Stoffwechsel des Kaninchens.
Von der
Eidgenössischen Technischen Hochschule
in Zürich
zur Erlangung der
eines Doktors der tedinisdiei
genehmigte
Promotionsarbeit,
vorgelegt von
Kurt Meier, dipl. Landwirt
aus Dänikon (Kt. Zürich).
Referent: Herr Prof. Dr. Q. Wiegner.
Korreferent: Herr Prof. Dr. E. Winterstein.
252
\nzrTz.uZ3
ZÜRICH 1920.
Diss.-Druckerei Gebr. Leemann 8t Co.
Stockerstr. 64
Leer
-Vide
-Empty
Leer
-Vide
-Empty
Herrn Prof. Dr. G.
WIEGNER,
für das mir in allen
Beziehungen entgegengebrachte
Vertrauen, sowie für die vielenAnregungen
undUnterstützungen
während meinerAssistentenzeit,
die das Zustandekommen dieser Arbeitüberhaupt ermöglichten,
herzlich zu danken.Leer
-Vide
-Empty
Allgemeiner
Die
vorliegende
Arbeit ist aufAnregung
Prof. Dr. G.Wiegner's
entstanden. Es sollte damit in der Schweiz der exakteAusnützungsversuch
an Futtermitteln am Tier für land¬wirtschaftliche Zwecke
eingeführt
werden. Daß esgerade
Unter¬suchungen
am Kaninchen sein mußten und nicht solche an land¬wirtschaftlich
wichtigen Tieren,
ist damit zubegründen,
daß es dem Institut damals an allem fürFütterangsversuche notwendigen
Materialmangelte.
Seither sindja
nun, dank der Initiative Prof.Wiegner's,1)
auch Versuche am Schafeermöglicht
worden.Das Versuchstier war
also,
durch die Umständebedingt,
ge¬geben.
Es handelte sich beivorliegender
Arbeit darum, ein mög¬lichst umfassendes Material zu beschaffen über die
Verdauung,
dieErhaltung
und die Produktion beimKaninchen,
um später Ver¬gleiche
mitgrößeren landwirtschaftlichen
Nutztieren anzustellen.Leider war es,
mangels
eines kleinenRespirationsapparates,
un¬möglich, vollständig durchgreifende
Ansatzversuche auszuführen.Bei der
Berechnung
der Resultatesollte,
so weitmöglich,
dieFehlerwahrscheinlichkeitsrechnung angewandt
werden. Sie wurde bisjetzt
bei Tierversuchenwenig
benutzt(vergl.
Th.Pfeiffer13),
S.225).
Prof. Wiegner verwendete sie bei derErmittlung
der V.K.*) bezüglich
verschiedener Brotsorten am Men¬schenWaund
b).
Die wahrscheinlichen
Schwankungen
der V. K. erreichen un¬gefähr folgende Beträge:
Für Roh- undReinprote'in 1—2,
für Rohfett und Rohfaser meist über2,
für die N.-freienE. ca.0,50—1,
für dieOrg.
S. ca.0,5,
für die T. S. ca.0,1—0,5
o/o. Die Größe der wahrscheinlichenSchwankung hängt
natürlich ab von der*) Siehe Abkürzungen.
Anzahl der
Analysen,
von derMenge
der Stoffe und von der Arbeitsweise desAnalysierenden.
Die Höhe der genannten wahr¬scheinlichen Fehler bezieht sich nur auf
Ermittlungen
an einem Tier. Wenn wir mehr als ein Tierverwenden,
so kommt zumAnalysenfehler
noch der sog.Individualfehler.*)
Je mehr Individuen wir zum Versucheheranziehen,
um sogeringer
wird voraussicht¬lich der
Individualfehler.
Mit der Anzahl der Tiere und der Ana¬lysen
wird beisorgfältigem
Arbeiten derBetrag
der wahrschein¬lichen
Schwankung,
d. h. desGesamtfehlers,
sinken.Naturgemäß
werden die Fehler auch höher bei Mischfutter als bei Einzelfutter.Aus dem
Gesagten
können wirentnehmen,
daßjeder Verdauungs¬
koeffizient mit einer
gewissen
Unsicherheit behaftet ist. Wir kennen immer nurMittelwerte
derAnalysen
und Mittelwerte der Individuen und damit muß auch das Endresultat einen Mittelwert darstellen. Die wahrscheinlicheSchwankung gibt
uns nun einenAnhaltspunkt dafür,
wie weit die Unsicherheit der Endresultate etwageht,
gestützt auf verschiedeneAnalysen
und event, ver¬schiedene Individuen. Fallen die
Endresultate
verschiedener zu¬sammengehöriger
Versuche in die durch die wahrscheinlicheSchwankung
gezogeneGrenze,
so können Differenzen unter denbezüglichen
Versuchen nicht als sicherfestgestellt
betrachtet werden. NurBeträge,
die den dreifachen Wert der wahrschein¬lichen
Schwankung übersteigen,
sind als sichernachgewiesene Veränderungen
zubetrachten,
die aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr auf Differenzen derAnalysen
event, der Individuenzurückgeführt
werdenkönnen,
sondern durchandere' Umstände bedingt
wurden. Einsolcher,
dieVerdauung beeinflussender Faktor,
ist z. B. dieKalkzulage
zum Futter beivergleichenden
Versuchen über dieWirkung
von Chlorkalzium zu kalkarmem Futter u. s. w.Die im
speziellen
Teilgefundenen Ergebnisse zeigen,
daß Rauhfutter vom Kaninchen etwas schlechter verdaut wird alsvom Pferd und
Wiederkäuer,
andere Futtermitteldagegen gleich gut,
soweitüberhaupt verglichen
werden kann.Wie in dem Abschnitt
„Beeinflussung
derAusnützung
derFuttermittel" gezeigt wurde,
ist derAusnützungskoeffizient
ab-*) Siehe Methodik.
hängig
von der Menge des Putters, vom Nährstoffverhältnis unddavon,
ob mit oder ohne Beifuttergefüttert
wurde.Wichtig
istnamentlich,
wie schonHenneberg
und Stohmann nach¬gewiesen haben,
dieZulage kohlehydratreicher
Beifutter, z. B. vonKartoffeln,
Stärke.Dergleichen
Versuche sind auch bereits vonanderer Seite
gemacht worden;
siebestätigen,
wie z. B. auchunsere Versuche mit
,,Daka"-Kartoffelmehl
undHeu, Topinambur
undFinalmehl,
Mais und Mais mitFinalmehl,
daß das Beifutter denVerdauungskoeffizienten
beeinflussen kann. Aus diesen Be¬obachtungen ergibt sich,
daßVergleiche bezüglich
der Verdau¬ung bei verschiedenen Tieren mit Vorsicht zu ziehen sind.
Eine
Beeinflussung
der Ausnützung der Nährstoffe durch mechanischeBearbeitung
der Futtermittel scheint bald nachweis¬bare,
bald keineErfolge
zu haben. Soergab
das fein vermahlene Finalmehl keine höhere Verdaulichkeit als dasAusgangsprodukt Kriegskleie
beim Kaninchen. Diese Befunde stehen imGegen¬
satz zu den
Ergebnissen
der Versuche von 0.Hagemann,
der für Finalmehl eine bessere Ausnützung konstatieren konnte als bei derzugehörigen
Kleie inbezug
auf Pferd und Schwein.Prof. W iegner konnte in seinen Versuchen am Menschen ebenso keine nennenswerte
Steigerung
der Verdaulichkeit des Finalmehlesgegenüber
Kleie feststellen.Die Versuche mit
Kalkzulagen,
und zwar CaCl2 bei Heu undFinalmehl,
ferner CaCl2 undCaCO,
bei Haferergaben
keine höhere Verdaulichkeit für Protein, wie sie namentlich bei Hafer mitCaCls-Zulage
nach 0. Loew hätte erwartet werden können.Loew
gibt
an, daß CaCOs dieMagensalzsäure
neutralisiert und daß darunter dieEiweißverdauung leidet,
während solche Schä¬digungen
beiVerfütterung
von CaCl2 ausbleiben.Dagegen ergab sich,
beiKalkzulage
sichernachweisbar,
für Finalmehl eine er¬höhte
Verdauung
derRohfaser,
einmal auch der N.-freienExtrakt¬stoffe und der
Org. S.,
zweimal ebenso der Trockensubstanz. Beim Hafer wurden besser verdaut dieAsche,
zweimal die Trocken¬substanz,
einmal dieOrg.
Substanz und immer dasKalziumoxyd.
In den Heuversuchen
konnte,
alseinzig
sicherfeststellbar,
in einem Falle eine erhöhteKalkausnützung bestätigt
werden. Imallgemeinen
ist dieWirkung
der Kalkzufuhr auf dieVerdauung
nur
gering.
Ans den Umsatzversuchen betreffend
Stickstoff,
Kalzium-Magnesiumoxyd
undPhosphorsäure
bei Hafer und Heufutter mit CaCls-
undCaCOs-Zulagen ergibt
sich fürRohproteïn:
Von fünf
Versuchspaaren
sind viermal sicher nachweisbar die Bilanzen verschlechtertworden,
d. h. dieKalkzulage
hatte eine erhöhteN-Ausscheidung
zurFolge gehabt,
die N-Retentionwar also verkleinert. Beim 5.
Versuch,
Hafer mitCaCU»,
sind keine bindendenSchlußfolgerungen möglich
gewesen. Ob es sich dabei um einen veränderten Zellstoffwechsel oder nur um ver¬mehrte
Absonderung
sonstwiezurückgehaltener Eiweißspaltpro¬
dukte
handelte,
konnte nicht ermittelt werden. Sicher istjeden¬
falls,
daß der Stickstoffumsatz beiKalkzulage,
sei es als CaCl2 oderCaC03,
zu Rauh- oder Körnerfutter lebhafter wird.Für das
Kalziumoxyd ergibt
sich immer sicher nachweis¬bar, unabhängig
von der Art derZulage,
eine vermehrte Kalk- retentionFür
Magnesiumoxyd
sind bei drei Versuchsreihen mit Hafer dieErgebnisse
nichteindeutig,
einmalergibt
sich eine verbesserteRetention,
zweimal ein schlechteres Zurückhalten dieses Stoffes.Im Heuversuch
steigt
beidemale die Retention.Fü- die
Phosphorsäure
ist nichts sicher feststellbar. Esscheint aber diePhosphorsäure
beiKalkzulage
besserzurückgehalten
zuwerden,
was mit denAngaben
Loe w's übereinstimmen würde.Die Natur des
Salzes,
ob CaCl> oderCaC03,
ist dabei ohnegrößeren Einfluß,
vielmehr scheint das Tier selber mit seineninneren,
nicht leicht übersehbarenKonstellationen,
wirksam zusein.
Was die
Stoffwechselprodukte anbelangt,
so istfestzustellen,
daß noch keine einwandfreie Methode existiert zurErmittlung
derMenge
dieser Produkte desTierkörpers
im Kot. Die von A.Mo rge n in
Vorschlag gebrachte Pepsin-Trypsinmethode
istgegen¬wärtig
die beste. Für die von uns mit der von G. Kühn ver¬besserten Stutzer'schen Methode
(Pepsin)
ermittelten Stoff¬wechselprodukte
amKaninchen,
wie für die von Prof.Wiegner
nach derselben Methode ermittelten
Stoffwechselprodukte
am Men¬schen, ergab
sich:1. Das Futter hat einen
spezifischen
Einfluß auf dieMenge
der im Kotabgeschiedenen Stoffwechselprodukte.
Beim Menschen ist es wahrscheinlich dieRohfaser,
oder ein durch siebedingter Rauhigkeits-
oder andererFaktor,
der sehr wirksam ist.2. Bei schwer verdaulichem Futter
gehen
die Stoffwechsel¬produkte
eher der verdauten Trockensubstanz oderOrg. Substanz,
bei leicht verdaulichem Futter eher der Kot-Trockensubstanz oder derOrg.
Substanz des Kotesparallel.
3. Leicht verdauliche Futtermittel
bedingen weniger Stpr.
im Kot als schwer verdauliche.
4. Die
Menge
derabgesonderten Stpr.
istabhängig
von In¬dividuum,
Rasse und Art.Bezüglich
desVergleiches
der am Tiergefundenen
natür¬lichen,
der durchKotverdauung korrigierten
und der mitPepsin¬
verdauung
ermittelten künstlichenVerdauungskoeffizienten
für Roh- undReinprote'in
wurdefestgestellt,
daß derkorrigierte
V.K.,
wie vorauszusehenist,
höher ist als der natürliche V.K. ; daß der künstliche V. K. fast immer höherliegt
als der natürliche V. K.(mit
Ausnahme von Mais undTopinambur); ferner,
daß die künst¬lichen V. K. immer etwas unter den
korrigierten
V.K. des Tieres stehen.Bestimmte Versuche
ergeben
dieMöglichkeit,
denErhaltungs¬
bedarf des Kaninchens festzustellen. Es sind die Versuche mit schwach
positiver
Stickstoffbilanz. Es wurde ermittelt:Der
ungefähre Erhaltungsbedarf
des nicht oder nurwenig produzierenden
Kaninchens stellt sich per Tag undkg
L. G. auf1,53
g verdauliches Eiweiß und62,2
Kai.physiologischen
Nutz¬wert,
bei einerVerdauungsarbeit
von ca.13,2
Kai. und einerAußentemperatur
von 16—18° C. Diese Zahlen(betr. Kalorien)
sind etwas höher als der von M. Rubn er ermittelteHunger¬
bedarf des Kaninchens. Aus den Rubner'schen Versuchen läßt sich per
Tag
undkg
L.G. durchschnittlich55,5
Kai. feststellen.Der
Vergleich
mit Mensch und Pferd für denErhaltungsbedarf
ergibt
auf 1kg Lebendgewicht
berechnet:Pferd rund 24 Kai.
phys
NutzwertMensch
„ 29 „
Kaninchen „ 62 „ „
„
Aus den
gegebenen
Zahlen läßt sich leicht der Bedarf einesausgewachsenen,
aufErhaltungsbedarf gesetzten
Kaninchens be¬rechnen. Ausschließliches
Erhaltungsfutter
für Kaninchen dürfte aber selten sein.Wichtiger
ist offenbar dieErmittlung
derRationen für die Produktion.Über die Produktion beim Kaninchen ließ sich aus Ver¬
suchen von H. Weiske ein Verbrauch von
3,99
g verd. Eiweiß und36,4
g Stärkewertermitteln,
das sind rund 137 Kai.phys.
Nutzwert per
Tag
undkg
L.G.,
in einem Alter von 2—7 Monaten.Damit wurde 1
kg Lebendgewichtszunahme
mit3,83 kg
Stärke¬wert eizielt.
Eigene
Versuche führten zufolgendem
Schluß:Wachsende Kaninchen sollten im Alter von 2—7 Monaten per
Tag
undkg Lebendgewicht 4,4 (4,7—3,8)
g verd.Eiweiß;
41—100 g
T.S.;
33(29—35)
gStärkewert,
das sind rund 12 Kai.physiolog. Nutzwert, erhalten,
bei einem Reineiweißverhältnis von1 :
7,4.
Fürungefähr
2—4 Monate alte Kaninchen dürfte die Eiweiß- undEnergiemenge
noch etwas erhöhtwerden,
bei einerVerengerung
des Reineiweißverhältnisses. Mit dieser Ration dürfte 1kg
L. G.-Zunahme mitungefähr 3,80 kg
Stärkewert erreicht werden. Wirsehen,
daß das Kaninchen etwas schlechterproduziert
als das Schwein beiungefähr gleichen Fütterungsnormen.
Die imspeziellen
Teilaufgeführten
G. Finger1 ing'schen
Normenfür Schweine weichen nicht stark von den von uns für das Ka¬
ninchen
gegebenen
Zahlen ab. Imgroßen
Durchschnittproduziert
das Schwein beigünstiger Fütterung
1kg
L.G. mitungefähr 2,75 kg Stw.,
das Kaninchen mit3,80 kg
Stw. Nun sind es aber erstwenige
Versuche amKaninchen,
die zu diesemErgebnis führten,
und es ist nichtausgeschlossen,
daß dieses Tiergünstiger
beigünstigerem Futter,
namentlich beiGrünfutter,
z. B.Klee,
als
Hauptfutter,
abschneidet. Diegefundenen
Werte sollten er¬härtet werden durch weitere Versuche event, an verschiedenen
Rassen,
z. B.hochgezüchteten
Fleischrassen.An Hand der ermittelten
Verdauungskoeffizienten,
die noch fürwichtige
Kaninchenfuttermittel vermehrt werdensollen,
dürftees nicht sehr schwer
sein,
dienotwendigen
Rationen zu berechnen und dem Alter der Tiere anzupassen.Eine
Berechnung
desProduktionskoeffizienten
für Eiweiß inbezug
auf die vom Menschen verwertbarenN-haltigen
Bestand¬teile des
Kaninchenkörpers ergab,
daßungefähr V3 (34,5 %)
desdem Tier zur Produktion zur
Verfügung
stehenden Eiweißes in verwendbarem Fleisch im Tier wieder erscheint. Mit den zurVerfügung
stehenden Mitteln waren genauereErgebnisse
nichtzu erhalten.
Man könnte nun — sehr mit Unrecht — der Kaninchenzucht und
-Haltung jeden volkswirtschaftlichen
Wertabsprechen wollen,
wenn man an die niederen
Verbrauchszahlen
und dieguten Schlachtergebnisse
beim Schwein denkt. Wenn wir nur die Fleisch¬produktion
als Ziel setzen, so müssenwir ohneweiteresdasSchwein vorziehen und namentlich industrielleKaninchenhaltung
verwerfen.Kaninchenzucht und -Haltung ist Kleinarbeit. Sie ist überall da
vorzuziehen,
wo Futter und Platz für Schweineungenügend
vorhanden sind. Sehr viele Abfälle können sonutzbringend
ver¬wendet
werden,
die des teuren Einsammelns und dergeringen Menge
wegen für Schweine nicht mehr in Frage kommen können.Dabei kann freie
Zeit,
die heute mehr als früher manchem zurVerfügung steht, nutzbringend angewendet
werden.Noch auf eine Bedeutung des Kaninchens mag
hingewiesen weiden,
nämlich die Verwendung dieses Tieres an Versuchs¬anstalten zur
Klärung
von Fragen derFütterungslehre.
Aus ver¬schiedenen, recht
naheliegenden
Gründen ist es oft nichtmöglich, Ausnützungsversuche
angrößeren
Haustieren durchzuführen. Da kann das Kaninchen eine Lücke ausfüllen. Das Kaninchen ver¬daut im
Ganzen,
mit Ausnahme derRauhfuttermittel,
nicht schlechter alsPferd,
Rind und Schwein. DerKaninchenversuch
istwenig
umständlich und leicht durchführbar und dabei minde¬stens so exakt wie die
Großtierversuche.
Wir erhalten damit Re¬sultate über die
Verdaulichkeit
vonFuttermitteln,
die wir als Mindestzahlen verwerten können und andernfalls ganz entbehren müßten. Nicht nur inbezug
auf die Verdauung von Futtermitteln ist das Kaninchen eingutes
Versuchstier. Es ist auch ein sehr-geeignetes Objekt
zum Studium derFragen
des Mineralstoff¬wechsels,
derAusnutzung
derAmide,
Fettsäuren u. a, den Fütte¬rungslehrer interessierender Fragen
derPhysiologie
des Tier¬körpers.
Obendrein sind solche Kaninchenversuche relativbillig
und bieten schon deshalb für alle mit
geringeren
Mitteln unter¬stützten Institute fast die
einzige Möglichkeit,
sichtierphysiologisch
-ziu
betätigen.
Spezieller
A. Methodik der Versuche.
1. Die
Durchführung
des Tierversuches.a)
Die Tiere.Übersicht über die verwendeten
Tiere,
derenBezeichnung
und dieentsprechenden
Versuche:Tier: Bezeichnung: Verwendet in Versuch:
Silberkaninchen 1 S tf 1 1,3,4,6,7,9,12,14,16,18,20, 22,25,29.
Schwarzes Kaninchen Schw. Kan. 2.
Silberkaninchen 2 S <$ 2 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24,26, 28, 30.
Schmetterling*) Schmetterling 5, 8.
(scheckfarbigesKaninchen)
Silberkaninchen I Kan. I Zuwachsversuch.
Kaninchen II(langhaarig) Kan. II „ „
Silberkaninchen III Kan. III „ „
Silberkaninchen IV Kan. IV „ „
Alle
Tiere,
mit Ausnahme des Kaninchens„Schmetterling",
sind unter sichverwandt,
sie stammen aus derselben Zucht. Als Ahnen der verwandten Tiere kommen in Frage in erster Linie das französischeChampagne-Silberkaninchen,76)
dann dasgewöhn¬
liche dunkle
Silberkaninchen,
das russische Kaninchen und dasgewöhnliche
Kaninchen. NachAusschaltung
der Kreuzungsver¬suche und
darauffolgende jahrelange Inzestzucht,
bei harterHaltung,
entstand das nun zu Versuchen verwendete Tier.Aus dem
Gesagten
läßt sich leicht das Auftreten farbloser undlanghaariger
Tiere erklären(recessive Merkmale).
KaninchenI, II,
III und IV stammen aus demgleichen
Wurf.') Von stud. agr. A. Luisier geliefert.
b)
Der Versuchsstall.Als Versuchsställe kamen die
gewöhnlichen
Kastenställe mit zwei Gittern und einem Zinkblechtrichter zurVerwendung.
Auf dem oberenweitmaschigen
Gitter (ca. 1 cmMaschenweite)
sitzt das Tier. Daszweite, engmaschige
Gitter dient zumAuffangen
der Kotballen. Der Zinkblechtrichterfängt
den durch beide Gitter fallenden Harn auf und leitet ihn in ein Gefäß. An der Hinter¬seite des Kastens ist die
Türe,
auf der Vorderseite sind die Freß-öffnungen
und derFreßtrog angebracht.
Holzlaufkästchen und Bisenbänder verhindern das Verschleudern von Futter fastvöllig.
Empfehlenswert
wären fernerFreßöffnungen
mitSchieber,
zumVerkleinern oder
Vergrößern
derFutter-Luken, entsprechend
der Größe des Tieres.c)
Das Futter.Das Futter wurde in der
Regel zerkleinert, und,
wennnötig, angefeuchtet
verabreicht. Die Rationen wogen wir zum Voraus ab für dievorgesehenen
Perioden und bewahrten dietäglichen Quanten
in Tüten oderPapiertellern
auf. BeimAbwägen
derFuttermengen
wurdezugleich
die zurAnalyse gelangende
Durch¬schnittsprobe
entnommen. Ein Zerkleinern des Hafers erwies sichz. B. als
notwendig,
weil das eine Tier denselbenentspelzte,
die Körner fraß und dieSpelzen liegen
ließ. Das Anfeuchten des Futters erwies sich alszweckmäßig
beifeingemahlenem Material,
um ein Verschleudern zu
verhüten,
andrerseits mußte die Wasser¬zulage
der Zusätze wegen(Chlorkalzium
z.B.)
stattfinden. Ver¬abreicht wurde Futter und Wasser 1—2mal im
Tag.
Futterreste wurdenzurückgewogen.
d)
Die Dauer der Perioden.Die
Vorperioden
dauerten5—10,
meist 6—8Tage.
DieHaupt¬
perioden
wurdenausgedehnt
auf 7—12Tage,
mit Ausnahme der 2. Periode des Versuches7,
die nach vierTagen abgebrochen
wurde. DieDauer,
namentlich derVorperioden,
ist fürgewöhn¬
liche
Ausnützungsversuche abhängig
von der Aufenthaltsdauer des Futters im Darmtrakt. 0.Kellner2),
S.29,
rechnet in derRegel
mit einer Zeit von 6—8Tagen,
bis die letzten Futterrestedes
Vorfutters,
beiFutterwechsel,
denKörper
verlassen haben.Bei unseren Versuchen beobachteten wir oft nach zwei
Tagen
schon das erste Auftreten von Kotballen des neuen Futters. Am 3.—5.Tage
dürfte der Futterwechsel im Darm zurHauptsache vollzogen sein,
so daß eineVorfütterung
von 6—8Tagen
ge¬wöhnlich
genügen
dürfte.e)
Das Sammeln von Kot und Harn zurAnalyse.
Zur
Analyse gelangten
immer dieGesamtmengen
des Kotes und Harnes einer Periode. DerenMenge
wurdetäglich
ermittelt.Der vom Zinkblechtrichter
aufgefangene
Harn wurde in einen mit Salzsäure beschicktenMeßzylinder geleitet.
Der auf dem zweiten Gitter(siehe
oben:Versuchsstall) angesammelte
Kot wurde gewogen, in den ersten sechs Versuchen mitSalzsäure,
in denfolgenden
Versuchen mit Chloroform sterilisiert. Die Kotballen des Kaninchens sind meist sotrocken,
daß mitAnwendung
desChloroforms,
das nach A.Morgen3)
unschädlich seinsoll,
einnachträgliches Trocknen,
wie es bei Salzsäurezusatznötig ist,
umgangen werden
kann.*)
Der gewogene Kot wurde nämlich auf einem lakierten Eisendrahtnetz über Chloroform in einem Exsikkatoraufbewahrt,
nach Abschluß der Periode 1—2Tage
an der Luft
liegen gelassen,
gewogen,gemahlen
und inStöpsel¬
flaschen zur
Analyse
verwahrt.f)
DasVersuchsprotokoll.
Für
jede
Periode wurde einVersuchsprotokoll geführt
und darintäglich
notiert:Datum, Gewicht, Temperatur
des Versuchs¬raumes,
vorgelegtes, aufgenommenes
Futter undWasser,
ferner Harn undKotmengen frisch,
später auch die Reaktion des Harnes in denVorperioden.
2. Die
Analyse
vonFutter,
Kot und Harn.a)
DieAnalyse
von Futter und Kot.Futter und Kot
wurden,
wo esnötig
war, noch feiner ge-*) N. Zuntz32) konservierte den Kot (Schweinekot) mit Weinsäure und fand im so getrockneten und frischen Kote gute Übereinstimmung bezüglich
des N-Gehaltes.
mahlen und der
gewöhnlichen Futtermittelanalyse*)
unterworfen.Bei
einigen
Versuchen wurde auch derCaO-, MgO-
undP205-
Gehalt ermittelt.aa) Wassergehalt.
Nachdem ein2—4stündiges
Trocknen bei 106°—110° C. sich als zuwenig
exaktherausgestellt hatte,
wurde immer 6 Stunden bei derangeführten Temperatur
ge¬trocknet und nach dem Erkalten gewogen. Die Differenz
ergab
denWassergehalt.
bb)
Asche. Es wurde nur der Gehalt an Roha s che in bekannter Weise ermittelt.ce)
Rohproteïngeha11. DerRohproteïngehalt4)
wurde nach K]e1dah 1 bestimmt(N-Gehalt. 6,25),
durch Aufschluß mitPhosphorschwefelsäure
undQuecksilber. Zeitweise,
wennP205
nicht erhältlich war,gelangte
reine conc. Schwefelsäure mitHg
oderCuS04
zurAnwendung.
dd)
DasReinproteïn
wurde ermittelt nach F. Barn¬stein,4)
durchFällung
des Eiweißes mitKupferhydroxyd
undnachheriger Verbrennung
nachKjeldahl
wie bei derRohproteïn- bestimmung.
Roh- undReinprote'inbestimmungen
der Versuche 18—28 mußten wiederholtwerden,
da sich mehreremaleunmög¬
liche Differenzen
ergaben,
d. h. mehr Rein- alsRohproteïn
kon¬statiert wurde. Bei der
Wiederholung
dergenannten Bestimmungen
wurde schließlich nur reine conc.H2SOt
undHg,
ohneP205,
ver¬wendet. Die so erhaltenen Resultate
ergaben
immer mehr Roh- wieReinproteïn.
Es scheint demnach das verwendeteP2Oä
un¬günstig
auf dieRohproteinbestimmung (Amidstoffe ?) gewirkt
zu haben.ee)
R0h fe11 geha11. Ca. 2 g derSubstanz,
genau ab¬gewogen, wurden bei 95° C. während zwei Stunden im Wasser- trockenschrankgewogen, hierauf sechs Stundenmit Äther entfettet im
Soxhletapparat.
Der so erhaltene Ätherextrakt wurde gewogen und in üblicher Weise als Rohfett berechnet.ff) Rohfasergehalt.
ImPrinzip
wurde nach der Weender-Methodegearbeitet.
2 g Substanz wurden zuerst mit') Alle Analysen wurden mindestens zweimal ausgeführt.
Schwefelsäure,
hierauf zweimal mitWasser,
einmal mitKalilauge,
dann wiedei zweimal mit Wassergekocht;
der so erhaltene Rück¬stand in einen mit etwas Asbest beschickten
Goochtiegel gebracht,
mit Alkohol und Ätherausgewaschen, getrocknet
bei 106°—110°C,
gewogen,verbrannt, zurückgewogen,
und der Gewichtsverlust nach dem Verbrennen als Rohfaser berechnet. Statt des Filtrier^ns mitFilterpapier
wurde nach HannsStiegler5)
mit Glasrohr und Glaswolle- resp.Glas-Asbest-Pfropfen
mit einer Wasserstrahl¬pumpe
abgesaugt.
Das Kochen mitSäure,
Wasser undLauge
wurde in 400 cm' fassenden gutenGlaskolben6) (Rohfaserkolben)
statt in
Bechergläsern
vorgenommen. Von Versuch 18 an wurde dann ganz nachStiegler gearbeitet.
Die einzelnen Proben wurden in Milchsterilisierflaschen von ca. 300 cm3gebracht
und mit dennötigen Reagenzien (Salzsäure
undKalilauge)
in einemgroßen Kochtopfe gekocht.
Esgelang
auf dieseWeise,
12 Be¬stimmungen
nebeneinander durchzuführen. Eine weitere Verein¬fachung
wäre event,möglich,
wenn man an Stelle desAbsaugens zentrifugieien*) würde,
wie dies v.Knieriem7),
S.71,
vor¬geschlagen
hat.gg)
Kalk- undMagnesiabestimmungen.
Zur Er¬mittlung
des Kalk- undMagnesiagehaltes
wurdejeweilen
ein salz¬saurer
Auszug hergestellt
und zwar nach denAngaben Glikin's,8),
S. 113 und 114.
Die
gewichtsanalytische Bestimmung
der genannten Stoffegeschah
nach den Vorschriften desselben Autors(S. 114, gleiches Werk).
hh) Phosphorsäuregehalt.
DiePhosphorsäurebestim¬
mung wurde
durchgeführt
in dem nachobigen Angaben
her¬gestellten
salzsaurenAuszug
nachWagner9),
S. 186. Zur Kon¬trolle
gelangte
auch verschiedene Male die Lorenz'sehe Me¬thode10),
S. 203 und269,
zurAnwendung.
ii)
Gehalt an verdaulichem Eiweiß im Futter und Gehalt des Kotes an StoffWechselprodukten.
Das verdauliche Protein im Futter wurde ermitteltnachS
j
o11ema*) Event, auch bei der Reinproteinbestimmung denkbar, indem man zu¬
gleich im Kjeldahlkolben aufkochen könnte.
und W
edemey
er"),
S. 259. WennPepsin
nicht erhältlich war, kamMagensaft,
nach Stuzer'sVorschriftu),
S.258,
zurAnwendung.
Die
Stoffwechselprodukte
sind bestimmt worden imKot,
wie das verdauliche Protein im Futter. Ca. 2 g Substanz wurden während zwei Stunden im Wassertrockenschrank bei ca. 95" C.erhitzt,
dann zurFettbestimmung
sechs Stunden mit Äther be¬handelt,
der Rückstand mitPepsin
oderMagensaft
48 Stunden nach Sj
o11e m a undWedemeyer11)
bezw.Stutzer11)
ver¬daut. Im nun noch bleibenden Rückstand bestimmten wir den
Stickstoffgehalt,
subtrahierten diesen vom Gesamtstickstoff desKotes, multiplizierten
mit6,25
und betrachteten die so erhaltene Zahl als Maß für die im Kot enthaltenenStoffwechselprodukte.
Es könnte nun durch das Trocknen ein Teil der Stoffwechsel¬
produkte
unlöslichgeworden sein,
wie C.Beger12),
S.176,
und A.Morgen3)
u. a.gezeigt
haben.Nachprüfungen
an zwei verschiedenen in unseren Versuchen erhaltenen Kotenergaben folgende Resultate*):
Kot 18 (Haferfutter): Kot 26 (Heufutter):
Erhitzt auf90°u.entfettet 0,84%Rohprot alsStoffwechselpr. 3,51%Rohprot.alsStpr.
Nicht erhitztu.nicht entfettet 1,16% „ ,, „ 3,14% „ „ ,,
Entsprechende Untersuchungen
von W.Thomann,**)
an Schaf¬kot
durchgeführt, ergaben:
bei 95°CimWassertrockenschrank Nicht erhitzt und ÜQt; getrocknet und entfettet; nicht entfettet;
unverdaulich geblieben unverdaulich geblieben
im Kot: im Kot:
I. 9.26 % 8.78 %
II. 9.19 % 9.75 %
III. 4.29 % 4.01 %
Die
vorliegenden
Versuche an Kaninchen- und Schafkot er¬gaben
also keineneindeutigen
Einfluß des Trocknens desKotes,
während zwei Stunden bei ca. 95° C. imWassertrockenschrank,
auf den verdaulichenStickstoffgehalt.
Diegeringen Schwankungen
*) Die Kote wurden im übrigen beim Sammeln überhaupt nicht oder nur
bei Temperaturen von nicht über 40° C. getrocknet.
**) Assistent bei Prof. Dr. G. Wiegner.
fallen
angesichts
der Unsicherheit der ganzen Methode zur Be¬stimmung
derStpr.
gar nicht in Betracht.b)
DieAnalyse
des Harnes.Der Harn wurde meist nur auf seinen N-Gehalt
geprüft.
Bei denVersuchen zurFeststellung
desKalk-, Magnesia-
undPhosphor¬
säureumsatzes wurden diese Stoffe auch im Harn ermittelt. Die
Stickstoffbestimmungen
sind nachKjeldahl durchgeführt worden,
die Kalk- undMagnesiabestimmungen
nachGlikin3),
S.337,
diePhosphorsäure
wie imKotauszug
nachWagner
und Lorenz.Den
Harnauszug
erhielten wir durch nasse Verbrennung nach Neumann(mit
HN03 undH2S04), Glikin*),
S. 111 und 112.3. Die
Berechnung
der Resultate.Die Resultate sind in üblicher Weise mit Hilfe von
Loga¬
rithmentafeln berechnet worden. Die
Berechnung
der Stoffwechsel¬produkte
auf die verschiedenenNährstoffgruppen
und Nährstoffewurden,
um diese Art derRechnung überhaupt
zuermöglichen,
mit dem Rechenschieberdurchgeführt.
Mit Hilfe dieses Instru¬mentes wurden auch die
Rechnungen
zurBestimmung
der Ver¬dauungskoeffizienten,
sowie dieFehlerrechnungen überprüft.
4. Die
Berechnung
der wahrscheinlichenSchwankung
verschiedener Resultate undBeurteilung
dieserResultate mit Hilfe der ermitteltenwahrscheinlichen
Schwankung.
a) Allgemeines, a)
DerAnalysenfehler.
Je
länger je
mehr scheint dieFehlerwahrscheinlichkeitslehre
auch im landwirtschaftlichen Versuchswesenberücksichtigt
zu werden. Oft wurde sie schon zurBeurteilung
derErgebnisse
vonVegetationsversuchen, weniger
oft für Auswertungtierphysio¬
logischer Experimente herangezogen.
Ausnützungs- und Stoff¬wechselversuchen haftet immer eine
gewisse
Unsicherheit an, be¬dingt
einerseits durch unvermeidliche Differenzen derAnalysen,
andrerseits durchungleiches
Verhalten verschiedener Individuen.Diese Unsicherheiten können wir mit Hilfe der Fehlerrechnung als
„wahrscheinliche Schwankung"
der Resultate feststellen. Ausden verschiedenen
Analysen
berechnen wir die wahrscheinlicheSchwankung,
durch dieAnalyse bedingt,
alsAnalysenfehler.*) Ergebnissen
verschiedener Individuen haftet außerdem ein Fehler an, den wir Individualfehler*)
nennen. Beide zusammenergeben
denGesamtfehler.*)
Die Sicherheit derSchlußfolgerungen
kann durcnAnwendung
derFehlerwahrscheinlichkeitsrechnung
nur ge¬winnen. Die Höhe der wahrscheinlichen
Schwankung
derErgeb¬
nisse,
d. h. der Gesamtfehlerkann event, zugründlicherem
Wieder¬holen der
Versuche, womöglich
auf breitererBasis, Veranlassung geben
und damitnurgünstig
wirken. Wohlnimmt dieVerarbeitung
derErgebnisse
derAnalysen
auch viel Zeit inAnspruch
; aber die Sicherheit derSchlußfolgerungen
solchermaßenverarbeiteter,
oftlangwieriger
und arbeitsreicher Versuche läßt dieMehrarbeit,
die die
Fehlerrechnung
mit sichbringt,
als leichterträglich
er¬scheinen13),
S. 245. DieRechnung
selbst fußt auf der Gauß'schen Methode der kleinstenQuadrate.
Bei allenBeobachtungen,
diewir machen
(Messungen, Analysen), ergeben
sich immer kleinere odergrößere Abweichungen
der einzelnenBeobachtungen
von¬einander. Wir können nun alle
Beobachtungen
zurBildung
eines Mittelwertesheranziehen,
wenn der wahre Wert unbekannt ist.Aus den
Abweichungen
könnenwir,
sowohl für die einzelne Be¬obachtung,
wie für das Mittel einen„mittleren
Fehler" berechnen.Nach Gauß wird der mittlere Fehler der
Einzelbeobachtung
m;resp. der mittlere Fehler des Mittels
M,
wenn wahreBeobachtungs¬
fehler
vorliegen,
d. h. der genaueMittelwert,
die genaueGröße,
bekanntist,
nachfolgenden
Formeln berechnet:m=m m=î/^n
"
n "
n-(n—1)
Dabei bedeutet:
m = der mittlere Fehler der
Einzelbeobachtung
M = der „ „ des Mittels
E = der wahre
Beobachtungsfehler
[E2]
= Summe derQuadrate
allerBeobachtungsfehler
n = Anzahl der
Beobachtungen.
*) Aus einer die Fehlerrechnung betreffenden, nicht veröffentlichten Ar¬
beit von Prof. Dr. G. Wiegner, angewendet auf die Brotversuche 1917/18.
Bei
tierphysiologischen Untersuchungen
sind wahre Mittel unbekannt. Wirkennen, durchMittelbildung
aus den einzelnen Be¬obachtungen,
nur das scheinbare Mittel. Dieses scheinbare Mittel kann demwirklichen,
aber nicht feststellbaren Mittel mehr oderweniger
nahestehen. "Wir haben es somit nicht mit mittlerenFehlern,
sondern mit scheinbaren mittleren Fehlern der Einzel¬beobachtung
resp. mit scheinbaren mittleren Fehlern des Mittelszu tun. Zur
Berechnung
dieser Fehlergelten folgende Formeln13),
S. 234:P!L
undM=-^
=|/-f
r n —1 laVn ' n-(n-
" '
n-(n
—1)
Dabei istm = scheinbarer mittlerer Fehler der
Einzelbeobaehtung (d.
h. mittl.Fehler bei scheinbarem
Mittel)
M = scheinbarer mittlererFehler desMittels
(des
scheinbarenMittels)
v =
Abweichung
derEinzelbeobaehtung
vom scheinbaren Mittel(v2)
= Summe derQuadrate
von vn = Anzahl der
Beobachtungen.
Die Formel ändert nur für m etwas, für Mformal nicht. Natür¬
lich ändern
beide,
da es sich nicht mehr umwahre,
sondern nur um scheinbare Mittel handelt.Beide Formeln sind für
häufigen
Gebrauch etwas umständlich.Sie lassen sich
vereinfachen,
ohne für unsere Zwecke anGenauig¬
keit zu verlieren. Für diese vereinfachte
Berechnung geht
manaus vom durchschnittlichen
Fehler,
der aus der Summe der Einzel¬abweichungen gebildet wird,
indem man diese Summe durch die Anzahl derBeobachtungen
ndividiert,
oder nach Rodewa1d durchV~n(n
—1).t = —^=7J=r-(v) .-= t = durchschnittlicher Fehler yn•(n l)
(v)
= Summe allerAbweichungen
n = Anzahl der
Beobachtungen.
Aus t erhalten wir m, indem wir t mit
1,2533 multiplizieren.
m = t •
1,2533
M(wie
oben) =Iû-
Vn
Man könnte nun mit diesen mittleren Fehlern der Einzel¬
beobachtung
resp. des Mittels rechnen. In der Praxis der land¬wirtschaftlichen Versuchsstationen
hat sichaber,
dergrößeren Anschaulichkeit
wegen, das Arbeiten mit demwahrscheinlichen Fehler, oder,
wasdasselbe bedeutet,
derwahrscheinlichen
Schwan¬kung eingebürgert.
Es solltedeswegen
auch in dervorliegenden
Arbeit mit diesen Wertengerechnet
werden. Bei einereinmaligen Wiederholung
derEinzelbeobachtung
oder der ganzen Reihe ist dieWahrscheinlichkeit
des Ausfallens der neuenwahrscheinlichen Schwankung
derEinzelbeobachtung
resp. des Mittels innerhalb 0 und demerstmalig gefundenen
Wert=0,5
d. h. dieWahrschein¬
lichkeit ist
gleich groß,
daß sie für die neueAbweichung
entweder höher oderniedriger
ausfällt als die alteAbweichung.
Die Fehler¬wahrscheinlichkeitslehre gibt
uns nunfolgende Angaben
über das Ausfallen derwahrscheinlichen Schwankung
resp. der mittlerenSchwankung*)
derEinzelbeobachtung
resp. des Mittels bei einerWiederholung
desEinzelversuches
resp. der ganzenVersuchsreihe:
Wahrscheinlichkeit W. für das Fallen einer
Abweichung
zwischen die Grenzen 0 und die n fache
n wahrscheinliche
Schwankung
mittlereSchwankung
0,5
0.264 0,3831,0 0,500
0,6831,5
0,688 0,866
2,0
0,823 0,954
2,5 0,908 0,988
3,0 0,957 0,997
4,0 0,993 1,000
5,0
0,999
—Angenommen,
wir hätten einen Versuchgemacht
und für das Resultat einewahrscheinliche Schwankung
Sberechnet,
sosagt
uns die Tabelle: Bei einer
lOOOmaligen Wiederholung
des Ver¬suches
liegt
derBetrag
für diewahrscheinliche Schwankung
*) Die Tabelle ist der bereits erwähnten Pfeifferschen Arbeit ent¬
nommen, S. 238. Die Beträge für die mittlere
Schwankung
interessierenuns hier nicht weiter, da wir nur mit der wahrscheinlichen Schwan¬
kung rechnen.
zwischen 0 und V2 S in 264 Fällen 0 „ 1 S „ 500 „ 0 „ 1,5S „ 688 „ 0 „ 2,0S „ 823 „ 0 „ 2,5S „ 908 „ 0 „ 3,0S „ 957 „
4,0S „ 993
5,0S „ 999
in 736 Fällenübersteigter den Wert für Va S
„ 500
., 312
>, 177
„ 92
„ 43
J» ï 77 7 17 „ s
)> J ÏJ ) )» » 1-5S
>) ) 7t ) >7 „ 2,0S
)> J ») ) 17 „ 2,5S
tt ' 77 J »J ., 3,0S
>) t TÏ 1 )) „ 4,0S
»J ) JJ ) 11 » 5,0S
Analog
sind dieseErläuterungen
zu denken für die mittlereSchwankung,
nur mit den dafürgegebenen
Werten.Haben wir zwei oder mehrere Versuche
durchgeführt,
die innur einer
Versuchsbedingung
sichunterscheiden,
undübersteigt
die Differenz der Schlußresultate dergegenüberzustellenden
Ver¬suche den dreifachen
Betrag
der wahrscheinlichenSchwankung,
so nehmen wir an, daß der Überschuß sicher dem Einfluß der veränderten
Versuchsbedingung
zuzuschreibenist.*)
Wie früher bemerkt
wurde,
haben wir hier mit der wahr¬scheinlichen
Schwankung
zu rechnen. Wir berechnen diese wahr¬scheinliche
Schwankung
des Mittels = R resp. der Einzelbeobach¬tung=r durch
Multiplikation
des mittleren Fehlers M bezw. mmit
0,674.**j
Wir erhielten in dem vereinfachten Verfahren mund M aus dem durchschnittlichen Fehler t.
t:
(V)
Vn(n-1)
; m= t •
1,2533,
teingesetzt ergibt:
m =
(y)
Also:
yn7(n_i)
00
1,2533;
r =m-0,674.
(v)
. _ .
• 1,2533 • 0,674 = —>^=- .
0,845.
Vn(n —1) yn(n —1)
m
M berechneten wir aus m; m —
1.1,2533;
M = -j=> den yn Wert für meingesetzt, ergibt:
M =
*llfA»,
da t =W_
fn Yn(n —1) ist,
soist M
nVn—1
•
1,2533.
*) Siehe später folgendes Beispiel.
*) 0,6744898, siehe Pfeifler, S. 233.
Aus M erhalten wir R = die wahrscheinliche
Schwankung
des Mittels durchMultiplikation
mit0,674, folglich
istR =
—riL 0,845.
nyn
—1n ist die Anzahl der
Beobachtungen.
Den Wert0,845
n
V
n—1können wirnun für
jede
AnzahlvonBeobachtungen
ausrechnenund bekommen dann diefolgende
Tabelle nach Pfeifferu),
S. 236.2
Beobachtungen
ist r =(v)- 0,598
und R =(v). 0,422
3 w r =
(?) 0,345
V B =(v) 0,199
4 11 r =
(v) 0,244
n R =(v) 0,122
5 » r =
(v) 0,189
V R ==(v) 0,085
6 11 r =
(v) 0,154
ii R =(y) 0,063
7 11 r =
(v) 0,130
il R =(v) 0,049
8 V r =
(v) 0,113
n R =(v)
0,04010 V r =
(v) 0,089
» R =(v) 0,028
H 11 r =(v) 0,081
V R=(v) 0,024
12 n r =
(v)
0,074 n R =(v)
0,021Auf diese Weise
gelingt
es, rasch die wahrscheinliche Schwan¬kung
derEinzelbeobachtung
= r resp. die des Mittels = R &u be¬stimmen. Die Summe aller
Abweichungen
vom scheinbaren Mittel (v) ist leichtgebildet,
sie muß nur noch mit dem der Anzahl vonBeobachtungen entsprechenden
Faktormultipliziert
werden. Wir haben imFolgenden
mit der wahrscheinlichenSchwankung,
oder alsogleichbedeutend
dem wahrscheinlichen Fehler des Mittels ge¬rechnet. Wie
eingangs erwähnt,
handelt es sich um die Fest¬stellung
desAnalysen-,
Individual- und Gesamtfehlers. Die Ge¬wichtszahlen
wurden als fehlerlos angenommen. DieAnalysen ergeben
fast immer Differenzen. Aus denErgebnissen
der Einzel¬analysen
wird das scheinbare Mittel berechnet. Dieses Mittelzeigt
nun eine wahrscheinliche
Schwankung,
die nach dem vorhin Ge¬sagten leicht zu berechnen ist. Diese
Schwankung
haftet nichtnur dem Mittel an, sondern auch allen
Zahlen,
die aus diesem Mittel mit Hilfe anderer mit Fehlern behafteten oder mit fehler-losen Zahlen
gebildet
werden. Der Fehlerpflanzt
sich nach demFehlerfortpflanzungsgesetz
fort. EinVerdauungskoeffizient
weistz. B. eine wahrscheinliche
Schwankung auf,
die aus den Ab¬weichungen
der Futtermittel- undKotanalyse
herrührt.*)ß)
Der Individualfehler.Wie Pfeiffer in seinem mehrfach erwähnten Buche ver¬
schiedenen
Jahrgängen,
event, verschiedenen Böden bei der Be¬urteilung
derDüngungserfolge Rechnung
tragenmuß,
müssen wir bei unserenVersuchen,
sobald wir mehrere Individuen zu dessenDurchführung heranziehen,
auch diesen verschiedenen In¬dividualitäten
Rechnung tragen.
Die verschiedenen Kaninchen arbeiten vielleicht verschiedengut
undbringen
damit etwas in den Versuchmit,
das ganz vom einzelnen Individuumabhängt.
Diesen Einfluß
berücksichtigen
wir im sog. Individualfehler. Be¬züglich
dessenErmittlung
sei auf dasBeispiel *) verwiesen,
in dem die den Mittelwertenentsprechenden Verdauungskoeffizienten
alsnormal
angesehen
werden.y) Der Gesamtfehler.
Der Gesamtfehler oder die totale wahrscheinliche Schwan¬
kung
ist nichts anderes als dieZusammenfassung
vonAnalysen¬
lind Individualfehler nach der Formel
G=
Va_2"+
J2 Vwobei G '=
Gesamtfehler;
A =Analysenfehler;
I = Individual¬fehler ist.
b) Beispiel
für dieDurchführung
der Berechnung der wahrscheinlichenSchwankung
und Aus¬wertung
derselben,a)
Orientierendes.Als
Beispiel
zurBerechnung
der wahrscheinlichen Schwan¬kung
und derenAuswertung
soll einAusnützungsversuch
mit Haferam Kaninchen
herangezogen
werden. In Versuch 18 und 19 wurde an Kaninchen Soi resp. Sô2je gleichviel Hafer,
im*) Siehe Beispiel für die Berechnung der wahrscheinlichen Schwankung.