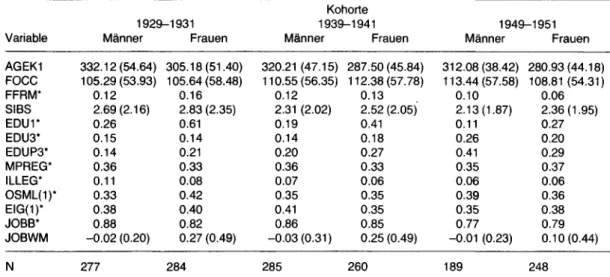Das zweite Kind
Sind wir auf dem Weg zur Ein-Kind-Familie? *
Johannes Huinink
Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Lentzeallee 94, D-1000 Berlin 33
Z u s a m m e n f a s s u n g : In diesem Beitrag wird theoretisch und empirisch untersucht, wie sich die Entscheidungssi
tuation im Zusammenhang mit der Geburt eines zweiten Kindes im Zuge des Wandels von Familie und Familienbil
dung verändert hat. Es wird der These entgegengetreten, daß wir auf dem Weg zur Ein-Kind-Familie sind. Dafür lassen sich eine Reihe von theoretischen Gründen angeben. Die zentrale These ist, daß mit der größeren individuellen Autonomie bei der Entscheidung für oder gegen eine Familie sich immer mehr Partner entweder gegen Kinder überhaupt oder aber eher für mehr als ein Kind entscheiden. Diese These läßt sich entscheidungstheoretisch, aber auch empirisch plausibilisieren. Mehr noch, es lassen sich deutliche Anzeichen dafür erkennen, daß sich jenseits der traditionellen Familienbildung zukünftig solche neuen Polarisierungsphänomene etablieren könnten.
1. Einleitung
In der derzeitigen Diskussion um den starken Wandel der Familienbildung in der Bundesrepu
blik Deutschland scheint eines ausgemacht zu sein:
ganz im Sinne des historischen Musters eines glo
balen Rückgangs der Kinderzahlen in den Ehen steuern wir auf eine Dominanz der Ein-Kind-Fa
milie zu, begleitet von einem erheblichen Anstieg kinderloser Partnerschaften. Danach werden im
mer weniger Männer und Frauen bereit sein, über
haupt noch Kinder groß zu ziehen, und wenn, dann nicht mehr als eins.
Der Anteil der Nachkriegsehen mit mindestens zwei Kindern ist jedoch relativ stabil geblieben.
Schätzungen für die nach 1970 geschlossenen Ehen weisen erst wieder nach unten* 1. Ist damit, wenn nicht gar schon das erste, so doch das zweite Kind prekär geworden? In der aktuellen und mehr noch in der idealen Wunschvorstellung dominiert bei dem überwiegenden Teil der Bevölkerung immer
* Ich danke für hilfreiche Kommentare und Hinweise Michael T. Hannan, Annemette Sörensen, Michael Wagner und Kollegen des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung.
1 Der Anteil der Ehen mit mindestens einem Kind ist seit dem Beginn dieses Jahrhunderts von 91% für den Eheschließungsjahrgang 1900-1904 auf 85% beim Ehe
schließungsjahrgang 1967-1971 (Marschalck 1984: 158) zurückgegangen. Bei Familien mit mindestens zwei Kindern ist ein Rückgang von 79% auf 58% zu ver
zeichnen. Besonders stark ist er bei Ehen mit minde
stens drei Kindern (von 63% auf 15%) und mindestens vier Kindern (von 48% auf 5%). Die Zahlen für den Ehejahrgang 1967-1971 basieren auf Schätzungen. Sie
he auch Nave-Herz (1987) und Huinink (im Druck).
noch die Zwei- oder gar Mehr-Kinder-Familie.
Dieser Anteil muß bei mehr als 80% angesiedelt werden (Kiefl/Schmid 1985: 250, 252, 365). Das steht zunächst in deutlichem Gegensatz zur aktuel
len Diskussion. Entgegen den geäußerten Wunsch
vorstellungen der Befragten wird gleichwohl die Zwei-Kinder-Familie häufig nicht realisiert (Kiefl/
Schmid 1985: 252ff.).
Die folgenden Überlegungen zur Frage der sozio
logischen Bestimmungsgründe für die Geburt zweiter Kinder gehen zunächst von bekannten Fra
gen aus: Welche individuellen Dispositionen und Entscheidungsprozesse sind für die Familienent
wicklung bedeutsam? Wodurch sind sie bedingt und wie sind sie mit den sich ändernden gesell
schaftlichen, politischen und kulturellen Rahmen
bedingungen, der sozialstrukturellen Umvertei
lung in der Bevölkerung verknüpft? Hat sich deren Bedeutung selbst, zum Beispiel im Vergleich zur Zeit des historischen Geburtenrückgangs in den beiden ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts verändert? Die Zuspitzung dieser Fragen auf die spezifische Analyse zur Geburt des zweiten Kindes ist theoretisch und empirisch bislang nur selten ausführlich erfolgt (Jürgens 1978; Bolte 1980;
Urdze/Rerrich 1981)2. In der Tradition der sozio- demographischen Forschung zur Geburtenent
wicklung steht durchweg die Analyse des individu
ellen Kinderwunsches oder der realisierten Kin
derzahlen im Vordergrund. Dieser Ansatz hat wichtige Einblicke in Strukturen der Nachwuchs
2 Neuere empirische Untersuchungen mit einer explizi
ten Differenzierung nach der Ordnungsnummer der Kinder werden noch vorgestellt.
beschränkung geliefert. Er ist aber sowohl metho
disch, empirisch wie theoretisch unbefriedigend.
Hinter sinkenden durchschnittlichen Kinderzahlen je Familie können sich sehr verschiedene Verände
rungen der Verteilung der Familiengröße verber
gen. Ohne eine Differenzierung nach der Ordnung der Geburt gelangt man daher zu Ergebnissen, die zahlreichen Fehlschlüssen unterliegen können3.
In einer theoretischen Analyse muß auch die spezi
fische Ausgangssituation vor einer möglichen Ent
scheidung für ein zweites Kind identifiziert wer
den. Sie ist auf die vorangegangenen Entschei
dungsprozesse zur Gründung einer Familie über
haupt und dessen Timing zu beziehen. Dazu gehö
ren Hypothesen über die Veränderung des Stellen
wertes einer Familie im individuellen Lebensver
lauf. Eine „Theorie des zweiten Kindes“ bedarf also einer „Theorie des ersten Kindes“ und einer konsistenten Theorie der Familienbildung und -entwicklung überhaupt.
Man kann schließlich keine im lebenszeitlichen Sinne geordnete Beziehungsstruktur zwischen zeit
unabhängigen und zeitabhängigen Merkmalen der Befragten und ihrer Familienkarriere modellieren, falls eine Unterscheidung nach der Parität unter
bleibt. Den gängigen Kinderzahlmodellen gelingt es daher nicht, die Einbettung der Familienent
wicklung in andere Bereiche des individuellen Le
bensverlaufs hinreichend genau nachzuzeichnen.
Um solche Analysen empirisch durchführen zu können, bedarf es aber einer adäquaten Daten
basis.
Nach der ausführlichen Erläuterung des theoreti
schen Konzepts mit seinem mehrebenenanalyti
schen Design werde ich in diesem Beitrag auf der Basis des Datensatzes der Lebensverlaufsstudie des Sfb 3 der DFG und des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung einige empirische Ergebnis
se vorstellen und interpretieren4. Die Daten bein
halten detaillierte Informationen zu den Lebens
verläufen von deutschen Staatsangehörigen der 3 Zimmermann (1985: 277ff.) z. B. kommt in seinen Analysen des Einflusses insbesondere des Ausbildungs- niveaus von Individuen auf ihr generatives Verhalten zu mißverständlichen Ergebnissen, da er bei der Kon
struktion einer Kategorialvariablen zur realisierten Kinderzahl ein Kind und zwei Kinder in einer Katego
rie zusammenfaßt.
4 Dieses Projekt wird in mehreren Phasen seit 1978 unter der Leitung von K. U. Mayer durchgeführt (Mayer 1979). Zu umfassenden Erläuterungen zu den Daten siehe Brückner et al. (1984), Blossfeld (1987), Huinink (1987;1988a).
Kohorten 1929-31, 1939-41 und 1949-51. Sie bie
ten damit die hervorragende Möglichkeit einer kohortenbezogenen Analyse der Familienentwick
lung in der Bundesrepublik Deutschland.
2. Theoretisches Konzept 2.1 Konzeptueller Ansatz
Ich habe in einem früheren Beitrag zu Bestim
mungsgründen der Geburt des ersten Kindes die Grobstruktur eines handlungstheoretischen Teils eines Mehrebenenansatzes formuliert (Huinink 1987). Er orientiert sich an der neueren Diskussion in der soziologischen Theorie, in der sich, ausge
hend von einer Reihe unterschiedlicher theoreti
scher, methodologischer und methodischer Aus
gangspositionen, die Neuformulierung eines „auf
geklärten“ handlungstheoretischen Paradigmas er
kennen läßt. Die zentrale Annahme dieses Ansat
zes ist die eines, wenn auch von „constraints“ und situationalen Bedingungen betroffenen, aber ge
mäß seiner Erwartungen über einen in der aktuel
len Konstellation zu erreichenden Nutzen, rational entscheidenden Individuums. Darüber hinaus wird versucht, über Konzepte, wie dem der nicht-inten- dierten Folgen individuellen Handelns, eine indivi
dualistische Erklärung der Entstehung und des Wandels sozialer Strukturen abzuleiten (Raub/
Voss 1981; Coleman 1986; Esser 1985; Wippler/
Lindenberg 1987).
Ein vollständiger Mehrebenenansatz vermeidet diese dominierende individualistische Orientie
rung (Huinink 1986). Den Ausgangspunkt bildet zwar auch eine enge Interdependenz zwischen in
dividuellen Entscheidungsprozessen, den daraus resultierenden Handlungen, ihren vielfältigen Fol
gen und gesamtgesellschaftlichen Prozessen. Er akzeptiert aber die Asymmetrie von gesellschaftli
chen Ebenen, die in der Richtung von „unten nach oben“ füreinander nicht beliebig durchlässig sind.
Man muß daher von der ausschließlichen Annah
me des aktiv und rational entscheidenden, weitge
hend autonomen Individuums abgehen: hierarchi
sche Beziehungen können individuelles Handeln als „passive“ Reaktion auf gesetzte Zwänge, also mitunter gar als Verhalten in der Extremform nicht-intendierten Handelns erscheinen lassen5 *. 5 Siehe zur Abgrenzung von „sinnhaftem“ Handeln und
bloß reaktivem Verhalten Ausführungen von Weber.
Er sieht zum Beispiel „rein traditionales Handeln“ auf der Grenze zwischen beidem und meint, daß die Gren
ze zwischen beiden „durchaus flüssig“ sei (Weber 1976:
2).
Die aktuelle soziologische Diskussion um den Wandel der Familie versucht nur selten, explizit in den Strukturen eines Mehrebenenansatzes zu ar
gumentieren (Linde 1984; Kaufmann 1988). Meist wird er auch nicht adäquat eingelöst (Hoffmann- Nowotny 1988; Beck 1986). Die Darstellungen führen nicht zu einer schlüssigen, interdependen- ten Verknüpfung der Prozesse auf unterschiedli
chen gesellschaftlichen Ebenen. Mikro- und Ma
kroebene bleiben theoretisch wie empirisch neben
einander stehen. Die Folge ist, daß die Theorien, soweit sie prozessuale Hypothesen ableiten, reine Makrotheorien bleiben, die mit problematischen, linearen Trendextrapolationen verknüpft sind6.
2.2 Theoretische Überlegungen zum Wandel der Familienentwicklung und zur Bedeutung des zweiten Kindes
2.2.1 Der gesellschaftliche Wandel des Familienbildungsprozesses
Nach dem historischen Geburtenrückgang zu Be
ginn des 20. Jahrhunderts (Linde 1984), der durch den rapiden ökonomischen Wandel und sinken
den, direkten Nutzen von Kindern bestimmt war, waren die normativen Grundlagen der Familie und der Elternschaft in der Folgezeit kaum gebrochen.
Sie kamen in den beiden ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg voll zur Entfaltung. Dazu gehörte der weitgehende Ausschluß von Frauen von qualifizierter Arbeit. Die Ausbildungsraten von Frauen waren bis zu den Kriegs jahrgangsko- horten eher gering. Der zu erwartende Nutzen einer Ausbildung war nicht groß. Frauen hatten sich auf ihre Rolle als Mutter und Hausfrau zu konzentrieren, ihnen war weitgehend die Aufgabe der privaten Sicherung der Reproduktionsbedin
gungen zugedacht.
Nur etwa 4% der Frauen und Männer in den Kohorten 1929-31 und 1939-41 bleiben ledig, zwi- 6 Für die soziologische Theorie der Fertilität muß man
zumindest auf den Ansatz von R. Freedman verweisen (Freedman 1975; Oppitz 1984). Freedman verbindet in seinem abstrakten Modell die sozioökonomische und demographische Struktur einer Gesellschaft und die normativen Rahmenbedingungen mit dem individuel
len generativen Verhalten, gemessen durch die endgül
tige Kinderzahl. Man vermißt die explizite Differenzie
rung nach der Ordnung der Geburt eines Kindes. Der Bezug zu den gesellschaftlichen und normativen Bedin
gungen des individuellen Geburtenverhaltens neben sozialstrukturellen und demographischen Variablen ist zudem zu eng auf die Familie direkt betreffende Aspekte begrenzt.
sehen 10% und 14% bleiben kinderlos. Circa 65%
der Männer und Frauen in diesen beiden Kohorten haben bis zum 40. Lebensjahr ein zweites Kind.
Das Heiratsalter und das Alter beim ersten Kind ist in der Kohorte 1929-31 noch hoch, in der Kohorte 1939-41 ist es aber deutlich zurückge- gangen7.
Das, was Schelsky in den 50er Jahren beschwor, die uneingeschränkte, institutionelle Verankerung der Autorität der Familie, war noch weitgehend intakt (Schelsky 1953). Das bedeutete für den ein
zelnen die weitgehende „Entlastung“ von einem echten Entscheidungsproblem bezogen auf den Eintritt in eine eigene Familienkarriere. Früher oder später war die Gründung der eigenen Fami
lie, das heißt die Ehe mit der bald folgenden Geburt des ersten Kindes, nahezu selbstverständ
lich. Die ökonomischen und normativen Parame
ter individuellen Handelns, oder hier besser „Ver
haltens“, waren gesetzt und nahezu allgemein an
erkannt. Über Familie wurde nicht räsoniert mit Ausnahme weniger sozialstrukturell eindeutig ver- ortbarer Teilpopulationen, die zumindest in dem Timing der Gründung der Familie eine auf die individuellen Bedürfnisse hin ausgerichtete Pla
nungsstrategie verfolgten. Dazu gehören Partner mit einer höheren Schulbildung und insbesondere Partnerschaften, in denen die Frau aufgrund einer eigenen Berufsausbildung die Chance zu einer qualifizierten Erwerbstätigkeit erhalten hatte (Huinink 1987). Generell könnte man auf einen Zustand der individuellen Indifferenz gegenüber der Frage der Familiengründung als Entschei
dungsproblem schließen, ein Zustand, der typisch für stark makrogesellschaftlich strukturierte Pro
zesse ist.
Diese Situation hat sich seit der Mitte der sechziger Jahre grundlegend geändert. Ein bedeutsames Moment dieses Wandels stellt das Anwachsen der individuellen Kompetenzen in der Familienpla
nung dar, unter anderem begründet durch die Ein
führung der oralen Kontrazeptiva in der ersten
7 Diese Zahlen gehen auf Schätzungen auf der Basis der Daten des Lebensverlaufsprojekts des Sfb 3 und des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung zurück.
Siehe Tuma/Huinink (1987), Papastefanou (1987).
Auch in der Kohorte 1949-51 heiraten zumindest die Frauen noch sehr früh. Im Alter 30 sind 88% der Frauen und 70% der Männer verheiratet. Das durch
schnittliche Alter beim ersten Kind steigt aber schon wieder an. 73% der Frauen und nur 50% der Männer dieser Kohorte haben aber bis zum Alter 30 das erste, 44% bzw. 23% das zweite Kind.
Hälfte der sechziger Jahre. Auch wenn diese Inno
vation im Bereich der Empfängnisverhütung nicht als eigentlicher Grund für die folgende Entwick
lung angesehen werden kann (Becker 1981), so bietet sie doch eine unverzichtbare Rahmenbedin
gung (Huinink im Druck; Beck-Gernsheim 1986).
Erstmals war in einer zuvor nicht gekannten Präzi
sion die Geburtenkontrolle und damit individuelle Familienplanung möglich geworden, ohne daß da
mit auch die individuelle, sexuelle Bewegungsfrei
heit eingeschränkt worden wäre. Der gesellschaft
lich anerkannte und bald vorausgesetzte Standard für die individuelle Kompetenz im Bereich der Geburtenkontrolle ist damit stark verändert wor
den. Das hatte vielfältige Folgen, wie die Locke
rung der Sexualnormen und der engen Bindung von Sexualität an Ehe und Familie. Gerade für Frauen war auch eine dezidierte Planung einer eigenen qualifizierten Erwerbstätigkeit mit voran
gehender Ausbildung realistischer geworden8.
Entscheidender aber sind Veränderungen im Bil
dungsbereich und im ökonomischen System in der Bundesrepublik Deutschland gewesen. Ende der sechziger Jahre war das Potential qualifizierter deutscher männlicher Arbeitskräfte ausgeschöpft.
Die ökonomische Bedeutung der Frau als poten
tielle Arbeitskraft in der Gesellschaft nahm enorm zu. Nicht so sehr die Arbeitskraft von Frauen für einfache, manuelle Tätigkeiten wurde verstärkt nachgefragt. Der Bedarf nach weiblichen Arbeits
kräften mit einem höheren Qualifikationsniveau, also mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung, hat sich zum Beispiel durch die Expansion des öffentlichen und privaten Dienstleistungssektors stark erhöht (Blossfeld 1987). Der enorme Zu
wachs des Anteils von Frauen mit einer Ausbil
dung von etwa einem Drittel in der Kohorte 1929-31 zu knapp drei Viertel in der Kohorte 1949-51 belegt, daß diese Nachfrage auf ein zuneh
mendes Angebot stieß. Es fand somit eine „Um
schichtung“ in der Qualifikationsstruktur von Frauenarbeit statt, ohne daß die absoluten Er
werbsquoten für Frauen besonders angestiegen wären (Tölke 1987: 86; Huinink 1988b).
Diese Entwicklung ist für das individuelle Selbst
verständnis von Frauen und infolgedessen auch für das gesellschaftliche Bild der Frau nicht bedeu
tungslos geblieben. Die tendenzielle Befreiung der Frau aus den überkommenen Abhängigkeiten in
8 Siehe dazu auch Beck-Gernsheim (1984: 61ff.), die dort die aus ihrer Sicht ambivalenten Konsequenzen insbesondere für die Frauen darlegt.
klar vordefinierten Partnerschaftsbeziehungen deutete sich an, wenn sich auch in der alltäglichen Praxis die neuen Rollenverhältnisse bis heute noch lange nicht konkret durchgesetzt haben (Beck- Gernsheim 1984;1986).
Die institutioneile Verankerung der Familie geriet zudem von Seiten der Protestbewegungen der spä
ten sechziger Jahre und auch der siebziger Jahre unter Druck, die gerade gegen die vielfältigen Folgen der ökonomischen Entwicklung und somit auch die Ideologie des „materialistisch“ orientier
ten Establishments antraten, zu der aus ihrer Sicht auch die traditionelle Form der Familie gehörte.
Die Umdefinition der Rollenverständnisse, die
„Erlösung“ des einzelnen von der Ergebenheit in das klassische Normenverständnis, seine „Indivi
dualisierung“ im Sinne der zunehmenden Loslö
sung seiner individuellen Entscheidungsstrukturen von normativen Vorgaben und ihrer Ausrichtung auf ökonomische Effektivitätsüberlegungen, läßt die Vorstellung des einzelnen zu einer möglichen Familienkarriere nicht mehr aus. Die Gründung einer eigenen Familie wird mehr und mehr zu einem grundsätzlichen, individuellen Entschei
dungsproblem, auch wenn in den familienpoliti
schen Zieldefinitionen weiterhin ihre klassische ge
sellschaftliche Strukturierungsfunktion deklariert wird9. Immer mehr Individuen sind sich dieser spezifischen Entscheidungsautonomie bewußt und nehmen auf der Grundlage dieses Bewußtseins wohlüberlegte Abwägungen für oder gegen eigene Kinder vor.
Die Brisanz der individuellen Entscheidungssitua
tion wird weiter verstärkt durch die modernen Anforderungen an Elternschaft. Kaufmann spricht in diesem Zusammenhang von dem „Normkom
plex der verantworteten Elternschaft“, der nicht nur die „Erziehungsverantwortung der leiblichen Eltern“ beinhaltet, sondern „auch die Norm, Kin
der nur dann zur Welt zu bringen, wenn man glaubt, dieser Verantwortung tatsächlich gerecht zu werden“ (Kaufmann 1988: 395). Der zitierte
„Normkomplex“ hat sich als wesentliches Element individueller Präferenzstrukturen etabliert. Ange
sichts der steigenden Anforderung an die familiale Erziehung, an ihre Sozialisationsfunktion und an familiale Ressourcen zur Eröffnung möglichst gu
ter Bildungs- und Ausbildungschancen für die Kin
der, verbindet sich die individuelle Verpflichtung, seiner Elternschaft gerecht zu werden, mit einem
9 Siehe dazu die Diskussion bei Drescher/Fach (1985), die diesen Widerspruch als Dilemma begreifen.
durchaus in sich widersprüchlichen Anforderungs
katalog an die Erziehungsleistungen (Beck-Gerns- heim 1986).
2.2.2 Die Entscheidung für oder gegen das zweite Kind
Ich werde nun verschiedene Typen von Partner
schaften mit einem Kind (Entscheidungssituatio
nen) nach der Art ihrer relativen Position zwischen traditionaler Familienbildung und „moderner“
Orientierung konstruieren10 11 12:
1. die „traditionell“ orientierten Partnerschaften bzw. Individuen, die sowohl nach ihrer Vorstel
lung wie aufgrund der Lebensumstände mehr als ein Kind haben werden und zu einem geringen Anteil überhaupt kinderlos bleiben. In diesen Partnerschaften dominiert eindeutig die „Famili
enorientierung“ (Strohmeier 1985) der Partner über andere alternative Optionen11.
2. die „halb-traditionell“ orientierten Partner
schaften bzw. Individuen, die sich noch der tradi
tionellen gesellschaftlichen Verpflichtung zur Re
produktion verpflichtet fühlen, jedoch weitgehend auf eine individuelle, autonome Lebensplanung ausgerichtet sind. Bei den Frauen gewinnt die „Be
rufsorientierung“ (Strohmeier 1985) eine gewichti
ge Bedeutung, ohne daß wegen der Bindung an die traditionelle Selbstverständlichkeit einer eigenen Familie mit Kindern eine planvolle Entscheidungs
situation mit dem Abwägen der Optionen gegeben ware .12
3. die „post-traditionell“ orientierten Partner
schaften bzw. Individuen, in deren Lebensplanung Vorstellungen traditioneller Familiennormen kei
ne wesentliche Rolle mehr spielen, die dagegen autonom in der Abwägung der individuellen Inter
essen über die Gründung einer eigenen Familie entscheiden. Die berufliche Karriere und die Op
tion auf eine eigene Familie sind „Gegenstand“
10 Siehe dazu auch Bolte (1980) oder aber Urdze/Rerrich (1981). Meine Klassifikation ist gröber als die von Urdze und Rerrich und auf die Bedürfnisse des folgen
den empirischen Modells eingeschränkt worden.
11 Bei Urdze und Rerrich wird hier nur bezogen auf Frauen weiter danach unterschieden, ob die Frau ak
tuell erwerbstätig ist („verhinderte Hausfrau“) oder nicht („überzeugte Hausfrau“) (Urdze/Rerrich 1981:
98).
12 Bei Urdze und Rerrich dürften hier der Typ der
„Hausfrau im Konflikt“ und der „traditionell orien
tiert berufstätigen Hausfrau“ gemeint sein (Urdze/
Rerrich 1981: 103ff.).
eines „individualisierten“ Entscheidungsprozesses, dessen Ergebnis aber keineswegs der völlige Ver
zicht auf eine eigene Familie bedeuten muß, wie noch zu zeigen sein wird13 *.
Für die erste der oben charakterisierten Gruppen ist zu erwarten, daß die Wahrscheinlichkeit für die Geburt von mehr als einem Kind hoch ist. Die Bedeutung dieses Typs der Partnerschaft dürfte aber stark zurückgegangen sein. Die Anhebung des allgemeinen Lebensstandards, die sich in den siebziger Jahren vollzogen hat, ist in erheblichem Ausmaß an den neuen Komfortwünschen und öko
nomischen Möglichkeiten von kinderlosen Part
nerschaften mit doppeltem Einkommen orientiert gewesen. Für größere Familien wurden elementare Bedürfnisse, wie ausreichender Wohnraum, damit immer schwerer erreichbar, zumal ihre Einkom
mensentwicklung mit den Kostensteigerungen nicht standhielt. Ihre relative Deprivation nahm zu (Huinink im Druck).
Die „halb-traditionell“ orientierten Partnerschaf
ten dürften in hervorragender Weise Kandidaten für eine Ein-Kind-Familie sein. Die Selbstver
ständlichkeit der Gründung einer eigenen Familie, die durch die angenommenen traditionellen Vor
stellungen zur Familie gegeben ist, garantiert gleichsam die Geburt eines ersten Kindes. Auf der anderen Seite läßt sie aber auf die Qualität des individuellen bzw. partnerschaftlichen Entschei
dungsprozesses schließen. Eine intensive, indivi
duelle und partnerschaftliche Auseinandersetzung mit der Frage einer eigenen Familie und der Ge
burt von Kindern ist eher selten. Die Konsequen
zen sind nicht ausgelotet, aber stellen sich bezogen auf die Neuorganisation des individuellen und partnerschaftlichen Lebens wie auf die Anforde
rungen an die Elternschaft ein. Die Bereitschaft, ein weiteres Kind aufzuziehen, dürfte damit eher gering sein.
Es wird mitunter argumentiert, daß die Ein-Kind- Familie die ideale Form der Familie sei, in der sich die individuellen, „modernen“ Interessen von Partnern, insbesondere Frauen, mit der normativ
13 Hier lassen sich Beziehungen zu gleich fünf Typen in der Klassifikation von Urdze und Rerrich herstellen:
„die berufsorientierte Hausfrau“, die „überzeugte Be
rufstätige“, die „freizeitorientierte Hausfrau“, die
„professionelle Mutter“ und die „berufsmüde Mutter“
(Urdze/Rerrich 1981: 112ff.). Das Phänomen eines
„neuen, kindorientierten Typus neben dem tradi- tionell-familienorientierten“ (Kaufmann 1988: 398) kommt bei Urdze und Rerrich noch nicht vor.
starken Anforderung an die Erziehung und Be
treuung von Kindern vereinbaren läßt (Simm 1988). Das setzt die Annahme voraus, daß die traditionelle Norm der Familiengründung und der Reproduktion sich nicht vollständig abbaut und in Resten wirksam bleibt. Es bleibt gleichsam im individuellen Entscheidungsprozeß ein permanen
ter Resteffekt von nicht hinterfragter gesellschaft
licher Verpflichtung bestehen, dem mit der Ein- Kind-Familie Genüge geleistet wird. Ich nehme an, daß mit dem Verschwinden der Reste traditio
neller Verpflichtung auch der Typ der Ein-Kind- Familie ein geringeres Gewicht erlangt, wie es in der rein traditionellen Form auch schon der Fall war. Doch heute und erst recht in den hier unter
suchten Kohorten gibt es immer noch einen erheb
lichen Anteil in der Bevölkerung, für den traditio
nelle Normen der Familienbildung eine große Rol
le spielen. Sozialisationserfahrungen im Eltern
haus und im sozialen Kontext haben eine große Bedeutung, wie für die Geburt des ersten Kindes nachgewiesen werden konnte (Huinink 1987).
Die „post-traditionellen“ Partnerschaften bilden eine anwachsende Gruppe, in der man sich zum einen zunehmend sehr bewußt und klar gegen eine eigene Familie, d. h. also auch gegen eigene Kin
der, und zugunsten alternativer gesellschaftlich ge
botener Optionen ausspricht. Eine andere Teil
gruppe von Personen oder Partnerschaften aber entscheidet sich bewußt und mit demselben Niveau der Reflexion für eine Familie. Das bedeutet, so lautet die weiterführende These, daß diese Partner eher nicht nur ein Kind, sondern mindestens zwei Kinder haben werden.
Damit behaupte ich, verkürzt formuliert, eine Po
larisierung in den Verhaltensstrukturen der Mit
glieder innerhalb der „post-traditionellen“ Grup
pe14. Die individualisierten Entscheidungsprozesse im Bereich der Familienbildung folgen keinem do
minanten Muster, sondern führen zu neuen diffe
renzierten Strukturen, in denen die Familie mit Kindern eine neue „qualifizierte“ Position besitzt.
Die autonome Entscheidung für oder gegen eine Familie ist untrennbar mit einem bestimmten Aspirationsniveau bezogen auf die Qualität der
14 Auch Kaufmann spricht von einer „Polarisierung“
(Kaufmann 1988: 398). Bei ihm ist damit aber eine Kluft zwischen „traditioneller Familienform“ und „al
ternativen Lebensformen“ gemeint. Dem wird hier nicht widersprochen. Doch darf die Kaufmannsche These nicht mit der hier vorgetragenen These gleich
gesetzt werden.
Bedingungen des Aufwachsens der Kinder verbun
den, einmal abgesehen von der Frage, inwieweit die Garantie einer problemlosen Erwerbstätigkeit beider Partner gegeben ist beziehungsweise einmal gegeben sein wird oder nicht. Zur Vorstellung optimaler Bedingungen des Aufwachsens von Kin
dern gehört zum einen, daß sie in der bestmögli
chen Weise mit der emotionalen Zuwendung der Eltern, materiellen Ressourcen und schließlich Bil
dungschancen versorgt sind. Ergebnisse empiri
scher Untersuchungen zeigen aber, daß für die Sozialisation von Kindern das Aufwachsen in einer sozialen Situation mit anderen Kindern für unver
zichtbar erachtet wird15. Aus dieser Perspektive wird das zweite Kind, wie Fachinger es ausdrückt, auch als „Kind für das Kind“ gewünscht und gebo
ren (Fachinger 1980). Auch in der Untersuchung von Urdze und Rerrich wird insbesondere für Frauen mit einem höheren Bildungsniveau eine entsprechende Einstellung belegt (Bolte 1980)16.
2.3 Die Entscheidung für das zweite Kind:
Zusammenfassung und Operationalisierung 2.3.1 Einige Ergebnisse aus der bisherigen
Forschung
In der soziologischen und ökonomischen For
schung zum individuellen generativen Verhalten lassen sich einige Ergebnisse für das zweite Kind finden. Sie sind aber alle auf die jüngere Zeit bezogen und geben keine Hinweise auf historische Veränderungen.
Nach Grunwald et al. (1988) ist für Frauen mit einem Kind, die zum Zeitpunkt der ersten Erhe
bung (1981/1982) zwischen 18 und 30 Jahre alt
15 Das wird z. B. auch nicht von Dessai bestritten, die konsequent einen Trend zur Kinderlosigkeit bzw. Ein- Kind-Familie progagiert und mit ausgewählten Bei
spielen zu belegen versucht. Sie meint allerdings, daß das Aufwachsen von Kindern unter Kindern auch ein Aufwachsen von „Einzelkindern“ unter „Einzelkin
dern“ sein kann, da man „relativ leicht andere Einzel
kind-Eltern“ findet, „die Kinderaustausch praktizie
ren möchten an Wochenenden oder im Urlaub“ (Des
sai 1985:106).
16 Einen Sonderfall dürften hier die „neuen Mütter“
darstellen, Frauen, die sich erst sehr spät, aber auch sehr bewußt ein Kind wünschen und bekommen. Eine ausführliche Diskussion dieses Phänomens findet sich bei Beck-Gernsheim (1986), ohne daß dort genauere empirische Belege über den zahlenmäßigen Umfang dazu angeführt würden.
waren, die Wahrscheinlichkeit, innerhalb von etwa zwei Jahren ein zweites Kind zu bekommen, nega
tiv mit dem Leben in der Großstadt korreliert17.
Die Anzahl der Geschwister, eine Familienbildung (Geburt des ersten Kindes) in jungem Alter und ein höherer Bildungsabschluß der Befragten wie der Eltern hängt positiv mit der Wahrscheinlich
keit für ein zweites Kind zusammen (Grunwald et al. 1988: 50). In demselben Projektzusammenhang stellt Simm fest, daß eine starke Kindorientierung der Befragten „nur Einfluß auf die erste und dritte Elternschaft“ haben, nicht aber auf die zweite.
Hier, so meint sie belegen zu können, ist es eher die Berufsorientierung und Orientierung auf indi
viduelle Unabhängigkeit seitens der Frau, die den Verzicht auf ein zweites Kind nahelegt (Simm 1988: 119,135).
Nach Höpflinger nimmt in der Schweiz die Wahr
scheinlichkeit für ein zweites Kind mit der Größe der Herkunftsfamilie und dem Bildungsniveau, dieses allerdings nur bezogen auf den Mann, sowie der Religiosität zu. Das Einkommen des Eheman
nes und die Berufsorientierung der Frau sind eher negativ damit korreliert (Höpflinger 1984: l?8f.).
Gisser et al. können für Österreich keine signifi
kanten Effekte des Alters bei der Eheschließung und der Bildung auf die Geburt des zweiten Kindes nachweisen. Das gilt erst wieder beim dritten Kind (Gisser et al. 1985: 73). Sie belegen aber auch die hervorragende Bedeutung der Wohnortgröße so
wie des Erwerbsstatus und der Berufsorientierung der Frauen (81ff.).
Für schwedische Frauen konnten Hoem und Hoem (1987a; 1987b) einen positiven Bildungseffekt so
gar noch für die Geburt eines dritten Kindes bele
gen. Sie begründen dieses Ergebnis damit, daß die ökonomischen Bedingungen und anzunehmende bessere Zukunftsperspektiven hoch ausgebildeter Frauen eher die Geburt mehrerer Kinder erlau
ben. Außerdem, so argumentieren sie, dürfte es für diese Gruppe von Frauen einfacher sein, die in Schweden zur Verfügung stehenden Unterbrin- gungs- und Betreuungsmöglichkeiten für Kinder zu nutzen.
17 Die Studie „Generatives Verhalten in Nordrhein- Westfalen“ (Leiter: F.-X. Kaufmann und K.-P. Stroh
meier) des Instituts für Bevölkerungsforschung und Sozialpolitik an der Universität Bielefeld ist als Panel
design angelegt und beinhaltet drei Befragungswellen in ausgesuchten Regionen Nordrhein-Westfalens. Die Ergebnisse, die hier referiert werden, basieren auf Daten der ersten beiden Wellen (Grunwald et. al.
1988).
Jensen (1985) untersucht die Übergangsraten zum zweiten Kind auf der Basis norwegischer Lebens
verlaufsdaten und konzentriert sich dabei insbe
sondere auf die Rolle der Erwerbstätigkeit der Frau. Für die Geburt des zweiten Kindes referiert Jensen für nichterwerbstätige Frauen signifikant negative und für erwerbstätige Frauen kurvilineare Effekte des Bildungsniveaus mit höheren Wahr
scheinlichkeiten für niedrige und hohe Bildungs
gruppen. Auch hier bestätigen sich die positiven Effekte einer frühen Familienbildung (Jensen 1985: 19ff.). Jensen findet trotz der oben erwähn
ten Interaktionseffekte keine signifikanten Unter
schiede im generativen Verhalten aktuell erwerbs
tätiger bzw. nicht erwerbstätiger Frauen.
2.3.2 Operationalisierungen
Die zuvor formulierten Hypothesen sollen in ei
nem eigenen Modellansatz zur Wahrscheinlichkeit einer Entscheidung für ein zweites Kind überprüft werden. Sie sind daher zu operatiofialisieren, das heißt theoretisch zu konkretisieren. Ein Indikator zur historischen Verortung der Entscheidungssi
tuation ist die Kohortenzugehörigkeit der Befrag
ten. Entscheidend ist ein Vergleich der Kohorte 1949-51 mit den älteren Kohorten, da angenom
men wird, daß ein Trend zu der oben skizzierten Gruppe der „post-traditionell“ orientierten Perso
nen in dieser Kohorte am weitesten fortgeschritten ist. Zentral sind Indikatoren der Autonomie und des Reflexionsgrades der individuellen Entschei
dungssituation, insbesondere des Informationsni
veaus bezogen auf die gesellschaftlichen Bedingun
gen von Familienbildung, ihrer Planung und der Optionen für die Realisierung individueller Inter
essen. Das Bildungsniveau spielt dabei eine ent
scheidende Rolle, wie durch die bisherigen For
schungsergebnisse auch einwandfrei zu belegen ist.
Wir wissen, daß mit dem Bildungsniveau die Nei
gung, überhaupt eine eigene Familie zu gründen, stark zurückgeht und die Familienbildung stark verzögert wird. Gemäß der Hauptthese müßte der Anteil der Eltern mit einem ersten Kind, die auch ein zweites Kind bekommen, mit dem Bildungsni
veau aber zunehmen. Aus meiner theoretischen Konstruktion läßt sich aber ableiten, daß dieses Phänomen erst für die jüngeren Kohorten zutrifft.
Wenn auch in der Bundesrepublik im Vergleich zu Schweden deutlich unterschiedliche Bedingungen für die Betreuungsmöglichkeiten von Kindern herrschen (Ott/Rolf 1987), so dürfte auch die Inter
pretation von Hoem und Hoem (1987a; 1987b) zur Bedeutung des Bildungsniveaus mit in Betracht zu ziehen sein.
Wie erwähnt spielt das Timing der Familienbil
dung eine große Rolle; dazu gehören Angaben über das Alter bei der Eheschließung, die Dauer von der Eheschließung bis zur Geburt des ersten Kindes und das Alter, zu dem das erste Kind geboren wurde (Marini 1981). Eine Schwanger
schaft in nichtehelichen Partnerschaften kann dar
auf hindeuten, daß das Kind nicht geplant ist, oder kann als Hinweis auf ein „laissez faire“-Verhalten in der Familienplanung verstanden werden. Die Wahrscheinlichkeit für ein zweites Kind müßte demnach unterdurchschnittlich sein.
Auch aktuelle Faktoren und Zustände im Lebens
verlauf der Befragten müssen in den Zusammen
hang der Argumentation eingebunden werden.
Hier ist vor allem die Erwerbstätigkeit zu nennen.
Im Gegensatz zu Schweden ist die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit für Frauen in der Bundesrepublik immer noch sehr problematisch (Ott/Rolf 1987). Das heißt, daß die Erwerbsaufga
be schon bei der Geburt des ersten Kindes in der Bundesrepublik immer noch die Regel ist (Tölke 1987). Daher ist es für eine ergänzende Operatio
nalisierung eines Indikators für den Grad der tradi
tionellen Orientierung interessant zu wissen, ob Frauen schon bei der Eheschließung ihren Job aufgeben. Ist das der Fall, ist mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eines zweiten Kindes zu rech
nen. Ob Frauen, die auch nach der Geburt des ersten Kindes erwerbstätig bleiben oder die Er
werbstätigkeit wieder aufnehmen, weniger häufig ein zweites Kind haben werden, ist nicht sicher. Ist eine Mutter mit einem Kind erwerbstätig, könnte sie Regelungen gefunden haben, die es ihr ermög
lichen, trotz des Kindes ihren Beruf auszuüben.
Das gilt um so mehr, je besser ihr Eintritt in die Mutterschaft geplant ist. Man könnte daher erwar
ten, daß die Rolle der Erwerbstätigkeit auch nach dem ersten Kind von Kohorte zu Kohorte geringer wird. Bei Männern stellt die Nichterwerbstätigkeit einen starken Indikator für eine ökonomisch au
ßerordentlich schwierige Lage dar, die sich negativ auf die Möglichkeiten der Erweiterung der Familie auswirken dürfte.
Für die Frauen steigt nach der ökonomischen Fa
milientheorie mit dem Berufsstatus der potentielle Verlust an Einkommen (und Prestige) bei einer erzwungenen Aufgabe der Stelle an. Der Anreiz zu einer möglichst schnellen Wiederaufnahme, z.B. nach einer Unterbrechung der beruflichen Tätigkeit bei der Geburt des ersten Kindes, wird größer sein. Die Geburt des zweiten Kindes be
deutet aber ein weiteres Unterbrechungsrisiko
(Huinink 1988b). Man kann daher annehmen, daß Frauen nicht bereit sind, dieses Risiko auf sich zu nehmen, wenn sie in einer höheren Position tätig sind. Auf der anderen Seite dürften mit der beruf
lichen Stellung der Frau und des Mannes wieder
um die Ressourcen für die Bereitstellung von Be
treuungsmöglichkeiten kovariieren. Dann wäre aber ein positiver Effekt der beruflichen Stellung der Frau bzw. des Mannes zu erwarten.
3. Methodische Vorüberlegungen zur empirischen Analyse
Die empirische Prüfung der theoretischen Ablei
tungen zur Geburt des zweiten Kindes weist einige spezifische Probleme auf, die hier nicht im einzel
nen diskutiert werden können. Sie lassen sich auf verschiedene Weise lösen. In diesem Beitrag wer
de ich nur eine Strategie der Modellschätzung vor
stellen18.
Zum Vergleich der Kohorten 1929-31 und 1939-41 mit der Kohorte 1949-51 führe ich eine Analyse mit Hilfe eines modifizierten Verfahrens der Schätzung altersspezifischer Übergangsraten zum zweiten Kind unter Verwendung der Methode des
„Episodensplittings“ durch (Blossfeld et al. 1986).
Ich verwende ein Verfahren der Ereignisdatenana
lyse, da für einen großen Teil der Befragten in der Kohorte 1949-51 nur rechtszensierte Informatio
nen vorliegen. Sie waren zum Befragungszeitpunkt erst ca. 31 Jahre alt. Die Risikozeit bezogen auf die Geburt eines zweiten Kindes beginnt im Modell sieben Monate nach der Geburt des ersten Kindes und läuft maximal bis zu einem Alter von 45 Jahren19. Dieses Altersintervall unterteile ich in
18 Zu einer ausführlicheren Diskussion siehe Huinink 1988c. In dieser Arbeit wird auch ein anderer Schätz
ansatz vorgestellt, der allerdings nur auf die beiden Kohorten 1929-31 und 1939-41 anwendbar ist, in de
nen die Familienbildung praktisch abgeschlossen ist.
Dabei erfolgt die Schätzung der Wahrscheinlichkeit für die Geburt eines zweiten Kindes überhaupt und die Schätzung der Zeitdauer seit der Geburt des ersten Kindes in verschiedenen multivariaten Modellen.
Letztere kann man mit einem linearen Regressionsmo
dell schätzen, wenn man dafür kontrolliert, daß dabei nach Personen mit einem zweiten Kind selegiert wird.
19 Eine Analyse altersspezifischer Übergangsraten, bei der die Risikozeit erst nach dem Eintreten eines be
stimmten Ereignisses, also im Prinzip bei jedem Indi
viduum in einem anderen Alter beginnt, ist meines Wissens bislang nur mit dem Programm RATE (Tuma 1986) möglich.
Tabelle 1 Mittelwerte der einbezogenen nicht-zeitabhängigen Variablen für Männer und Frauen mit einem Kind der Kohorten 1929-1931.1939-1941 und 1949-1951; wenn die Variable keine Dummy-Variable ist, ist in Klammern auch die Standardabweichung angegeben.
Kohorte
1929-1931 1939-1941 1949-1951
Variable Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen
AGEK1 332.12(54.64) 305.18(51.40) 320.21 (47.15) 287.50 (45.84) 312.08 (38.42) 280.93 (44.18) FOCC 105.29 (53.93) 105.64(58.48) 110.55 (56.35) 112.38 (57.78) 113.44 (57.58) 108.81 (54.31)
FFRM* 0.12 0.16 0.12 0.13 0.10 0.06
SIBS 2.69 (2.16) 2.83 (2.35) 2.31 (2.02) 2.52 (2.05) 2.13(1.87) 2.36(1.95)
EDU1* 0.26 0.61 0.19 0.41 0.11 0.27
EDU3* 0.15 0.14 0.14 0.18 0.26 0.20
EDUP3* 0.14 0.21 0.20 0.27 0.41 0.29
MPREG* 0.36 0.33 0.36 0.33 0.35 0.37
ILLEG* 0.11 0.08 0.07 0.06 0.06 0.06
OSML(1)* 0.33 0.42 0.35 0.35 0.39 0.36
EIG(1)* 0.38 0.40 0.41 0.35 0.35 0.38
JOBB* 0.88 0.82 0.86 0.85 0.77 0.79
JOBWM -0.02 (0.20) 0.27 (0.49) -0.03 (0.31) 0.25 (0.49) -0.01 (0.23) 0.10(0.44)
N 277 284 285 260 189 248
* Diese Variable ist eine Dummy-Variable
Subintervalle von zwei Monaten, für die ich je eine konstante Rate schätze, und zwar in Abhängigkeit von zeitunabhängigen Kovariablen (Xt), zeitab
hängigen Kovariablen, deren Wert zu Beginn eines jeden Teilintervalls gemessen wird (X2, z. B. Dau
er seit der Geburt des ersten Kindes), und zeitab
hängigen Kovariablen, die sich auch innerhalb der Zwei-Monat-Intervalle noch ändern können (X3, z. B. der Erwerbsstatus). Für die Übergangsrate wird in jedem Teilintervall der Ansatz des Expo- nentialmodells gewählt:
r(tj) = exp(ß1X1 + ß2X2(ti) + ß3X3(t))
= exp (ßjX,) • exp(ß2X2(t;)) • exp(ß3X3(t)), wobei i der Index des i-ten Teilintervalls ist.
Die Abhängigkeit der Übergangsrate zum zweiten Kind vom Alter beim ersten Kind (AGEK1, ge
messen in Monaten) wird durch die Einbeziehung der entsprechenden Altersangabe kontrolliert. Die Abhängigkeit der Rate von der Dauer seit der Geburt des ersten Kindes, die selbst wiederum mit AGEK1 variiert, kontrolliere ich durch die folgen
de Konstruktion. Zu Beginn eines jeden Teilinter
valls messe ich die Dauer seit der Geburt des ersten Kindes (AGE-AGEK1) und die noch ver
bleibende Zeit bis zum Alter 45 (45-AGE). Ich normiere diese Zeitdauern durch die maximal mögliche Dauer von 45-AGEK1 und bezeichne die normierten Größen im folgenden als DURK1 und REST. In die obige Gleichung beziehe ich nun den
Logarithmus von DURK1 und REST mit ein.
log(DURKl) und log(REST) sind damit in dem Kovariablenvektor X2(tj) enthalten. Ihre Koeffi
zienten seien mit ß2i und ß22 bezeichnet. Der zu diesen Kovariablen gehörende Teil in der obigen Gleichung läßt sich nun wie folgt ausdrücken:
exp(log(DURKl) • ß21 + log(REST) • ß22) = DURKlß2lRESTß22.
Mit diesem Ansatz kann ich die Veränderung der Rate nach der Wartezeit in Abhängigkeit vom Alter beim ersten Kind als logistische „Glocken
kurve“ modellieren. ß21 und ß22 bestimmen, ob die Kurve symmetrisch (ß21 = ß22), linkssteil (ß21 <
ß22) oder rechtssteil (ß21 > ß22) ist. Es ist zu erwar
ten, daß sie linkssteil ist.
In der Tabelle 1 sind Mittelwerte und Standardab
weichungen weiterer Kovariablen, gegliedert nach der Kohorte und dem Geschlecht, dokumentiert.
FOCC ist ein sozioökonomischer Status-Score für den Vater der Befragten (Mayer 1977). Er stellt einen Indikator für den sozialen Status der Her
kunftsfamilie dar, der als Kontrollvariable einbe
zogen wird. Den gleichen Status haben FFRM, eine Dummy variable20 *, die angibt, ob der Vater der Befragten Landwirt ist, und die Anzahl der Geschwister (SIBS).
20 Eine Dummy-Variable ist eine Variable, die nur die Werte 0 und 1 annehmen kann.
EDU1 und EDU3 sind dichotome Indikatoren für das Bildungsniveau der Befragten. EDU1 indiziert die Gruppe der Befragten, die höchstens einen Hauptschulabschluß, aber keine berufliche Ausbil
dung haben. EDU3 steht für die obere Bildungs
gruppe der Absolventen der Mittleren Reife mit einer Berufsausbildung und der Abiturienten. Die Referenzkategorie bildet die mittlere Bildungs
gruppe der Hauptschulabsolventen mit einer be
ruflichen Ausbildung und der Realschüler ohne Ausbildung. EDUP3 belegt, ob der Partner oder die Partnerin der oder des Befragten mindestens die Realschule absolviert hat. MPREG zeigt an, ob das erste Kind früher als 8 Monate nach einer etwaigen Eheschließung geboren worden ist, wäh
rend ILLEG die nicht-eheliche Geburt des ersten Kindes indiziert. Zwei Indikatoren zur Wohnre- gion und Wohnsituation werden wiederum als Kontrollvariablen miteinbezogen. OSML (1) gibt an, ob die Befragten bei der Geburt des ersten Kindes auf dem Lande (Dörfer oder Städte mit nicht mehr als 30000 Einwohnern) gelebt haben, und mit EIG (1) wird berücksichtigt, ob sie zu diesem Zeitpunkt in einem Eigenheim gewohnt haben. Die Erwerbstätigkeit (STATJOB) und der sozioökonomische Status (STATOCC) der Befrag
ten sind als zeitabhängige Variablen nicht in Tabel
le 1 dokumentiert. STATJOB ist gleich 1, wenn die Befragte aktuell erwerbstätig ist, und STA
TOCC gibt dann den jeweiligen sozioökonomi- schen Status an. Ist die Befragte nicht erwerbstä
tig, sind beide Variablen gleich 021. Ich bilde somit die Erwerbskarriere der Befragten nach der Ge
burt des ersten Kindes vollständig ab.
Zusätzlich wird berücksichtigt: JOBB als Indikator für die Erwerbstätigkeit vor der Eheschließung und JOB WM als Indikator für Veränderungen des Erwerbsstatus in der Zeit von 9 Monaten vor und 3 Monaten nach der Eheschließung. Sie nehmen bei einer Jobaufgabe den Wert 1 an. Sollte der oder die Befragte in dieser Zeit die Erwerbstätigkeit wiederaufgenommen haben, ist ihr Wert gleich -1 . Sonst ist sie gleich 0. COH2 schließlich be
zeichnet die Kohorte der 1939-1941 Geborenen,
21 Es ist zu fragen, ob diese Setzung wirklich sinnvoll ist.
Dennoch erfolgt sie hier mangels begründeter Alter
nativen. Auf eine Schätzung eines „Schattenstatus“
wurde hier verzichtet. Die Veränderung der Mittel
werte über die Kohorten hin ist davon aber nicht sehr stark berührt, da der Anteil der Individuen, die bis zum betrachteten Zeitpunkt mindestens einmal er
werbstätig waren, etwa gieichbleibend hoch (bei über 90%) war (Huinink 1988b).
und die Variablen AK130 bzw. AK135 sind gleich 0, wenn AGEK1 kleiner als 30 bzw. 35 Jahre ist, im anderen Fall sind sie gleich AGEK1.
4. Ergebnisse
In der Tabelle 2 wird ein Überblick über die Ver
änderungen der Häufigkeiten zweiter und dritter Geburten gegeben22. Von einem rasanten Rück
gang der Geburtenhäufigkeiten beim zweiten Kind kann in unseren Kohorten nach diesen Ergebnis
sen nicht die Rede sein. Die Häufigkeit der Geburt eines dritten Kindes geht im Vergleich dazu deut
lich zurück.
Die Ergebnisse der Modellschätzungen für die Übergangsrate zum zweiten Kind bei Frauen und Männern sind in den Tabellen 3a und 3b dokumen
tiert.
Danach gilt für die beiden älteren Kohorten zu
nächst, daß bei einer Familiengründung nach dem 30. Lebensjahr die Wahrscheinlichkeit für ein zweites Kind abnimmt. Es zeigen sich auch klare sozialstrukturelle Effekte. Kinder von Landwirten haben selbst eher mindestens zwei Nachkommen (FFRM). Bei den Frauen geht die Wahrscheinlich
keit für die Geburt eines zweiten Kindes generell mit dem sozialen Status der Herkunftsfamilie zu
rück (FAOCC). Das Aufwachsen in einer großen Familie hat einen positiven Einfluß auf die Nei
gung zu einem eigenen zweiten Kind (NSIBS).
War der Wohnort zur Zeit der Geburt des ersten Kindes eher auf dem Lande, sind die Übergangsra
ten zum zweiten Kind ebenfalls höher (OSML(l)).
Nur bei den Männern findet man einen signifikant positiven Effekt des Wohneigentums zur Zeit der Geburt des ersten Kindes (EIG (l))23.
Die Ergebnisse für die bislang genannten Indikato
ren können hier nicht theoretisch im einzelnen gewürdigt werden. Sie lassen sich aber durchaus im Sinne des Musters traditioneller Familienbildung und seiner Dominanz interpretieren. Diese Be
hauptung wird gestützt durch eine Reihe ausgewie-
22 Eine Analyse der Geburt des dritten Kindes findet sich in Huinink (1988c).
23 Nur hingewiesen werden kann hier auf die deutlichen Unterschiede der Effekte von OSML(l) und EIG (l) für Männer und Frauen. Die Bruttoeffekte von E IG (l) unterscheiden sich allerdings nicht signifikant.
Die Unterschiede bei OSML(l) spiegeln den Wandel der Bedeutung regional bedingter Benachteiligungen nach dem Krieg wider, der sich für Männer und Frau
en unterschiedlich vollzogen hat (Huinink 1987).
Tabelle 2 Anteile von Männern und Frauen mit zwei bzw. drei Kindern nach der Kohortenzugehörigkeit und dem Alter.
a) Anteil von Frauen und Männern mit einem Kind, die ein zweites Kind bis zum Alter 30 bzw. 40 bekommen haben.
1929-1931 1939-1941 1949-1951
Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen
Alter 30 32.9 50.7 42.1 60.0 40.2 57.3
Alter 40 72.4 76.2 72.3 75.2 61.31 68.81
b) Anteil von Frauen und Männern mit zwei Kindern, die ein drittes Kind bis zum Alter 30 bzw. 40 bekommen haben.
1929-1931 1939-1941 1949-1951
Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen
Alter 30 12.5 16.2 11.9 24.2 11.1 19.6
Alter 40 46.5 46.6 28.6 40.7 17.51 26.11
1 Mittels Survivalanalyse geschätzter Anteil bis Alter 30-32 (Alter bei Interview).
Tabelle 3a Schätzung der Übergangsrate zum zweiten Kind unter Einbeziehung zeitabhängiger Kovariablen, Frauen.
Kohorte 1930/40 Kohorte 1950 Variable Koeffi Standard- Koeffi Standard-
zient abw. zient abw.
Konstante -0.54 0.48 2.03 1.04
COH2 -0.03 0.11
AGEK11 0.11 0.17 -0 .4 4 0.31
AK1301 -0.24** 0.12 0.04 0.54
AK1351 0.26 0.21
FOCC1 -0.20* 0.11 -0.57*** 0.21
FFRM 0.27* 0.15 0.14 0.34
SIBS 0.05** 0.02 -0.007 0.05
EDU1 -0.07 0.13 -0.003 0.21
EDU3 0.24 0.17 1.04*** 0.26
EDUP3 0.16 0.13 -0 .0 6 0.22
MPREG 0.07 0.13 -0.55** 0.23
ILLEG -0.29 0.22 0.28 0.36
OSM1 0.20* 0.12 0.44** 0.17
EIG1 0.06 0.11 0.15 0.17
JOBB -0.12 0.15 0.10 0.23
JOBWM -0.04 0.11 0.31 0.20
STATJOB -0.66*** 0.22 -0.73* 0.38 STATOCC 1 -0.13 0.19 -0.71** 0.32 log(DURKI) 1.23**" 0.13 1.81*** 0.31 log(Rest) 6.16*** 0.59 8.14*** 1.77
Anzahl der Fälle: 543 Anzahl der Fälle: 248
CHI2: 404.82 CHI2: 149.58
Freiheitsgrade: 20 Freiheitsgrade: 18
* signifikant zum Niveau 0.1
** signifikant zum Niveau 0.05
*** signifikant zum Niveau 0.01 1 Parameter mit 100 multipliziert.
Tabelle 3b Schätzung der Übergangsrate zum zweiten Kind unter Einbeziehung zeitabhängiger Kovariablen, Männer.
Kohorte 1930/40 Kohorte 1950 Variable Koeffi Standard- Koeffi Standard-
zient abw. zient abw.
Konstante -2.16 0.43 -1.53 1.46
COH2 0.11 0.10
AGEK11 -0.17 0.19 1.43*** 0.40
AK1301 0.03 0.09 -0.71* 0.39
AK1351 -0.59** 0.23
FOCC1 0.05 0.10 0.01 0.21
FFRM 0.35** 0.15 0.48 0.34
SIBS 0.11*** 0.02 0.07 0.05
EDU1 -0.18 0.13 0.19 0.33
EDU3 0.05 0.16 0.05 0.27
EDUP3 -0.15 0.15 0.46* 0.24
MPREG -0.15 0.13 0.39 0.28
ILLEG 0.38* 0.19 -0.05 0.47
OSML1 0.38*** 0.11 0.15 0.23
EIG1 0.21* 0.11 0.43* 0.22
STATOCC 1 0.02 0.10 0.29 0.19 log(DURKI) 0.95*** 0.11 2.03*** 0.43 log(Rest) 3.65*** 0.39 9.10*** 2.51
Anzahl der Fälle: 561 Anzahl der Fälle: 188
CHI2: 275.39 CHI2: 74.88
Freiheitsgrade: 17 Freiheitsgrade: 15
* signifikant zum Niveau 0.1
** signifikant zum Niveau 0.05
*** signifikant zum Niveau 0.01 1 Parameter mit 100 multipliziert.