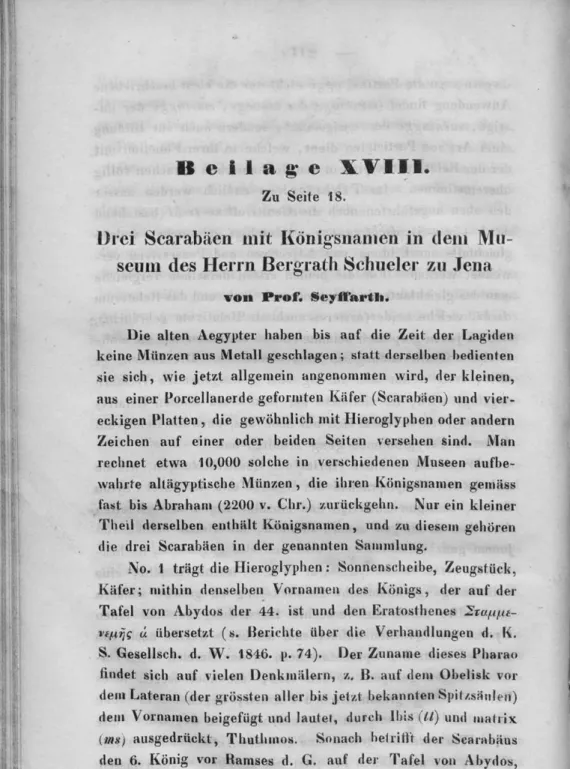Zu Seite 18.
Ueber den Genitiv in den dekhanischen
Sprachen
von Cand. Rost.
Unter der grossen Anzahl der Volkssprachen, die wie
ein bunter Teppich über den vorderindischen Continent und
die demselben zunächst benachbarten Inseln ausgebreitet sind,
verdienen eine besondere Aufmerksamkeit, ein vorzügliches
Interesse diejenigen, die wir unter dem Namen der dekha¬
nischen zu begreifen pflegen. Schon ihr hohes Alter —
sie haben sich ja aus jenen frühen Zeiten bis jetzt erhalten^
wo Indien den mannichfachen Einflüssen der Arier noch nicht
unterlegen war, — lässt uns dieselben mit ganz andern Augen
betrachten als die verhältnissmässig bei weitem jüngern En¬
keltöchter des Sanskrit. Zwar zeigen einzelne der letzteren,
so namentlich das weitverbreitete Hindustani und die Sprache
von Brag-, eine im Ganzen fast reichere und sclbstständigere
Literatur auf, als selbst die gebildetsten der dekhanischen, die
sich überhaupt, wie schon ein Blick in den von Wilson heraus¬
gegebenen Catalog der Mackenzie Collection lehrt, in vielen
Zweigen der Wissenschaft mehr an sanskritische Muster an¬
geschlossen haben, und diesem Umstände darf es wohl haupt¬
sächlich zugeschrieben werden, dass die Beschäftigung gerade
mit diesen Sprachen den meisten deutschen Orientalisten bis
jetzt um so ferner bleiben musste, als besonders die Bekannt¬
machung der ältesten Denkmäler sanskritischer Literatur die
ungetheilten Kräfte der Indologen seit einer Reihe von .lahren
II. Jahrg. 14
mehr denn je in Ansprucii nimnit. Gleichwohl bieten die
dekhanischen iSprachen, von rein linguistischem Standpunkte
aus betrachtet, so viel Eigenthümliches und vom Sanskrit
Grundverschiedenes dar, dass schon deshalb eine Zusammen¬
stellung desselben die Mühe lohnen dürfte. Es würde hier
7,u weit führen , dies auch nur in leichten Umrissen zu ver¬
suchen; darum möge es mir vergönnt sein, nur einen Punct
aus der Lehre von der Declination hervorzuheben und einer
grammalisch - etymologischen Untersuchung zu unterwerfen.
Ich wähle hierzu den Genitiv als denjenigen Casus, der
wohl in allen Sprachen nächst dem Nominativ als der älteste
betrachtet zu werden verdient , wobei ich n»ich leider auf
das Tamil, Telugu, Kar n äta und Singhalesische
beschränken muss, da ich keines der wenigen grammatischen
Hilfsmittel zur Kenntniss des Malay alim bis jetzt habe
habhaft werden können, dasTul uva aber mit dem nur dia-
lectisch davon verschiedenen Co dugu, soviel ich weiss, über¬
haupt noch keiner grammatischen Behandlung unterzogen wor¬
den ist.
Nach den strengen Regeln des Satzbaues, die in allen
dekhanischen Sprachen mit grosser Consequenz befolgt werden,
muss der Genitiv stets dem ihn regierenden Nomen voran¬
stehen. Je nach der Beschaffenheit der Verbindung, die er
so mit diesem eingeht, lassen sich die Genitivbildungen selbst
in drei Classen bringen, bei deren Beschreibung ich das
ausgebildetste Idiom, das Tamil, als massgebend zu Grunde
lege. In Bezug auf die Transscription bemerke ich nur noch,
dass ich für das Tamil, welches für jeden der fünf Vargä's
nur zwei Zeichen hat, nämlich den Classenconsonanten mit
dem dazu gehörigen Nasal, der von Rhenius angegebenen Aus¬
sprache folge und ausserdem den dem sanskritischen Anu¬
svära in vieler Hinsicht entsprechenden Nasal sowie den im
Karnäta und Telugu aufgenommenen Anusvära selbst, hier
Sunna genannt, mit n bezeichne.
I, Die engste Verbindung zweier Nomina wird da¬
durch bewirkt, dass das erstere derselben, welches zu dem
andern als in einem Genitiv- oder Possessivverhältniss stehend
gedacht werden soll, diesem ohne weiteres vorangesetzt wird
und zwar entweder ohne irgend eine Veränderung ausser der,
welche durch die gewöhnlichen, allerdings sehr subtilen Wohl¬
lautsgesetze vorgeschrieben wird, oder so, dass seine Endung
in andrer Weise zur Zusammensetzung mehr geeignet gemacht
wird. So bleiben viele auf einen Vocal (im Telugu beson¬
ders auf a und i) ausgehende Substantiva und im Singhalesi-
schen alle Neutra auf e und viele andre auf a unverändert ;
ebenso kann der zweite Stamm der Pronomina der 1. und
2. Person zugleich in solchen Genitivverbindungen gebraucht
werden , und es bedeutet demnach en (Tel. nu) mein , nam^
engel (poefisch auch em, nangel , Tel. md) unser, «» (poet,
auch nih, nun, Tel. ni) dein, ungel (poet, um, num, Tel. mi)
euer. Endet das erste Wort des Compositum auf einen Vocal,
auf y nder r, und beginnt das zweite mit einem sogenannten
rauhen Buchstaben, {k, f, t, t, p, r), so muss letzterer ver¬
doppelt werden; endet es auf n oder /, so wird es in d,
endet es auf » oder /, so wird es in r verwandelt, in welchen
Fällen die angegebene Verdoppelung unterbleibt. Die Sub¬
stantiva auf du undrw, welche vor dieser Endung entweder eine
lange offene oder mehrere kurze otfene Sylben haben, ver¬
doppeln in solchen Verbindungen im Singular ihr d, und r.
Die meisten Wörter endlich auf am (Tel. n oder mu) ver¬
ändern dies in attu (Tel. apu); andere werfen blos das m
weg. Diese engste Verbindung zweier Nomina mit einander
lässt sich in vieler Beziehung mit dem hebräischen status
constructus, im Ganzen aber und noch passender mit den
sanskritischen Compositis, welcbe Tatpuruscha heissen, so¬
wohl der Form als der Bedeutung nach vergleichen.
II. Eine gewisse Gestalt und Consistenz gewinnt der Geni¬
tiv dadurch, dass ihn eine bestimmte Endung, bestehend
14 *
aus einem Vocal mit folgendem Nasal oder ohne einen solchen,
vom Nominativ unterscheidet. Im Tamil geschieht dies
durch die angehängte Sylbe in, aber nur für den Singular,
da im Plural eine noch bestimmtere Bezeichnungsweise An¬
wendung findet. Auch kann diese Bildungssylbe nur an die
oben beschriebene Form des Nomen angefügt werden, mag
dieselbe nun mit dem Nominativ gleichlauten oder nicht,
wobei aber wiederum das ii den von den Wohllautsregeln
gebotenen Veränderungen unterworfen ist. In der Bedeutung
ist zwischen der zuerst angegebenen und dieser Bezeichnungs¬
weise kein wesentlicher Unterschied, so dass z. B. von idam,
Ort, der Genitiv ebensogut die Form idattu als idatiin
( idattu -j- in) annehmen , von tagadu , Teller , der Genitiv
sowohl tagallu als tagattin lauten kann. Dieselbe Verbindung
beider Bildungsweisen findet auch, nur dass sie hier als Regel
auftritt, im Telugu statt, wo im Genitiv viele Neutra
auf yi in ti, auf ru, du, lu in ti , auf Ilu und nnu in nti
abgewandelt werden. Jenes in dagegen hat sich noch im
Karnäta, freilich mit sehr beschränktem Gebrauch, erhalten.
Es kann nämlich hier bei allen Substantiven, deren Grundform
auf M, ü, ri, o oder au endet, in den Casibus obliquis des
Singular mit Ausnahme des Dativ und Accusativ zwischen
den Stamm und die Casusendung (im Genitiv stets a) nacb
Belieben eingefügt'werden. Vielleicht liesse sich im Telugu
damit aucb die Genitivendung ni vergleichen, welche bei
den Wörtern auf du neben der andern Endung di gewöhnlich
ist. Sonst findet sich;^noch im Karnäta bei einigen Neutris,
deren Stamm auf a ausgeht, vor den Casusendungen des In¬
strum., Abi., Gen. und Loc. ein euphonisches d eingeschoben.
Im Pluralis verwandelt sich das u des Nominativ im Kar¬
näta stets in a, während im Telugu die Endung ru im
Genitiv zu ri wird , die Endung lu dagegen sich in la ab¬
wandelt. Im Singhalesischen bilden die Neutra, die im
Nomin. Plur. val haben, den Genitiv durch ein angesetztes a
mit oder ohne nochmalige Wiederholung der Sylbe val (/.
B. kathäva/, Worte, Gen. kaihävala oder kaihävahala) ; selbst
diejenigen , die den Pluralis durch Verkürzung bilden ( wie
pala, Blatt, Plur. pai), lassen vor den Endungen der Casus
dieses val eintreten, so dass von pala der Gen. Plur. patvala
heisst.
Die beiden bis jetzt beschriebenen Bildungsformen werden
von den tamulischen Grammatikern, den einheimischen sowohl
als den ihnen folgenden europäischen , nicht als Genitiv,
sondern als besonderer Casus obliquus betracbtet, und in, allu
etc. zu den sogenannten Qüriyai d. h. zu den Partikeln ge¬
rechnet, welcbe die Stämme der Nomina und Verba mit den
die Declination und Conjugation bewirkenden Bildungssylben
(den voertumaiyurubugel und viiiaiyurubugel) verbinden. Si^
mochten dies wobl deshalb thun , weil im Taniul überhaupt
sämmtliche Casus obliqui und so auch der Genitiv noch
besonders durch Anhängung bestimmter Partikeln gebildet
werden. Allein wenn auch die Anwendung jener beideuFormen
eine viel engere Verbindung zweier Nomina andeutet, als
die, welcbe wir durch den Genitiv zu bezeichnen pflegen, so
dass auf solche Weise selbst der diesen Sprachen eigne Mangel
an Adjectiven ersetzt wird, so spricht doch gerade eben dieser
Gebrauch, die Verwechselung dieser Formen mit den längeren,
sofort zu beschreibenden und die Analogie der verwandten
Sprachen für die Richtigkeit der angegebenen Classification.
III. An die erste Form, mit angehängtem iü oder ohne
dasselbe (ersterer Fall besonders bei Neutris gebräuchlich),
werden nun sämmtliche C asusp a rtik ein gefügt. Für den
Genitiv gibt es deren zwei, udaiya und adu, welcbe
beide in ihrer Anwendung durchaus nicht verschieden sind.
Ersteres, fast nur in der Sprache des gewöhnlichen Lebens
(dem Kodnudamürl) gebräuchlich, ist eigentlich ein vom Sub-
stantivum udai, Besitz, abgeleitetes Adjectivum, welches so¬
nach besitzend und verwandte Begrifte ausdrückt. Eine
uiigraiiiiuutiüulie Verkürzung desselben isl uda, das sich z. B.
in der sogenannten malabarischen, eigentlich aber vulgär-ta¬
mulischen Uebersetzung des N. T. (Serampore 1813. 8.) durch¬
gängig als Genitivzeichen findet. Ihm entspricht im Telugu
die Partikel yokAa (wahrscheinlich das Zahlwort okka oder
oka, eins, mit verbindendem y), welches, jedoch nur im Singu¬
lar, an den Genitiv angehängt werden kann. Die andere Geni¬
tivpartikel (adu) ist fast nur der Sprache der Dichter (dem
^endamürl) eigen und gibt sich sogleich als das Neutrum Sing,
des Pron. der 3. Person zu erkennen. Wie im Karnäta,
um Possessiva zu bilden , die Pronomina der 3- Person über¬
haupt zum Genitiv gefügt werden statt des Verbum substan-
tivum, und derselbe Gebrauch im Telugu in noch viel aus¬
gedehnterer Weise stattfindet, indem der Genitiv der Pro¬
nomina der 1. und 2. Person neben seinen oben angeführten
kürzeren Formen noch constant die verlängerten {nadu, uüdi,
mein, mädu, mauadu, mädi, manadi, unser, nidu, nidi, dein,
midu, euer, wozu noch tanadu, von länu, selbst), annimmt,
in welchen neben dem gemeinsamen dekhanischen Pronomi¬
nalstamme adu Adi% dem Telugu eigenthümliche erscheint :
so ist im Tamil adu zuuk gewöhnlichen Genitivaffix gewor¬
den. Aus diesem Ursprünge erklärt sich auch die Regel,
welche Pavanandi fiir die Dichtersprache gibt, dass adu (auch
adu) für den Singularis , a fiir den Pluralis die Casusendung
(urubu) sei, d. h. dass, wenn ein im Singular stehendes Nomen
den Genitiv regiere , dieser im Singular und Plural durch
udu, dagegen, wenn er von einem Nomen abhängig sei, das
seiner Form oder seinem Begritl'e nach eine Mehrheit bezeichne,
durch a (eine der poetischen Sprache allein angehörige, selt¬
nere Genitivendung der ersten Form) gebildet werde. Man
wird hierin um so eher eine Analogie zu der sanskritischen,
nur den Stämmen auf a und den Pronom. der 3. Person
eigenen, volleren Genilivbezeichnung sya und dem darin ent¬
haltenen Reiativptunomen yu finden, wenn man bedenkt, dass
den dekhanischen Sprachen die Relativpronomina gän/.lich ab¬
gehen , zu deren Umschreibung meist die sogenannten Reia-
tivparticipia, zuweilen aber auch die Pronomina der 3. Person
verwendet werden. Wenn nun im Singhalesischen die
n»eisten auf einen andern Vocal als e und die auf einen Con¬
sonanten endenden Neutra im Genit. Sing, e ansetzen , (vor
welchem « ausfällt, nach den andern Vocalen aber zur Ver¬
meidung des Hiatus y oder w eingeschoben wird,) dieses e
aber sich ebenfalls als identisch mit dem demonstrativen e
erweist, so möchte man die bei der Declination der Masculina
und Feminina sowohl im Singular als im Plural gebräuchliche Ge¬
nitivpartikel ge fiir den Rest eines für das Singhalesische jetzt
verlorenen Relativstammes zu halten um so eher versucht sein,
als sich auch in andern Sprachen, die der Relativpronomina
ebenfalls ermangeln, solche Ueberbleibsel, wie wir bald sehen
werden, in ähnlichen Verbindungen erhalten haben.
Hierbei kann nicht an die Art und Weise gedacht werden,
wie in den meisten sanskritischen Volkssprachen der Ge¬
nitiv bezeichnet wird, obschon sie auf einem ganz verschie¬
denen Wege fast zu demselben Resultate gelangen. Dort wird
den in den Genitiv zu setzenden Substantiven die sanskri¬
tische Bildungssylbe ka angefügt, welche namentlich im Prakrit
sehr häufig zur Bildung von Adjectiven dient, und so werden
die im Genitiv stehenden Nomina formell zu wirklichen
Adjectiven umgewandelt, die sich in vieler Hinsicht nach
dem sie regierenden Substanlivum richten. Im Hindustani
und Hindi findet sich daher vor dem Nominat. Sing. masc.
die Endung ku (Brag Bhäkä kau, Bandheikband kh\
fem. ki , vor den übrigen Casus und dem Plural ke. In den
Personalpron. der 1. und 2. Person werden auf dieselbe Weise
die Endungen ra, ri, re gebraucht. Am meisten ausgeprägt
ist dieses System im Mahrattischen. Die sanskritische
Endung ka, die übrigens auch hier zur Bildung von Adjectiven
verwendet wird , erscheint daselbst mit dem entsprechenden
Palalaieii , und es gestalten sich die Genitivendungen folgen¬
dermassen (nach Stevenson's Schreibung):
m. tsä, f. chi, n. tse, wennd. regier. Nomen steht im Nom. Sing.,
- Ise, - chd, - cht, — - — — — - Nom. Plur.,
- tse, - chä, - tse, — - — — in einem Cas, obliq.,
wobei sich das Geschlecht natürlich immer auch nur nach
dem des regierenden Substantivs richtet.
Es darf nicht befremden , wenn ich hier einen Blick auf
die mittelasiatischen Sprachen zu werfen mir erlaube,
da dieselben, wenn auch zum grössten Theil nicht auf so
hoher Stufe grammatischer Ausbildung stehend , überhaupt
in ihrer ganzen Construction eine überraschende Aehnlichkeit
mit den dekhanischen darbieten. In ihnen wird nämlich der,
seinem regierenden Nomen gleichfalls stets voranzustellende
Genitiv durch i und « (mit schliessendem Nasal oder ohne
einen solchen) bezeichnet, so dass das Mandschu i, das
Tibetische i und yi, das Mongolische u, ü, un , ün ,
iin aufzeigt. Dies ist jedoch nicht die einzige Bezeichnungs¬
weise. Denn wie im Chinesischen das Relativpronomen
tschi (im Kuan - boä ti) zugleich als Genitivpartikel dient und
. zur Bildung von Possessiven und Adjectiven angewendet wird,
so scheint auch in der türkischen Genitivendung •^-üng
das Relativum enthalten zu sein. Da das nur im Osmanli
übliche Ssaghir-nun in den übrigen Dialecten durch ii>,j (bis¬
weilen auch ) ersetzt wird , so endet der Genitiv z. B.
im Dialecte von Kiptschak iSUi , im Uigurischen und Dschaga-
taischen liS^A^j , d. h. an das gewöhnliche Genitivzeichen in
oder jiin (mit vorgesetztem euphonischen n) ist das Relativum
getreten, dessen volle Form noch in dem unverbundenen Pos¬
sessivpronomen erscheint (z. B. ^'>^*i^ , der meinige). Gleicher¬
weise hat sich auch im Mongolischen nur in diesen Zu¬
sammensetzungen eine Spur des Relativstammes erhalten; hier
ist minu niein, minügei der meinige, tschinu dein , tschinügei
der deinige.O Etwas weiter ist dieser Gebrauch im Man-
dschu, wo die Partikel ngge nichl nur die eben beschriebene
Anwendung findet {miningge der meinige, musingge der un-
srige, sueningge der eurige etc.), sondern auch zur Bildung
einer Art von Participien dient, welche in ihrer Function mit
der der Relativparticipien in den dekhanischen Sprachen völlig
übereinstimmen. Im Tibetischen endlich werden ausser
den oben angeführten noch die Genitivaffixe tschi (bestehend
aus k + y + j), dschi (g -|- y _|- i) und gi gebraucht, welche
gleichfalls zur Bildung von Adjectiven und Possessiven ver¬
wendet werden. Für die beiden ersten derselben vergleiche
man das gleichlautende Fragpronomen tschi und das Relativum
dschi, welche beide (ersteres auch als Relativum gebraucht),
sich zu jenen graphisch beinahe ebenso verhalten wie die mah¬
rattische Genitivendung zur hindustanischen. Die Endung gi
aber, welche nur den auf ng oder g ausgehenden Wörtern
angefügt wird, ist vielleicht der Rest eines andern Relativ¬
stammes, von welchem sich nur noch das, auch als Relativum
dienende Fragpronomen gang erhalten hat.
Wenn ich so einen Abriss der Genitivbildungen, wie sie
sich in den Hauptsprachen des Dekhan und der Insel Ceylon
finden, zusammenzustellen und einzelne Eigenthümlichkeiten
derselben in einigen andern Idiomen, die einem örtlich von
jenem ganz verschiedenen Sprachenkreise angehören, nachzu¬
weisen versucht habe, so war es nicht meine Absicht, eine
vollständige grammatische Entwickelung zu geben, sondern
ich wollte durch die versuchte Darstellung nur auf einen
Cyclus von Sprachen aufmerksam machen, welche noch von
wenigen deutschen Sprachforschern in den Bereich ihrer Un¬
tersuchungen gezogen worden sind , die aber wegen ihres
Reichthums an grammatischen Formen, wegen der in ihnen
herrschenden Genauigkeit des Ausdruckes und wegen der Fülle
ihres Wortvorrathes gewiss eine grössere Aufmerksamkeit ver¬
dienen , als man ihnen bis jetzt hat zu Theil werden lassen.
Zu Seite 18.
Drei Scarabäen mit Königsnamen in dem Mu¬
seum des Herrn ßergratli Schueler zu Jena
von Prof. SeyfTartli.
Die alten Aegypter haben bis aaf die Zeit der Lagiden
keine Münzen aus Metali geschlagen ; statt derselben bedienten
sie sich, wie jetzt allgemein angenommen wird, der kleinen,
aus einer Forcelianerde geformten Käfer (Scarabäen) und vier¬
eckigen Platten, die gewöhnlich mit Hieroglyphen oder andern
Zeichen auf einer oder beiden Seiten versehen sind. Man
recimet etwa 10,000 solche in verschiedenen Museen aufbe¬
wahrte allägyptische Münzen , die ihren Königsnamen gemäss
fast bis Abraham (2200 v. Chr.) zurückgehn. Nur ein kleiner
Theil derselben enthält Königsnamen , und zu diesem gehören
die drei Scarabäen in der genannten Sammlung.
No. 1 trägt die Hieroglyphen : Sonnenscheibe, Zeugstück,
Käfer; mithin denselben Vornamen des Königs, der auf der
Tafel von Abydos der 44. ist und den Eratosthenes 2tafi/.tt-
vffiijs ü übersetzt (s. Berichte über die Verhandlungen d. K.
S. Gesellsch. d. W. 1846. p. 74). Der Zuname dieses Pharao
findet sich auf vielen Denkmälern, z. B. auf dem Obelisk vor
dem Lateran (der grössten aller bis jetzt bekannten Spit/.säulen)
dem Vornamen beigefügt und lautet, durch Ibis (//) und matrix
(ms) ausgedrückt, Thuthmos. Sonach betritfl der Scaiabäus
den 6. König vor Kamses d. G. auf der Tafel von Abydos,
Thuthmoses, den 7. König der XVIII. Dyn. bei Manetho.