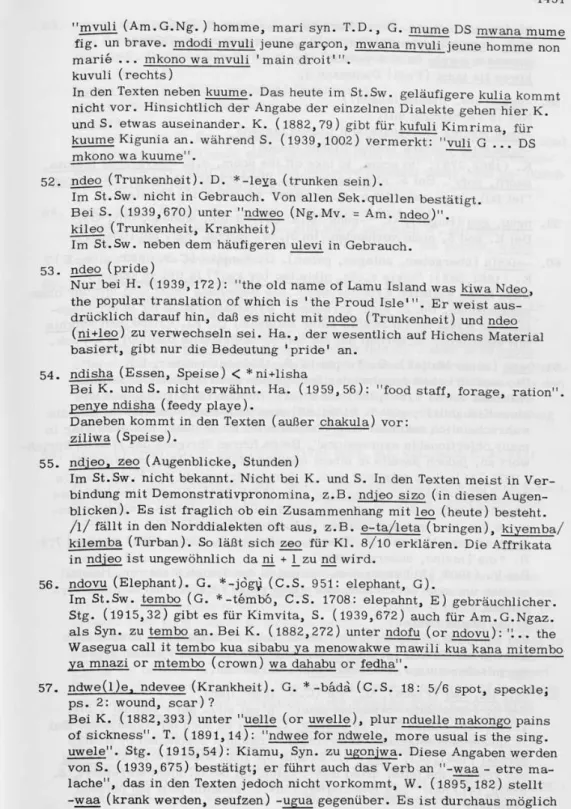BEMERKUNGEN ZUR LEXIK ÄLTERER SWAHILIDICHTUNGEN
Von Gudrun Miehe, Marburg
Das Swahili, das seit langem große Bedeutung als Verkehrssprache in Ost¬
afrika besitzt, ist schon sehr früh dem Einfluß anders strukturierter Sprachen
ausgesetzt gewesen. Dies macht sich vor allem im Bereich der Lexik bemerk¬
bar. Nach einer langen Periode arabischer Einflußnahme, die sogar dazu
führte, daß das Swahili aufgrund des relativ hohen Prozentsatzes von Arabis¬
men als "Mischsprache" (s. Heine 1968,69) bezeichnet wurde, ist heute der
Anteil der aus dem Englischen stammenden Lehnwörter sehr hoch. Uber Lehn¬
wörter, gleich welcher Herkunft, vor allem aber die arabischer, persischer
und englischer, ist relativ viel veröffentlich worden (1).
Die vorliegende Untersuchung möchte demgegenüber auf den Teil der Lexik
des Swahili hinweisen, der heute vor allem durch Arabisierung und Standardi¬
sierung in den Hintergrund getreten ist. Als Grundlage wurden hierfür ver¬
fügbare historische Sprachdokumente, nämlich ältere Swahili-Texte und die
Wörterbücher von Krapf und Sacleux herangezogen.
Die Swahiliforschung befindet sich in der für Afrika seltenen Lage, neben
frühen europäischen Beschreibungen auch afrikanische Quellen zur Verfügung
zu haben, d.h. die arabisch geschriebenen Manuskripte der traditionellen
Swahilidichtung. Die meisten dieser Dichtungen sind in einer Epoche entstan¬
den, in der die Swahilikultur in hoher Blüte stand. Diese wurde in ganz be¬
sonderer Weise vom Islam bestimmt und konnte durch einen einzigartigen
Verschmelzungsprozeß afrikanische, persische und arabische Elemente in
sich vereinigen. Lt. Bertaux (1966, lio/l) berichtet bereits Ibn Batuta, der
1332 in Kilwa weilte, von einer einheimischen Literaturtradition.
Die Entstehungszeit der uns heute erhaltenen Dichtungen ist philologisch
schwer zu bestimmen; außerdem sind die wenigsten Manuskripte datiert.
Fest steht jedoch, daß diese Manuskripte ein wichtiges Zeugnis für die sprach¬
geschichtliche Entwicklung des Swahili darstellen, auch wenn gewisse Ein¬
schränkungen gemacht werden müssen, die darin begründet sind, daß es sich
erstens bei der Sprache der Dichtungen und dem heutigen Standard-Swahili
um verschiedene Dialekte handelt und daß zweitens durch wahrscheinlich zahl¬
reiche Abschreiber der Manuskripte und vorhergegangene lange mündliche
Tradierung vieles "modernisiert" und/oder an den jeweiligen Dialekt ange¬
glichen wurde. Denn das Zentrum der alten Swahilikultur befand sich in ihrer
Blütezeit im Norden des heutigen Swahilisprachgebiets. So sind die meisten
Dichtungen im Kiamu oder im Kimvita verfaßt; häufig kommen auch Formen
und Lexeme beider Dialekte vor. Da die Uberlieferung dieser Dichtungen sich
nicht nur auf ihren Entstehungsort beschränkte, sondern sich auch auf das ge¬
samte Swahilisprachgebiet ausdehnte, finden wir in den uns heute vorliegenden
Texten auch Formen anderer Dialekte. Tatsächlich sind auch in modernen
Dichtungen Lexeme und Syntagmen der traditionellen Literatur zu finden (2). Denn
zumindest innerhalb der nördlichen Gruppe der Swahilidialekte nehmen Kiamu
und Kimvitaeine Elitestellung ein, wobei nach Eastman (l969, 13l) Kiamu als
die Sprache der Literatur und das Kimvita als kosmopolitischer Dialekt sich
gegenseitig respektieren (3).
Die Sprache der älteren Swahilidichtungen unterscheidet sich hinsichtlich
der lexikalischen, phonologischen und morphologischen Gegebenheiten recht
deutlich vom heutigen Standard-Swahili, dessen Grundlage das Kiunguja, ein
südlicher Dialekt, ist. Das Ziel dieser Untersuchung (4) ist es, näher auf
die lexikalischen Unterschiede zwischen beiden einzugehen, um dann anhand
des im Anhang vorgelegten Materials Gruppierungen vorzunehmen, die die
verschiedenen Entwicklungen von Lexemen im Swahili aufzeigen sollen. Da¬
bei wurden jedoch nicht alle Lexeme berücksichtigt. Folgende Kriterien wur¬
den bei der Erstellung des Vokabulars zugrunde gelegt:
1. Es handelt sich nur um Lexeme, die in den von Dammann, Allen und
Knappert transkribierten und übersetzten älteren Swahilidichtungen vorkom¬
men (s. Literaturverzeichnis). Zur Ergänzung wurden auch Arbeiten von
Taylor, Steere, Hichens und Velten herangezogen.
2. Die in den religiösen Dichtungen häufiger als sonst vorkommenden Ara¬
bismen und auch andere Lehnwörter - soweit sie erkennbar waren - wur¬
den nicht brücksichtigt.
3. Nur in den Texten mehrmals belegte Lexeme wurden aufgenommen. In
einigen dennoch angeführten Ausnahmefällen wird jeweils die Quelle genannt.
4. Nicht aufgenommen wurden die Lexeme, die bei Johnson mit gleicher
Bedeutung verzeichnet sind, mit Ausnahme derjenigen, die für die Erläute¬
rung der sprachgeschichtlichen Entwicklung wichtig erschienen.
5. Es fehlen darüberhinaus in dieser Aufstellung alle Beispiele, die sich
nur aufgrund der gesetzmäßigen Lautunterschiede (s) oder aufgrund unter¬
schiedlicher Transkriptionsweisen (6) in ihrem äußeren Erscheinungsbild
vom Standard-Swahili unterscheiden. Darunter fallen etwa: moo/miguu
(Füße), -leua/-chagua (wählen), -isa/-isha (beenden), tw ene/tone (Trop¬
fen ), Jidaa/njaa (Hunger), -anda/-anza (anfangen), muvyele/mzee (Greis),
mbeu/mbegu (Samen), -emea/-lemea (drücken, stoßen), mui/mji (Stadt)
oder nvee/nywele (Haar).
Die einzelnen Lexeme sind alphabetisch geordnet, soweit dies bei der oft
divergierenden Schreibung möglich ist. Es wurde jeweils nachgeprüft, ob
das betreffende Lexem auf einen von Meinhof, Bourquin, Dempwolff oder
Guthrie rekonstruierten Bantuwortstamm zurückgeführt werden kann. Hier
wird Guthrie's Common Bsintu angegeben, andere Autoren nur dann, wenn
sie in ihren Formen stark von Guthrie abweichen. Danach werden die Sekun¬
därquellen angegeben und mögliche Etymologien erörtert. Zum Schluß eines
Artikels sind alle in den bearbeiteten Texten vorhandenen Ableitungen, Zusam¬
mensetzungen und in der Bedeutung verwandte Wörter aufgeführt.
Aus dem vorliegenden Material können nun die folgenden Gruppen gebildet
werden, die Veränderungen in der Lexik des Swahili im Laufe seiner sprach¬
historischen Entwicklung charakterisieren.
1. In der ersten Gruppe sind Beispiele aus der Dichtung Belegen des Stan¬
dard-Swahili gegenübergestellt, die auf unterschiedliche Bantuwortstämme
zurückgehen. Dabei ist auffällig, daß die Lexeme des Standard-Swahili im
allgemeinen auf die für den östlichen Bantubereich rekonstruierten Wortstäm¬
me zurückgehen, während die Beispiele aus der Dichtung hauptsächlich im ge¬
samten Bantusprachbereich verbreitet sind. Es handelt sich um folgende Wörter
Nr. 15. chanda/kidole (Finger), Nr. 46 muji/mchana (Tag), Nr. 47 mutima/
moyo (Herz). Nr. 56 ndovu/tembo (Elepiiant), Nr. 62 -nwa/-nywa (trinken).
Nr. 65 nyuni/ndege (Vogel). Nr. 73 (u) tandu/tawi (Zweig), Nr. 14 -cha/
-ogopa ( fürchten ).
2. Die zweite Gruppe enthält eine Reihe von Lexemen, die in der Dichtung
vorkommen und auf Bantuwortstämme zurückgeführt werden können, die im
heutigen Standard-Swahili aber nicht oder nicht mehr gebräuchlich sind. Hier¬
zu gehört Nr. 2 -ama (saugen), das von Slavikowa/Bryan (1973) nur in der
intensiven Form -amwa (entsprechend auch bei Guthrie unter C.S. 1908 a
*-yämu-) angegeben ist. Dieses Verb wird übrigens häufig mit dem infiniti¬
vischen ku- konstruiert, eine Erscheinung, die in den Texten häufiger als im
Standard-Swahili zutage tritt. Ferner gehört hierzu Nr. 6 -angata (tragen,
transportieren, unterstützen). Nr. 7 -angupa -(beeilen) ist in den Texten meist
in der Perfektform angupe/wangupe (er/sie beeilten sich) zu finden. Diese
Form ist von den Bearbeitern der Swahili-Manuskripte wohl erst relativ spät
erkannt worden (mdl. Information von E. Dammann). Ebenso gehören hier¬
her Nr. 8 -atu a (spalten) als Syn. zu -pasua . wie auch Nr. 9 -awa (wegge¬
hen, aufbrechen), für das sich nur bei Dempwolff ein Bantustamm findet. Es
wird von allen Sekundärquellen als Syn. zu -toka angegeben. Nr. 58 nguu
(Hügel) wird weder bei Krapf noch bei Sacleux angeführt, ist aber bei Slavi¬
kowa/Bryan für das Kimvita angegeben. Dagegen ist Nr. 59 -nikhia (überge¬
ben, geben, anlegen von Kleidung) weder bei Guthrie, noch bei Slavikowa/
Bryan verzeichnet. Wir können es jedoch mit ziemlicher Sicherheit auf den
von Guthrie angegebenen Bantustamm zurückführen, da im Swahili häufig aus¬
gefallener Nasal durch die sogenannte 'Ersatzaspiration' deutlich wird.
Bestes Beispiel hierfür sind die Substantive der Kl. 9/lO, die mit einem sti.
Konsonanten anlauten. - Nr. 64 nyota (Durst) kommt in den Texten nur in
der Verbindung nyota na njjaa (Tag des Durstes und des Hungers, d.h. Tag
der Auferstehung) vor. Krapf bringt auch andere Beispiele, die auf einen all¬
gemeineren Gebrauch schließen lassen. - Nr. 69 pamwe (zusammen mit)
zeigt, daß dieser weit verbreitete Zahlwortstamm im Swahili offenbar früher
noch verbreiteter war. Im Standard-Swahili kennt man nur kamwe, das wenig¬
stens nach den Bemerkungen von Taylor nicht immer auf den Gebrauch in ne¬
gierten Sätzen beschränkt gewesen ist. - Nr. 70 - pulia (hören) findet sich
im Standard-Swahili als -pulika recht selten. - Für Nr. 71 -ta (schlagen),
das bei Sacleux als Syn. zu -piga angegeben ist, konnte ich keine Entsprechung
bei Meinhof, Bourquin oder Guthrie finden. - Als letztes Beispiel für diese
Gruppe sei Nr. 76 -_ti (sprechen) erwähnt. Krapf und Sacleux kennen es nicht.
In den Texten kommt es nur in dem von Knappert edierten Chuo cha Herkai vor.
3. Zur dritten Gruppe gehören diejenigen Lexeme, die im Standard-Swahili
durch Arabismen ersetzt sind, bzw. heute nur noch selten oder mit einge¬
schränkter Bedeutung gebraucht werden. Folgende Beispiele lassen sich an¬
führen :
Nr. 17 -etea (loben) für -sifu , Nr. 16 chuo (Buch) für kitabu, Nr. 18 - ege -
ma (sich nähern) für - karibia , Nr. 31 kikwi (tausend) für alfu , Nr. 33 kin-
gano (Erzählung) für hadithi . Nr. 34 kinyezi (Traurigkeit) für huzuni . Nr.
43 mazi (Blut) für damu . Nr. 61 nsi (Fisch) für sam aki , Nr. 86 utuku (Markt)
für soko und Nr. 91 -wanga (zählen) für hesabu .
4. In einer vierten Gruppe können wir jene Lexeme zusammenfassen, die
a) von der Form, b) von dem Inhalt oder c) von der Funktion her als die ur-
sprünglicheren erscheinen. Hier wären zu nennen: Für a) Nr. 1 -amba (sagen)
das im Standard-Swahili nur noch in der applikativen Form -ambia oder "er¬
starrt" als Konjunktion kwamba oder in der Relativkonstruktion ambaye etc.
gebraucht wird. - Nr. 41 -litja (lassen) ist im Standard-Swahili nur noch als
Konjunktion ( licha ya 'nicht nur' ) in Gebrauch. - In diese Gruppe gehört auch
Nr. 42 -mala (beenden). Durch die in den Texten zahlreich vorkommenden
Belege läßt sich lückenlos die Entwicklung des Verbs -mala zu dem Formans
- me - für die Perfektbildung im Standard-Swahili nachweisen. Unter b) wären
Nr. 4 -andika und Nr. 51 mvuli zu nennen, -andika ist hier mit der Grundbe¬
deutung 'richten auf angegeben. Es ist nicht auszuschließen, daß hier eine
ähnliche Bedeutungserweiterung wie bei Nr. 66 -oa (schreiben) vorliegt, in¬
dem ' etwas ausrichten, ziehen', 'schreiben' bedeutet. Für mvuli finden wir
die Bedeutung 'Mann, verheirateter Mann' . Im Standard-Swahili ist nur noch
die diminutive Form mvulana in Gebrauch. Für c) gibt es zwei Beispiele. Der
Stamm -Ju (Nr. 23) 'tot' wird sowohl als Substantiv als auch als Adjektiv ge¬
braucht. Das gleiche gilt für Nr. 78 -toto . das auch als Adjektiv mit der Be¬
deutung 'klein' vorkommt. Beide Beispiele sind im Standard-Swahili nur als
Substantiv in Gebrauch - oder, um mit den Termini von Guthrie zu sprechen
als ' independent' und nicht auch al s 'dependent nouns' .
Schlußbemerkung
1. Die Beschäftigung mit der älteren Swahili-Dichtung erbringt eine große
Anzahl nachweislischer Bantuwortstämme für das Swahili. Einige der hier
aufgeführten Wortstämme sind weder von Meinhof, Bourquin, Dempwolff oder
Guthrie bei ihren Rekonstruktionen berücksichtigt worden. Ihre Analyse und
Rekonstruktion kann deshalb weiter Aufschlüsse für die Stellung des Swahili
innerhalb der Bantusprachen erbringen.
2. Es zeigt sich weiter, daß die Arabisierung des Swahili in verhältnis¬
mäßig rezenter Zeit weiter fortgeschritten sein muß, da in den Texten oft noch
Bantu-Wortgut verwendet wird, an dessen Stelle heute Arabismen gebräuchlich
sind.
3. Für das Verhältnis der nördlichen und südlichen Dialekte ergibt sich, daß
diese sich schon auf einer frühen sprachhistorischen Stufe getrennt haben müs¬
sen, wie besonders die unterschiedliche Verwendung allgemeiner und östlicher
Bantuwortstämme in den beiden Dialektgruppen zeigt. Diese Erkenntnis deckt
sich auch mit den Ergebnissen, die eine Beschäftigung mit der Phonologie und
Morphologie der alten Texte erbracht hat.
Anhang Abkürzungen:
Am. ki-Amu H. Hichens
B. Bourquin H. ki-Hadimu
C.S. Comparative Serie Ha. Harries
D. Dempwolff J. Johnson
D.S. Dialectes du Sud K. Krapf
Dy. ki-Dyomvu M. Meinhof
G. Guthrie Mr. ki-Mrima
G. ki-Gunya Mv. ki-Mvita
Ng. ki-Ngozi Ngaz. ki-Ngazija
Ngw. ki-Ngwana
Nz. ki-Nzwani
P. ki-Pemba
S. Sacleux
S./B. Slavikova/Bryan
St. Steere
Stg.
Syn.
TD T.
V.
W.
Z.
Sti gand Synonym tous dialectes Taylor Velten Würtz ki-Ungu ja
1. - amba (sagen). G. * -yämb- (C.S. 1912 u. 1913: speak, slander; C.S.
770: speak, G. )
Im St.Sw. micht mehr als Grundform, sondern nur als Applikativum oder
"erstarrt" als Konjunktion und in der Relativkonstruktion in Gebrauch. Von
K. (1882,9) nur in der folg. Bedeutung notiert: "to speak (in a bad sense).
In Kinika this verb is used both in a good and a bad sense". In den Texten,
wie auch von S. bestätigt, selten mit pejorativer Bedeutung. Es bleibt unge¬
klärt, welche Bedeutung ursprünglich war. G. vermutet einen gemeinsa¬
men Stamm, dessen Bedeutung sich durch "mutation" verändert hätte.
mwamba wasuvaa (verrückter Zauberer).
Ha. (1958, 50) führt auch mwamba "a speaker" und wambo "speech" an.
2. -ama (saugen). G.*-yam- (C.S. 1908:suck; G. ).
K. (1882,8): "to lie on the breast", von S. (1939,62) nur -amwa ange¬
geben. Bei W. ( 1895, 174) unter -kwama (saugen). Wie in den Texten öf¬
ters zu beobachten war, ist heute der Gebrauch des infinitivischen ku- vor
vokalisch anlautenden Verbstämmen restriktiv. In den älteren Dokumenten
finden sich auch bei anderen vok. ani. Verbstämmen ku-, z.B. -awa,
-ima, -ona etc. , wie überhaupt das ku- in Verbformen zu finden ist, in de¬
nen es heute nicht vorkommt, vor allem in Relativkonstruktionen, z.B.
wasipokuyuwa (ohne daß sie davon etwas wußte). Vgl. dazu auch W. (1895,
174 ) koka backen, kowa (baden ).
3. - amku( w)a. - mukua . -kua (sagen, rufen, sprechen).
K. ( 1882, 10): " -amkia . .. Mr. Ehrhardt has (besides amkia ) the word
amküa which he takes in the sense 1. to visit, to great, 2. to call". Von
S. und Stg. ist - amkua als Syn. zu -ita angegeben. In den Texten treten
auch die beiden anderen Formen auf, wobei sehr oft nicht klar ist, ob /mu/
stammhaft oder Obj. pron. der 3.P.Sg. ist. Ha. (1959,78) geht sogar
noch weiter, indem er unter -wa ausführt: "call, call in warning", akamwa
tumwa Rasuli Ali kamwamkua Ali called the Prophet and arouse him".
4. -andika (richten auf). G. nur*-yändik- (C,S. 1932: write: E).
Die Grundbed. bei J. (1939),14): "set in order, write, register, draw"
stimmen mit K. und S. überein. Es scheint hier eine Parallele zu -o(w)a
(s. Nr. 66) bezüglich der Bedeutungserweiterung vorzuliegen. Neben der
Bedeutung "schreiben" kommen in den Texten darüber hinaus vor:
- (w ) andika maozi (Augen auf etwas richten)
-(y) andikia (richten auf)
Gleitvokale treten häufig auf bei vok.ani. Stämmen und zwischen zwei Vo¬
kalen. Bemerkenswert ist, daß G. nur die Bedeutung "schreiben" ver¬
zeichnet hat.
5. -andua ( aufstehen, sich entfernen) .
Alle Beispiele nur aus Knappert 4. Von K. nicht erwähnt, vgl. S. (1939,
65): "- andulia (G.) fondre sur, assaillir".
- anduka (aufstehen).
-(y)/(w) angata (tragen, transportieren, unterstützen). G. *-yangat-
(C.S. 1937: carry in arms; E).
Von K. nicht erwähnt, S. (1939, 67): "(Mv.Am.) tenir ( sika ) ou porter
(- tukua ) dans les mains ou sur les bras". Knappert nennt als Syn. - beba ,
S. -chukua. Ha. (1958, 51) gibt die Grundform - anganga "grasp in the
band, in order to examine" und - angasa "restrain by holding with the hand", - angatia (tragen)
- angasa (tragen)
Unklar ist, ob die folgenden Beispiele hier auch eingeordnet werden kön¬
nen: - ngata sauti, - ngata ulimi (Stimme erheben), die weder bei K. noch
bei S. zu finden sind.
7. -(w) angupa (beeilen). G. *-yäijgup- (C.S. 1939: be quick; E), *-yängü
(C.S. 1938: speed, quickness; E).
Von K. nicht erwähnt, S. (1939,68): " (Am . ancien, Ng. ). v. defectif us.
seulement ä 1' imperatif ordinaire affirmatif et au subjonctif indefini af¬
firmatif." In den Texten meist im Perfekt: wangupe (sie beeilten sich,
seltener im Subj. ), oft in der Funktion eines modalen Hilfsverbs. Wahr¬
scheinlich gehört hierher auch Ha. (1958,60) - ongope n.6, only in ma-,
hasty speech, reckless words, e.g. falsehood, fiction, exaggeration.
wangufu. wengufu (Schnelligkeit).
kwan gusa (eiligst).
8. -atua (spalten). G. * -yät- (CS. 1946: split; G).
Bei K. und S. ("Am. ancien") als Syn. zu - pasua . Ha. (1958, 52) ver¬
merkt darüber hinaus: "usually with reflexive kuiatua 'to destroy oneself .
kuiatua moyo 'to break one's heart' ." Ovir (1896,260) führt als Grund¬
verb für -atua -ata (-acha) "schneiden" an. Dies dürfte wohl nicht mög¬
lich sein, da es sich hier um ein retroflexes ("cerebrales") /t/ handelt;
das interdentale /t/ der Norddialekte entspricht der Affrikata /ch/ im
Süden .
9. - aua ( to see after ).
Bei T. (1891,97) das einzige Beispiel: "ndaulia = niaulia to see after, see
how a work is going on". Von K. und S. bestätigt als Syn. zu - kagua . Zu
unterscheiden von:
10. - aua (herunterschälen).
Von K. nicht erwähnt, S. (1939,76): "... 5. (Am.) peier, epluder, en-
lever la peau d'un fruit ou d'un tubercule; ecosser".
11. -( y) awa (weggehen, aufbrechen). D. * -lava (herauskommen).
Von K., S. und T. als Syn. zu -toka angegeben. Als Herkunft gilt überein¬
stimmend Kimrima (Ovir, K. ), S. gibt darüber hinaus noch "ancien H.,
P." an. K. und S. führen auch -lawa an, das in den bearbeiteten Texten
aber nicht vorkommt.
uawa wapi "waar komt gij vandaan" Knappert 4.
12. bangu (tüchtig).
Bei K. und S. nicht vorhanden. Knappert (1969) gibt als Bedeutung an:
"valiant, courageous, outstanding, superior". Es findet sich bei T. nur
beiläufig in einer Anmerkung: " mwanzi war ( = bangu , old - and vita)
ordinary Swahili because of the myanzi bamboos, serving formerly as
drums or trumpets to call to war" ( 1891,35). Bei H. (1939,157): " bangu -
'war'i note the following: - gharimia b. 'search all over the place';
shamiri b. ' make war' . - teza b. ' act in manner to precipitate war' ,
- liwa b. ' be utterly deceived' ".
13. bombwe/ma- (Wurm).
Bei K. nicht vorhanden, S. (1939,112) sieht es als typisch für Kiamu an,
während Ha. (1958, 157) für dort spezifiziert: "used in Kiamu for cree¬
ping insects in general". Stg. (1915, 52): " bombwe = funza , jongoo in Kimvita". W. (1895, 17l): " bombe - Made ( funza. change )".
14. -cha (fürchten). G. * -tiy- (C.S. 1742: fear; E).
Nach J. heute meist bei Gottesfurcht gebraucht, diese Einschränkung ist
bei K. nicht angegeben. S. (1939, 124): "craindre, surtout eprouver
envers qqn. une crainte respecteuse ... ce verbe est surtout us dans
DN". Bei W. (1895, 17l) Syn. zu - ogopa . Die o. erwähnte Einschränkung
hinsichtlich des Gebrauchs ist in der Texten nicht erkennbar.
kitlo (W. kicho ) (Furcht) t.ianga (Angst, Furcht) asikanga (furchtlos).
15. chanda/vy - (Finger). G. *-yädä (C.S. 1893: finger; E)?
Bei K. ohne Angabe des Dialektes in verschiedenen Zusammensetzungen.
Von V., Stg., H. und W. als Syn. zu kidole angegeben, wobei S. die
Dialekte "Mv, Am., G." nennt, während es Stg. nur als Syn. des Kiamu
für kidole (Kimvita) anführt.
16. chuo/vy - (Buch).
Heute vor allem für Schule (Hochschule - chuo kikuu ) gebraucht, in der
Bedeutung "Buch" weitgehend durch das aus dem Arab, stammende kitabu
ersetzt. Von K., W. und S. bestätigt. K. versucht eine Etymologie (l882,
42): "... from ku-chua or jua to know".
17. - ele a (rühmen, reden).
Bei K. nicht vorhanden. S. (1939,208): "Am., Ng. louer qqn. Syn. -sifu" .
18. - egema (auf iemd. zugehen, sich nähern, herantreten).
K. (1882, 57): " = ku-m-karibia , to go near one". Allen (1971,492):
"1. come near 2. rely upon. The first meaning is commoner". Bel
J . (1939,80): unter - egama , auch -egema mit der von Allen an zweiter
Stelle genannten Bedeutung. Besser ist - wie bei S. (1939,199-200) -
eine Trennung der beiden Verben, die etymologisch wahrscheinlich nicht
auf einen Stamm zurückzuführen sind.
19. -(w)/(y) enga (schauen, sehen, inspizieren, besuchen). G. *-där)g-
(C.S. 501: lool, loci at; E) ?
Bei K. nicht vorhanden. Bei S. (1939,206): "- enga (Am.Ng.=G. - enga
ou wenga ) regarder" (-angalia kwa mato )". H. (1939, 159): "-enga -
behold (usually from a distance), fig.: picture mentally, cp. - lenga
take aims". Ha. (l958,58) fügt diesem Wortlaut hinzu: "- engo (cl.3)
- an echo". Vgl. auch Stg. (1915,55): "- zengea Kiamu = -tafuta, -an¬
galia (Kimrima)".
maninga (Augen)
manenga (Augen) .
Bei K. nicht vorhanden. Dazu S. (1939,684): " ninga (Ng.Am. et G. arch.)
ma - oeil, dans les expressions consarcrees suivantes: - vua man , ouvrir
les yeux, -inua man, lever les yeux pour voir". In den Texten wird es
ohne Unterscheidung neben macho und maozi gebraucht,
- tupiza maninga (lool at) Allen 5
20. fumo (Speer, Häuptling, König). G. *-tym6 (C.S. 1867: spear; E).
K. (1882,75): "(l) a flat-bladed spear; ku-m-piga or toma fumo . to
lance one; (2) a chief (Kingozi and Kiniassa)" . S. (1939, 23l) bringt
auch beide Bedeutungen und führt zum Zusammenhang aus: "chef (celui
qui a droit de porter la lance de chef) de village. Am.G. - titre conserve
par les descedant des ancien chefs de Pate". Ha. (1958,59) meint, daß
der Titel eine breitere Anwendung gefunden hatte: "a spearlord, a chief¬
tain, a title anciently applied to Swahili rulers of Pate, Shagha and other
early settlements and later intermittently revived for collateral Nabahan
rulers". In Knappert 4 auch fumunga , fumungwa , ( -ngwa - heute nicht
mehr gebräuchliches indef. Possessivsuffix). Bekannt ist dieses Lexem
vor allem durch die Dichtungen über Fumo Liongo.
- fuma nyama (jagen) wird von Stg. (1915,52) als Syn. zu -winda (Kimvita)
angegeben. K. (1882,73): "to shoot or to hit one".
G. *-tvim- C.S. 1866 stab; E or N).
21. siku fungate (Woche).
Bei K. (1882,77) neben fungate mmoja "one Week or period of seven
days" noch folgende spezifizierte Bedeutung: a period of seven days, du¬
ring which the bride's father sends a daily portion of food to the newly
married couple, after the completion of wedding. During the second week
the bridegroom's father provides the food, this is calles fungate kua mume ".
Bei S. (1939,235) fungate als archaisches Swahili und Syn. zu saba , ma-
fungate - Woche. (Vgl. zu diesem Zahlwort Meeussen (l969, 17); er ver¬
sucht, eine Verbindung zwischen der Bedeutung "sieben" und "zeigen",
"Zeigefinger" herzustellen).
22 -fuma (herauskommen). G. *-pym- (C.S. 1622: come or go out or away,
G).
Bei K. nicht vorhanden. Von S. (1939,229) bestätigt: "(Am.G.) se re-
tirer (mer), litt, sortir.
23. -fu_(tot). G. *-ky (C.S. 1247/48: dead person, death; G).
In den Texten als Adjektiv und als Substantiv gebraucht. K. (1882, 70):
';fu adj.. niama fu 'a dead animal'", ufu^'death' (S. 94)".T. (1891,
50): "maji mafu na mvuvi kafu the water is dead and the fisherman is
good as dead (kafu may mean a little dead thing)". S. (1939,225) hat
zwei Eintragungen: 1. " kafu , il est mort, en reponse a qqn qui demande
des nouvelles d'une persons mort depuis longtemps". 2. "mort-e, l'em¬
ploi est assez generalement limite aux expressions suivantes: wafu les
morts, les defunts ...".
24. - ima (stehen, aufstehen, erheben). G. *-yim- (C.S. 2006: stand; G).
D. yima = jriama (Stehen) zu ria (gehen).
K. (1882,107): "(old language) = ku-sim am a stand up, to rise to stand
erect". S. (1939,229) neben dem von K. aufgeführten Bedeutungen auch:
"s'arreter, stopper". Diese letzte Bedeutungsvariante wird von H. (1939,
160) wiederholt: "stand still, make an end of movement, halt, used of
inanimate objects as "to stop", "toend", in the form kima kwakwe 'its ending'". Eine Seite weiter steht bei H. jedoch: "kima < ma old Sw.,
'end, finish, stop', Mod.Sw. maliza." Ha. (1958,68) führt kima als
Subst. der Kl. 9 an: "end, completion ...". Auch in den Texten kommt
häufig kema ( < kaima) vor.
-imia (vor jmd. stehen)
- yisima (sich aufrichten) M. *-tima, eine Kurzform des in St.Sw. üb¬
lichen - simama
Allen (5, 1972) erwähnt die folgende Form: kimu/kumu - simama .
25. -isi^ (wissen, verstehen).
Dieses Verb, das auch in den Texten nur in Verbindung mit negierten
Subj.pron. im Präsens auftritt, wird allgemein als Negationsform von
- jua bezeichnet, z.B. T. (1891, 6l): " haisi : ku-isi = kujua , cp. the Chaga i-ichi (to know)"; S. (1939,305): "indicatif present neg. irre-
gulier du verbe Am. - yua et G. -yiva ou zyiya ... c' est un doublet du
temps regulier Am. -yui " . Bei K. nicht angegeben. - Da einerseits /s/
im Sw. nach den bisher bekannten Lautgesetzen nur auf *t+i oder in
Einzelfällen auf *c+5 oder *p+j(a) zurückgehen kann und das Negations-
sufix -i andererseits keine Palatalisationserscheinungen hervorruft, ist
es kaum möglich -isi auf - yua ( - jua ) zurückzuführen. Äußerst fragwür¬
dig ist es auch, aufgrund der oben erwähnten Lautgesetze, dieses Verb
auf eine der folgenden Bantuformen zurückführen zu wollen: G. *-yfjib-,
-yiji-j jiib- (know), D. *-ijri = jiva (wissen).
26. iyoni (Abend, letzte Nacht ). G. * -godo (C.S. 841/42: evening, E; ye¬
sterday; W,N) ?
jio (Abend)
Heute nur in der Form jioni (Abend) in Gebrauch. Auf eine mögliche
Etymologie weist K. (1882, 118) hin: "jio the coming ... la u-siku or
kijio cha usiku ". S. (1939, 189): " dyio la usiku la tombee de la nuit".
iyoni ist auch bei W. (1895, 172) erwähnt.
27. - ita mato (Augen erheben).
Bei K. und S. unter -ita in dieser Zusammensetzung nicht erwähnt.
Allen (3, 1972) führt an: " waketa mato = wakitazama" .
28. kanwa s. -nwa .
29. katu (vollständig).
Bei K. und S. nicht vorhanden. Knappert (1972, 186): "absolutely, at
all (with negative)". Wahrscheinlich handeät es sich um das Präf. der
Kl. 12 ka- und einen Stamm -_tu, dessen Etymologie unklar ist.
30. keleti s. tiati.
31. kikwi/zi - (tausend).
Die Zahl 'tausend' wird heute im St.Sw. nur durch das arabische Lehn¬
wort elfu wiedergegeben. K. (1882, 145): "kikui (pl. vikui), a thousand,
ten thousand (chiefly used in poetry). The pl. zikui for vikui is obsolete."
S. (1939,374): "(Ngaz. 2 siwi ). nombre incalculable, incommensurable,
infinite; le plus grand nombre connu, d'oü millier, myriade, legion."
W. (1895,173) gibt nur 'tausend' an, während Ha. (l958,73) darüber¬
hinaus anführt: "a horde, a host, an army".
32. kimondo/zi - (Meteor, Sternschnuppe). D. * -tondo (Stern. Morgen¬
stern) ?
In keiner Sekundärquelle erwähnt.
33. ngano, kingano (Erzählung). G. * -gänö (C.S. 776: tale, G).
Bei K. und S. Syn. zu hadithi . S. führt auch das Verb - gana an, das in
den Texten jedoch nicht vorkommt.
34. kinyezi (Traurigkeit).
Bei K. nicht vorhanden, bei S. in Verbindung mit -wa (sein): "etre triste".
Ha. (1959, 59): "the loneliness of grief or apprehension" . Die Etymologie ist unklar.
35. kitambo (einst) G. *-tämb- (CS. 1657: walk, travel; G)?
nda kitambo (von früher)
Im St. Sw. allgemeiner, sowie bei K. (1882,158) "space of time, from
ku-tamba = tembea". Auch S. führt es darauf zurück. Bei W. (1895, 174)
mit der Bedeutung 'ehemals' als Syn. zu zamani .
36. ki(l)ungu/zi- (Palast, Stockwerk, Mauer). G. *-düi)g (CS. 711: be¬
come right, straight, E) ?
Bei K. nicht vorhanden. S. (1939,418): "Am. maison tres elevee (a plus
d'un etage, allant vers le 'ciel' ), gratteciel", führt es auf uwingu (Him¬
mel) zurück. Es wäre aber auch möglich, den oben erwähnten Bantustamm
mit in die etymologischen Erörterungen einzubeziehen.
37. kondo (Kampf, Krieg). G. *-k6nd6(C.S. 1147: war, E).
Im St.Sw. Vita. Bei K. und S. vorhanden, letzterer gibt für Kiamu noch
uwani (s. -wana ) an.
38. kungu/ma- (Nacht). G. *-küi)gü (C.S. 1230: 9 dust, 11 fog; E).
Die von G. angegebenen Bedeutungen bestätigen K. und S. und auch J. für
ukungu . K. (1882,401): " ukungu - aurora, morning". In den Texten kommt
dieser Stamm nur in KI. 5/6 in der angegebenen Bedeutung vor. Vielleicht
handelt es sich um besonders dichten Morgennebel, der noch wie Nacht
empfunden wird.
nyota ya makungu (Morgenstern).
39. - kupa (energisch fragen).
In keiner Sek.quelle erwähnt.
ikupia sich selbst verantworten
- (i) kupiza (sich in schlechten Ruf bringen)
Bei K. nicht vorhanden. S. (1939,454) vermerkt es nur für Kiamu, ver¬
weist auf - chukiza .
40. ku(w)e (Ferne). G. * -de (C.S. 507: long, G).
Bei K. nicht vorhanden. T. (1891,86): " kule . kuwe old poetic form for mbali ". Von S. so bestätigt. Ha. (1958,74): "deep, long, great (of length, space or time)".
kaye (ewig) mae (Länge).
41. - lit.ia (lassen)
Im St.Sw. nur noch als Konj. und Präp. in Gebrauch. J (1939,245):
"not only ... but more than, used when the act being used for the pupose
of comparison, contrast ...". K. (1882, 187): " ku-m-licha to allow one".
S. (1939,472): "liga (P.Ng. ) syn. de -likazi ". Er führt das Verb auf - leka bzw. - eka mit der Bedeutung "laisser, lächer" in den Dialekten Mv.P.Ngw. zurück. T. (1891,22): "Ilchi cp. Nyika kuri cha to leave".
42. -mala (beenden). G. *-mad-(C.S. 1281: finish, G).
Im St.Sw. nur noch in der kausativen Form - maliza und als erstarrtes
Formans -me- für die Perfektbildung in Gebrauch. Durch die in den be¬
arbeiteten Texten zahlreich vorhandenen Belege läßt sich lückenlos die
Entwicklung von dem Vollverb -mala zu dem Formans -me- nachweisen.
Bei K. (1882,766) "ma - to be full" und S. 199 "malisika - to be com¬
pleted; kasi leo inamalisika the work (that part which was hitherto left
undone) will be completed today" und "maliza (Kin. margisa ) to finish,
to complete the remainder". K. führt diese Form, wie auch -ma irrtüm¬
lich auf das Arab, mala' a 'implevit' zurück. S. führt es für Kingozi an.
43. mazi (Blut). G. * -gädj, -yädj (C.S. 766, 1897: blood, E).
Im St.Sw. findet sich nur das aus dem Arab, stammende damu. Bei K.
nicht aufgeführt. S. (1939,645) gibt mwazi für Ngaz. 2 an.
44. mfuma juma (Sonnabend).
Im St.Sw. dafür jumamosi in Gebrauch (-mosi, Ordinalzahl für 'eins'
ist nur noch in Zusammensetzungen erhalten). Bei K. nicht vorhanden.
Stg. und S. geben es übereinstimmend nur für Kiamu an. S. (1939, 547)
führt es auf -fuma (s.o. ) zurück: "litt, sortie (ä partir) du vendredi".
Bei W. (1895,176): " mfuma wa yuma Sonnabend (jum a (sic!) mosi)".
45. mdja/wa (Diener, Sklave). G. *-g^ä (C.S. 821: slave, E). B. *-lya.
K. (1882,229): "a slave in the old language". S. (1939, 539): "I'es-
clave de Dieu, le serviteur de Dieu - mdya wa Mungu ". vor allem in
der poetischen Sprache. In den bearbeiteten Texten wird mdja neben dem
im St.Sw. üblichen mtumwa und den folgenden Beispielen allgemein für
'Sklave' gebraucht:
mdjakazi/wa- kidjakazi/zi-
Bei K. und S. vorhanden. Hier tritt das im Swahili sonst selten zu fin¬
dende feminine Suffix - kazi auf, das vor allem in den süd-östlichen Ban¬
tusprachen verbreitet ist. S. (1939, 540) zur Etymologie: " mdyakazi . R.
mdya 'esclave', mkazi 'femme'". Unter kidyakazi (s. 357): "jeune
fille esclave, jeune servante', R. kidya-kazi pour kidyana kazi . forme
non contractee de -ke". Hier wäre zu fragen, ob die letztere Form wirk¬
lich auf kidjana zurückgeht oder das Präfix nur entsprechend seiner
(diminutiven) Funktion verwendet wird. Die Etymologie des Stammes
-d.ia ist unklar. Ein phonologischer Vergleich der Nord- und Süddialekte
des Swahili zeigt, daß -ja (kommen) als Wurzel nicht in Frage kommt,
da reglmäßig /j/ im St.Sw. /y/ in den Norddialekten entspricht, in den
Texten aber durchgängig die Affrikata /dj/ verwendet wird. Dies ist auch
S. zu entnehmen, der neben dem oben erwähnten mdya ein Homonym auf¬
führt, das er als Partizip von - dya (kommen) bezeichnet. Hier lautet die
nördl. Entsprechung muya . In den Bantustämmen *-g\a. (slave) und *-yjj-
(come) ist zwar ein palatalisierendes Element enthalten, dies wird je¬
doch in den Nord- und Süddialekten jeweils unterschiedliche realisiert (7).
udja ( Dienstbarkeit )
mtwana/wa - (Sklave, Sklaven junge). G. * -tüa (C.S. 1804: pygmy;
1804: member of neighbouring despised tribe, E; bush dweller, W; ps.
467: Chief).
kitwana/zi - (Sklave, Sklavenjunge), twana (Sklave).
Bei K. (1882, 225) unter: "mtoana = mtume mume ' a male slave' , opp.
to mjakazi = mtuma mke 'female slave' , kitoana ' a slave boy' , opp. to
ki jak azi ' a slave girl"" (8). S. (1882,619 ) zu mtwana und einer mög¬
lichen Etymologie: "jeune garpon esclave: s'emploie facilement avec une
nuance de mepris. R. mtu+suf . diminutif -ana". Abgesehen von dem dimi¬
nutiven Suffix ist es wohl wahrscheinlicher, diesen Stamm auf die oben
angef. Bantustämme zurückzuführen. - In den Texten sind keine Bedeu¬
tungsunterschiede zwischen den Stämmen - dja, -twana und tumwa fest¬
zustellen. Die Ubersetzung lautet stets 'Diener' oder 'Sklave'. Da je¬
doch in keiner Sek.quelle ein Hinweis auf eine besondere Dialektzuge¬
hörigkeit für einen der oben erw. Wortstämme enthalten ist, ist anzu¬
nehmen, dcLß die Bedeutung ursprünglich differenziert wurde.
46. m(u)li/mi- (Tag). G. *-ci (C.S. 329: day, daytime, E).
Im St.Sw. nicht bekannt, wahrscheinlich anstelle von meh ana . Bei K.
und S. nicht verzeichnet.
mti kutwa (der ganze Tag)
Knappert (1972,190): "mtikati, time when the sun is in the zenit, noon".
Dieses Lexem ist auch bei S. für Kiamu und Kimvita angegeben. In den
Texten wird neben mti auch mutana (G. * -cana, C.S. 272: day¬
light, E), das heute im St.Sw. üblich ist, angeführt. Ein Unterschied
in der Bedeutung ist von den Ubersetzungen her nicht festzustellen. Für
weitere Überlegungen könnte vielleicht die Bedeutungsdifferenzierung
bei G. von Hilfe sein, B. stellt jedoch *-ki mit *-ka, -kana gleich. Da¬
neben kommen noch folgende Beispiele in den Texten vor:
uchao (Tag), in Verbindung mit
utwao (Nacht)
utwao na uchao (Tag und Nacht). Bei K. (1882,391) nur uchao: " kul¬
la siku , kulla kukicha , kulla uchao kasiyako ni hi every morning (dawn)
is this thy work, lit., as often as you causest it to dawn T. (1891,
76): " uchao understands usiku, utwao understands mtana. The subject
of kucha is usiku (according to the natives) but never jua, mtana, but
these are suitable subjects for the verb kutwa ". S. (1939,928) bemerkt
zu uchao nur, daß es ungebräuchlich ist und sich in Aphorismen erhalten
hat, z.B. " mtu huenda na ucao. hendi na utwao - on part le matin non le
soir". Bei J. (l939,45) ist für uchao (utwao ist nicht aufgeführt) fol¬
gende Eintragung zu finden: "early morning, when the sun begins to rise".
Zweifellos gehen diese Bildungen - ursprüngliche Relativkonstruktionen,
die sich auf ein Subst. der Kl. 3 oder 11 beziehen ( mchana, usiku )- auf
das Verb -cha bzw. -twa ( -chwa ) zurück.
47. m(u)tima (Herz). G. *-timä (C.S. 1738: heart; G.).
Im St.Sw. nicht gebräuchlich. Wird in allen Sek.quellen als altes Swahili
bezeichnet. Interessant sind Taylors Ausführungen zur Etymologie von
mtima und moyo , denen man jedoch nicht ganz folgen kann: "old Swahili
for heart, cp. root of tetema, to tremble. Moyo , the word now is use for
heart, in Chaga and Kamba ' ngoö ' , probably connected with k' oo (Zanz.
k'ororo ) the wind-pipe or gullet (1891,90)". moyo (G. *-yoyo, C.S.
2144: heart; E) kommt in den bearbeiteten Texten ohne Unterschied in
der Bedeutung vor, ebenso wie das aus dem Arab, stammende fuwadi.
48. muoli (Ehemann).
Nur bei Allen, der es auf -oa zurückführt (1971,417). Nach den phonolog.
Regeln des Swahili müßte dies aber m(w)ozi heißen, das bei J, (1939,
350) mit einer gänzlich anderen Bedeutung verzeichnet ist: "one who
gives in marriage, or who performs the ceremony". S. (1882,541):
" mdyoli (Am.G.Ngw. muyoli ) compagnon-gne d'eslavage, camarade
(entre esclaves)". Bel den Textstellen handelt es sich stets um eine An¬
rede, sodaß wohl eher die von S. angegebenen Bedeutungen zutreffen.
49. -mulika (look at). G.*-müdik- (C.S. 1330: shine, E)?
Nur bei Allen.
-muna (ansehen). G.*-mynik- (C.S. 1334: shine, W)?
Nur bei Dammann,
-munika (sichtbar sein)
Bei Dammann und Knappert.
Bei K. nicht vorhanden. Die Übersetzungen in den Texten weichen teil¬
weise beträchtlich von der von Guthrie ermittelten Bedeutung ab. G.
kommt jedoch S. sehr nahe. Ein Zusammenhang mit den in den Texten
vorkommenden Formen ist hier erkennbar (1939,625): "mulika (DS.
Mv.Ngw. = Am. - munika , G. -vunika) - eclairer (en parlant de la
lumiere); en parlant de qqn eclairer une personne ou un object avec une
lumiere; regarder ou chercher a l'aide d'une lumiere (taa)
Knappert (1972, 191) gibt für - munika die Bedeutungen ' to see, to look
at, gaze' an.
50. mvi (Pfeil). G. *-giJi (C.S. 903: arrow; E).
Im St.Sw. nicht in Gebrauch, Syn. zu mshale . Bei K. (1882, 28l) unter
mfi "arrow (Arab, msharre)". S. (1939,631), der es für die Dialekte
Ng.Mv. und Dy. anführt, erklärt es durch 'Entlehnung' (sic! ) aus dem
Nyiha, Bonde, Zigula und Shambala.
51. mthu mvuli (junger Mann)
Im St.Sw. selten, meist mvulana. Bei K. (1882,223) unter mfuli "(in
Kigunia) = mtu mume in Kimvita; mukono wa kufuli ( = wa ku-ume) the
right hand". Stg. (1915,54): " mvule (Kiamu) = mume a man, male";
H. (1939, 180): " ziuli brave ones, courageous men". S. (1939,634):
" mvuli (Am. G.Ng. ) homme, mari syn. T.D. , G. mume DS mwana mume
fig. un brave, mdodi mvuli jeune garpon, mwana mvuli ieune homme non
marie ... mkono wa mvuli ' main droit' ".
kuvuli (rechts)
In den Texten neben kuume. Das heute im St.Sw. geläufigere kulla kommt
nicht vor. Hinsichtlich der Angabe der einzelnen Dialekte gehen hier K.
und S. etwas auseinander. K. (1882,79) gibt für kufuli Kimrima. für
kuume Kigunia an. während S. (1939, 1002) vermerkt: " vuli G ... DS
mkono wa kuume ".
52. ndeo (Trunkenheit). D. ^-leva (trunken sein).
Im St.Sw. nicht in Gebrauch. Von allen Sek.quellen bestätigt.
Bei S. (1939,670) unter " ndweo (Ng.Mv. = Am. ndeo )".
kileo (Trunkenheit, Krankheit)
Im St.Sw. neben dem häufigeren ulevi in Gebrauch.
53. ndeo (pride)
Nur bei H. (1939, 172): "the old name of Lamu Island was kiwa Ndeo .
the popular translation of which is 'the Proud Isle'". Er weist aus¬
drücklich darauf hin, daJ3 es nicht mit ndeo (Trunkenheit) und ndeo
(ni+leo) zu verwechseln sei. Ha., der wesentlich auf Hichens Material
basiert, gibt nur die Bedeutung 'pride' an.
54. ndisha (Essen, Speise) < * ni+lisha
Bei K. und S. nicht erwähnt. Ha. (1959, 56): "food staff, forage, ration".
penye ndisha (feedy playe).
Daneben kommt in den Texten (außer chakula ) vor:
ziliwa (Speise).
55. ndjeo. zeo (Augenblicke, Stunden)
Im St.Sw. nicht bekannt. Nicht bei K. und S. In den Texten meist in Ver¬
bindung mit Demonstrativpronomina, z.B. ndjeo size (in diesen Augen¬
blicken). Es ist fraglich ob ein Zusammenhang mit leo (heute) besteht,
/l/ fällt in den Norddialekten oft aus, z.B. e-ta/leta (bringen), kiyemba /
kilemba (Turban). So läßt sich zeo für Kl. 8/l0 erklären. Die Affrikata
in ndjeo ist ungewöhnlich da ni + l_zu nd wird.
56. ndovu (Elephant). G. *-j6gv (C.S. 951: elephant, G).
Im St.Sw. tembo (G. * -tembo, C.S. 1708: elepahnt, E) gebräuchlicher.
Stg. (1915,32) gibt es für Kimvita, S. (1939,672) auch für Am.G.Ngaz.
als Syn. zu tembo an. Bei K. (1882,272) unter ndofu (or ndovu ) : "... the
Wasegua call it tembo kua sibabu ya menowakwe mawili kua kana mitembo
ya mnazi or mtembo ( crown ) wa dah abu or fedha" .
57. ndwe(l)e, ndevee (Krankheit). G. * -bada (CS. 18: 5/6 spot, speckle;
ps. 2: wound, scar)?
Bei K. (1882.393) unter " uelle (or uwelle ), plur nduelle makongo pains
of sickness". T. (1891,14): " ndwee for ndwele . more usual is the sing.
uwele ". Stg. (1915,54): Kiamu, Syn. zu ugonjwa . Diese Angaben werden
von S. (1939,675) bestätigt; er führt auch das Verb an "-waa - etre ma-
lache", das in den Texten jedoch nicht vorkommt, W. (1895, 182) stellt
- waa (krank werden, seufzen) - ugua gegenüber. Es ist durchaus möglich
dieses Lexem mit den oben angeführten Bantustämmen von G. in Ver-
bindung zu bringen. Einen Verbstamm erwähnt G. nicht.
upee = upele (a pimple) Stg. (1915,34), bei W. -pee (Krätze)
muwee = mwele (a sick person) Stg.
kiwee tja tauni (Pest) Dammann 5.
58. - ngua (etw. fließen lassen? )
Nur in Verbindung mit:
- ngua mwima (Nasenschleim fließen lassen)
- ngua kilio (bittere Tränen fließen lassen)
K. (1882,279): "to scum, to take off the scum, e.g. ku-ya-ngua mafuta .
samli, pofu" . Bel S. nicht vorhanden. Wahrscheinlich ist es mit - angua
"let fall, drop, take down, throw down" (J. 1939,16) identisch.
59. nguu. guu (Hügel), G. *-güdü (C.S. 881^83:top, antheap, hill, G).
Bei K. und S. nicht vorhanden. Im St.Sw. mlima . Vgl. juu (oben).
60. - nikhia (übergeben, anlegen, geben). G. *-nji)k- (C.S. 1363: give, E ) ?
K. (1882,282): "niltia v.obj. nikia tao (or kao? ) la tini ya kansu" .
Dazu keine weiteren Erläuterungen. Die Bedeutung deckt sich mit der oben
angegebenen. Bei S. nicht vorhanden. Ersatzaspiration für einen ausge¬
fallenen Nasal ist im Swahili keine Seltenheit (s. Kl. 9). So geht -nikhia
mit ziemlicher Sicherheit auf die von G. aufgestellte Bantuform zurück.
61. nina (seine Mutter). G. *-ninä (C.S. 1631: his mother, E).
Die ausführlichen Angaben der Sek.quellen unterscheiden sich etwas.
Während bei K. (1882,282) nur steht: "mother (in Kigunia, and an¬
cient Kisuahili)", gibt T. (1891,85) eine Bedeutungserweiterung an, die
wahrscheinlich sekundär ist: "the old word for mother, now surviving in
many objectionable expressions". Beide führen übrigens das gleiche Sprich¬
wort an, jedoch jeweils in einem anderen Wortlaut. Dies bestätigt V.
(1907,321): "... jetzt nur noch in Sprichwörtern, in der Poesie und in
dem Schimpfausdruck kuma nina ". S. (1939,684): "mere, les esclaves
appellent encore leur mere nina, pour ailleurs ce terme n'est plus em¬
ploye que dans qqs expressions ou locutions speciales".
mayu ( meine Mutter ). G. *-mää, määyo (C.S. 1280, 1289: mother)?
B. *ma (meine, unsere Mutter).
Bei V. (1907,321) angegeben, kommt in den Texten nicht vor. Handelt
es sich um eine Verkürzung aus mama yangu ? Bei K. und S. nicht vor¬
handen.
nyoko (deine Mutter)
Bei V. (1907,321), nicht aber bei K. oder S. angegeben, kommt auch
nicht in den Texten vor. Im St.Sw. wird für alle drei Formen ma¬
ma mit dem entspr. Possessivpron. verwendet.
62. nsij isij swi (Fisch). G. * t\^i (C.S. 1858: fish).
Bei K. (1882,285) vorhanden unter: " n' sui sing, sui = sam aki ". Stg.
(1915,54): Kiamu Syn. zu sam aki. S. führt es noch für Ngazija an. Bei
T. finden sich folgende Anmerkungen: " chichi - supplanted by Arabic
samaki (1891.22); " swi - old Swahili for fish; other words are chichi
and vumba . the latter dried fish", chichi ist bei K. nicht aufgeführt, S.
(1939, 141) hat: " cici (Am. G.Ng. ) inv.T. enf antin pour nsi poisson ( samaki )".
63. - nwa (trinken). G. * -ny (C.S. 1378: drink, G).
Bei K. (1882,285) unter: "noa... Steere writes nwa or nywa" . Für
die nördl. Dialekte von S. bestätigt. Im St.Sw. wird - nywa gebraucht
(G. * -my- ?)
kunwa koya (das Ende genießen) Dammann 4
kanwa (Mund), daneben auch:
kan ywa ,
das auf das im St.Sw. gebräuchliche -nywa zurückgeht. Beide Subst. sind
mit dem im Swahili nicht mehr gebräuchlichen Präfix der Kl. 12 verse¬
hen. Im St.Sw. dafür kinywa . Ein weiteres Beispiel dafür, daß ka- durch
ki- ersetzt wurde ist kadogo/kidogo (ein wenig).
64. n yao. nyau (Füße). G. *-yäyd (foot, sole of foot, E).
In den Texten nur als Plural. K. gibt wie J und auch W. nur die Be¬
deutung 'Fußsohle, Fußspur' an. S. (1939, 1019): "en poesie, wayo
est parfois pris pour Ie pied".
65. nyota (Durst). G. *-y6tä (C.S. 2137: thirst, G).
In den Texten bis auf ein Beispiel nur in folgender Verbindung: siku ya
n yota na ndaa (Tag des Durstes und des Hungers, d.h. Tag der Aufer¬
stehung). K. (1882,283): "niota (Kilamu = kiu great thirst) nnapätoa
or nnashikoa or kamätoa ni niota I am very thirsty". Hier wird nyota
offensichtlich auch allgemein gebraucht, während S. , der es für die Nord¬
dialekte und Kingozi notiert hat, nur das oben angeführte Beispiel aus den
Texten anführt. Wahrscheinlich ist dieses Subst. vor allem durch die
eben erwähnte, in den religiösen Texten oft vorkommende, Redewendung
bis heute erhalten. Im St.Sw. ist nur kiu in Gebrauch.
66. nvuni (Vogel). G. *-yüni (C.S. 2170: bird, E), vgl. auch C.S. 2121
-yonj (bird) G.
K. gibt es für Kimvita an, Stg. und S. darüber hinaus noch für das Kiamu.
In allen Sek-quellen wird es als Syn. zu dem im St.Sw. gebräuchlichen
ndege (G. C.S. 522 *-dege, bird, E) genannt.
67. - o(w)a (sehen, schreiben). G. -dod- (C.S. 641: look at, face to¬
wards, E).
Eine sehr gute Erläuterung dieses in den Texten häufig vorkommenden
Verbs gibt T. (1891,44): "primary meaning of this root is to straighten,
direct. Also it means to write and from one to other of these senses, to
ordain. Then kuo a comes to mean to behold, i.e. direct the eyes. These
must be distinguished in the old Swahili from ku-oa , to wed, and ku-oa or
owa, to bathe, from which is derived ku-olea . to float on the surface.
Ku-oa (to behold) is, in Giryama, ku-lola (close o) to be distinguished
from ku-l6la to wed (open o). The original sense of the first of the above
roots is found in the old invocation: Lowe Mauliwa loke, k'ombo nyoa
penyi tao - straighten it, my Lord, that it may be straight; stretch
straight the crooked where it is bent, (lowe = lioe j lionyeshe (neno).
The causative is oweza (sic! )". St. (1924,486) bemerkt dazu: "kowa
( ku owa or o_a) was explained to me as an equivalent for andika ... It is
the same word found in Pokomo as kora (kuora), and in Zulu as ukuloba" ■
Allen wählte dieses Verb aus, um die Schwierigkeiten bei der Transkrip¬
tion arabisch geschriebener Swahilitexte zu beschreiben: "The word uwa
wed core: there are the St. ua 'to kill' . oa 'to marry', Iowa 'to wash' and in some forms kowa 'to write' und kuwa ' to be' . (l971,42)"K.
(1882,287) waren offensichtlich nur zwei Bedeutungen bekannt, unter
- oa führt er die Bedeutungen 1. 'to look' ,2. 'to marry a wife' an.
Ovir möchte -ota (wachsen) von -oa (gerade machen) ableiten (?) (1896,
264). S. (1882,706) führt unter -oa, -ola . -Iola alle Bedeutungen an,
wobei er - ähnlich wie Taylor - die ursprüngliche wie folgt angibt:
"dresser ( nyosa ). redresser, diriger droit",
-olewa (beschieden sein)
- olea ( zuerteilen, verordnen )
- owa kauli (Stimme erheben) maozi (Augen)
Bei K. nicht vorhanden. S. (1882,504): ''Ng.coll. Organe de la vue, les
yeux ( maco )". T. (1891,33) hatte schon daraufhingewiesen, daß maozi
auf -oa (sehen) zurückzuführen sei. Daneben kommt - auiBer dem im
St.Sw. gebräuchlichen macho - in den Texten auch mafumizi (Augen)
vor, das bei K. nicht vorhanden, bei S. jedoch unter "- fumbi ou -fumbizi
(Ng. )" zu finden ist.
68. owe, ole (Unheil, Unglück)
Bei K. (1882, 188) nur unter ole als Interjektion ' woe ' . S. (1939,709):
"Am.DS ole sing. - la destinee, dest. malheureuse" ; auch bei W. (l895, 178) erwähnt: " owe wangu - wehe mir!".
69. ondo/ma- (Glieder)
Kommt nur bei Allen vor. Die Bedeutung wird abweichend davon bei K. ,
W. und S. mit 'Knie' angegeben. Im St.Sw. goti/ma -.
70. pamwe (na) ( zusammen mit ). G. * -müe (CS. 1326: one, G).
In Verbindung mit dem Präfix der Kl. 16 hat sich hier ein im Bantuge-
biet weit verbreiteter Zahlwortstamm erhalten, der im heutigen St.Sw.
durch moja ersetzt ist, das ebenso wie - mosi als eine Weiterentwicklung
zu -mue anzusehen ist. Als kamwe kommt dieser Stamm darüber hinaus
noch in negierten Sätzen vor. Wie aus einer Anmerkung bei Taylor (l891,
36) ersichtlich ist, wurde kamwe früher offensichtlich auch in affirma¬
tiven Sätzen gebraucht. K. und S. bestätigen pamwe als Archaismus und
Syn. zu pamoja .
71. - pulia (hören). G. *-püd- (C.S. 1589: hear, E).
Bei K. und S. nur - pulika . ebenso bei J. , der es als selten vorkommend
verzeichnet.
72. -_ta (schlagen). G. *-tä (C.S. 1630-32: war, bow, army)?
Bei K. nicht vorhanden. S. (1939, 85l): "Am. arch., Ng.Ngaz.2.Nz. 2
= S.G. - 6a - Syn. de - piga (Am.Pa.S.Ngaz. -pidya . G. -bisha ) 'battre'
dans des idiotismes archaiques, tels que: Nombe kamta p'embe , Ie boeuf
lui a donne un coup de corne. -ta kiwavu . donner un coup de coude (litt,
cote). -ta kiyemba . mettre le turban, syn. Am. - pidya kiyemba . ...
- ta sauti . crier". H. (1939, 176): "old Swahili ' put forth, strike, hit,
smite'". In den Texten kommen folgende Verb-Objektverbindungen vor:
wawezao kita sefu (skilled in wielding the sword)
hawajui kita panga (do not know how to wield a sword).
Es ist sehr fraglich, ob ein Zusammenhang mit vita, uta etc. besteht.
Bei G., M. und B. ist jedoch stets nur das entsprechende Substantiv
aufgeführt. Eine weitere Frage wäre, ob -tesa (afflict, cause trouble)
oder mtsei (one who causes trouble or annoyance, a persecutor) auf -ta
zurückgehen.
73. thambe (Stück, Korn)
Nur in den Texten, nicht in den Sek-quellen, wahrscheinlich handelt es
sich um t' embe ( chembe ), das dort mit dieser Bedeutung angegeben ist.
74. thandu (Zweig). G. *-cändü (C.S. 280: branch, E).
Bei K. nicht vorhanden, bei S. (1939,865): "tandu, augment de utandu .
Bamee, grosse branche avec ses rameaux et ses feuilles".
In den Texten kommt dieses Lexem nur in Kl. 9/l0 vor. Das im St. Sw.
gebräuchliche tawi geht auf den Bantustamm G. *-täbi (C.S. 1636) zu¬
rück.
75. - longo(w)a (sprechen)
Bei K. nicht vorhanden, S. (1939, 900): "(P. ) faire Ia causette, causer
Mr.Z. -ongea )". Ha. (1959,74): "speak, state, announce".
matongoo, matongozi (Worte).
Bei K. und S. mit anderer Bedeutung: S. : "conversation legere avec une
femme", das nach S. auf - tongoza (verführen) zurückgeht. In den Texten
wurden jedoch beide Substantive neben kalima, makaa, makuli, maneno ,
matamko ohne Bedeutungsunterschied gebraucht.
76. jiaji (Erde). G. *-cf (C.S. 330-32: ground, country, underneath).
Dem aus dem St.Sw. bekannten nchi entspricht in den Texten regelmäßig
niij ii. 1^- handelt sich bei dem obigen Beispiel um eine Erwei¬
terung, deren Etymologie unklar ist. Bei K. nicht vorhanden. Bei S.
(1939,888) nur in Zusammensetzungen, z.B. Nyuni wa tiati (oiseau ter¬
restre). W. (1895, 180) führt noch tinene (Festland) an. Vgl. auch keleü
kitini . (9).
77. -ti (sprechen). G. *-ti- (C.S. 1727: that, namely, say, G).
Dieses im Bantugebiet weit verbreitete Verb wird von K. und S. nicht
erwähnt. Es kommt nur in Knappert 4 vor.
78. -titi (klein)
Kommt im St.Sw. nur in Verbindung mit dem Präfix ka- vor und hat
dort die Funtion eines Adverbs. Bei K. nur katiti, bei S. auch Beispiele
für andere Klassen. St. (1924,328): "The adverb katiti is used at Lamu
instead of kidogo , but I have not heard it at Mombass". In den bearbeite¬
ten Texten mit den Präfixen folgender Klassen:
watiti (Kl. 2), kititi (KI. 7), katiti (Kl. 13), thiti (Kl. 9).
79. -toto (klein)
Im St.Sw. nur als Substantiv der Kl. l/2 in Gebrauch. In den Texten
auch als Adjektiv zu Kl. 7. Von K. und S. bestätigt. Zur Etymologie be¬
merkt S. (1939,903): "(Am. =S.G. -£o6o, DS - dodo , dogo ) ... Ia
racine est Ia meme que dans titi" (?) W. (1895,180): -toto (dünn,
schwach ).
80. zituko (Ängste).
Bei K. und S. (1939,415), letzterer bezeichnet es als "doublet de kisituko ".
81. thuwa (Schande, Fehl, Fehler). G. *-tük- (C.S. 1827: abuse, GG).
K. (1882,379): "tua (fedeha or aibu) , disgrace, stain, blemish".
S. (1939,905) mit gleicher Bedeutung: "la meme racine que - tuka ".
82. tuo (Bett).
In dieser Bedeutung nur bei Knappert. Bei K. nicht vorhanden.
Bei S. unter matuo (1939,517): "lieu de halte, de campment, station".
Ha. (1959,76): " utuo - resting place" . Vgl. -tua (sich niederlassen).
83. uchao s. mti
84. -uka (aufbrechen, herauskommen). G.*-büuk- (C.S. 197: rise up, go
away, E ).
Bei K. nicht vorhanden. Bei T. (1891,24): " mbuka ni-uka. ni-wuka from
-uka depart, leave"; als Erläuterung zu paukwa: "lit. (the place) has
(or had) something come forth from it kuuka is to rise up, to go out,
to go away, depart in Giryama (S. 108)". H. (1939, 178): "lit. be in a
state of going away, being a neut. pass, of - uya from Old Swahili - uya
(leave away)". Vgl. aber - uya (zurückkehren)! Das von H. und auch
von Ha. (1959,76) erwähnte Grundverb mit der Bedeutung "be leaving,
i.e. go away" wird von keiner anderen Quelle erwähnt.
85. upepe/phepe (Blitz)
Nur bei S. (1939,965) bestätigt als Syn. zu umeme .
86. utambo. tambo (Schlachtfeld, Kampfplatz, Kampf).
Bei K. nicht vorhanden, bei S. (1939,972) als dritte Bedeutungsangabe
unter utambo: melee dans la bataille, assaut du combat ... ingia utamboni
entrer (se jeter) dans la melee. ". Ha. (1959, 7l): " utambo - a triumphant
march; see -tamba in Johnson." In den Texten noch folgende Syn. kitaa,
kitali , kitana, von denen die ersteren sicher aus dem Arabischen stam¬
men.
87. utukuni (markt)
Dazu T. (1891,41): The word is said to be connected with the ngozi mtuku
'an evil, low person", from ku-tuka , ' ro be mean' and of the same root
as t' ua 'blemish' , t' ule adj. 'low' , but to be distinguished etymologi¬
cally from ku^Jua 'put down'". K. (1882,415): "utukuni (Kigunia) ( = sokoni
(vid. Kingozi) a place for slaughtering (R. ), altar?". S. 1939,482) und
W. geben es als Syn. zu soko an.
88. utwao s. mti
89. - uya (zurückkehren). G. *-buy- (C.S. 213: come or go back, E).
Bei K. nicht vorhanden. S. (1939,988) bezeichnet es als archaisch mit
der Bedeutung ' revenir (-rudi), retourner, retrogarder' .
Kommt auch bei St. und T. vor.
90. -uza (fragen). G. *-büüd^- (C.S. 186: ask, E)?
Im St.Sw. nur mit der Bedeutung "verkaufen' . H. (1939, 179): "now re¬
stricted to use in the sense 'to sell' , but originally -uza means to ask
in barter or exchange" . Mod.Sw. -uza 'sell', - uliza ' ask' , uza makes
panion, and mbulizi ' a questioner, a heckler' . Ovir (1896,252): "Ver¬
mutlich haben uliza fragen, das offenbar auch eine Kausativform ist,
und -uliza verkaufen eine gemeinsame Grundform -ula mit der Bedeu¬
tung 'kaufen, fragen'". Seidel's Ausführungen (1900, 1 58ff . ) beziehen
sich nur auf -uza/-uliza mit der Bedeutung 'kaufen' . Er führt es-wieS. -
auf ein *-gula ( kaufen) zurück. K. (1882,418) gibt unter uza ( uliza )
die Bedeutung 'ask (questions)' an, unter uza ' to seil (or kuuza or kuza
= ku za , to seil, vid. usa)". In chapter II der Einleitung zu seinem Wör¬
terbuch weist Krapf ausdrücklich auf die bedeutungsunterscheidende Rol¬
le dessen hin, was er Akzent nennt: "It is very nessary for the student to
notice carefully the position of the accent, as this has great influence on
the proper meanign of a word - e.g. kondo means strife or quarrel,
where as kondo signifies sheep". Auch S. (1939,988/89) führt beide
Verben getrennt an: "-uza (G. - vuza . Ngaz. 2, Nz. 2 - uziza ) inter-
roger, questionner, demander, s'informer, s'enquerir de, aupres
de -uza est la primitif de - uliza qui est plus us, avec le meme sens".
"- uza infinitif k'uza ou kuuza (TD - G. k' uzanya ) vendre ... R. -uza
(pour * wuza ) litt, "faire trafiquer, faire acheter" est le caus. d'une
ancienne form -wula ( Zig.Bo.Samb. etc. -gula ) trafiquer". W. führt
die heute ungebräuchliche Form - uzanya an. In den Texten auch:
- zanya (verkaufen)
mza ( Verkäufer ).
91. - wana (kämpfen). G. *-dü-, -düän- (C.S. 675: fight, G).
Von allen Sek-quellen für die nördlichen Dialekte bestätigt. K. (1882,423)
"to war (Kimrima) ku miniäna in Kimwita". S. (1939, 1016): "P.Am.
Ngaz. 1 et 2 Ng. - se battre, batailler, guerroyer, faire la guerre". Es
bleibt offen, ob dieses Verb auf den obigen Bantustamm zurückgeht,
- wania (H. : fight with)
muwani (Gegner, Kämpfer).
92. - wanga (zählen). G. *-täng- (C.S. 1673: count, W)?C.S.9: *-bäd- ?
K. (1882,423): "1. cut, 2. strike, 3. count kuhesabu or hasibu ,
striking the finger in counting, to reckon". Diese Bedeutungen gibt auch
S. an. Fraglich bleibt, ob der oben erw. Bantustamm zutrifft.
93. weu (Tageslicht, Klarheit). G. *yedü (C.S. 1966: whiteness, E).
K. (1882,427) führt nur die folgende Bedeutung an, die aber mit oben
angeführten durchaus zusammenhängt: "a spot where there is no tree, no
high grass in a woody wilderness or forest". S. bestätigt K.
94. -wi (schlecht). G. * -bi (C.S. 97: bad, GG).
V. (1907,322): " - wi für schlecht ist veraltet, heute nur - baya ge¬
bräuchlich, kibi wird ein Unglückskind genannt, dem die oberen Zähne
zuerst wachsen". Bei K. vorhanden, S. weist darauf hin, daß es mehr im
Norden gebraucht wird. In den Texten in Verbindung mit folgenden Prä¬
fixen: wawi (Kl. 2), mawi (Kl. 6), mbi (Kl. 9).
Anmerkungen
1. Bei Spaandonck, M., Practical and systematical Swahili Bibliography
(Leiden 1965) sind die bis 1962 erschienenen Arbeiten über Lehnwörter
verzeichnet. Darüber hinaus seien die folgenden Publikationen jüngeren
Datums erwähnt: Knappert, J., "The adaption of Swahili to Modern Terms",
A.u.U. XLV (1964), S. 182-91. Patel, R.B., "Etymological and phonetic
changes among foreign words in Kiswahili", Swahili vol. 37 (1967), pp.
57-60. Whiteley, W.H., "Swahili nominal classes and English loanwords",
in: La Classification nominale dans les langues negro-africaines, Paris
2. Vgl. u.a. Knappert, J., A choice of flowers. London: Heinemann 1972.
3. Sie geht in ihrer Arbeit auch auf den sozio-kulturellen Hintergrund bei der
Wortwahl ein. Dazu hatte schon 1965 Polome geäußert: "... such a num¬
ber of concepts can indeed be expressed either with lexical items of Bantu
origin or with loanwords from Arabic that the same idea may often be ut¬
tered word for word in a completely different vocabulary. However in such
a case the use and choice of definite words are closely dependent on the
socio-cultural level to which the speaker belongs, and striking differences
also exist between colloquial speech and literary usage, even in the strongly
Arabized island and coastal regions of Tanzania and Kenya".
4. Sie entstand im Zusammenhang mit einer größeren Arbeit, die sich vor
allem mit der Morphologie der älteren Swahili-Dichtung beschäftigt.
5. Vgl. hierzu: Sacleux, Ch., Grammaire des dialectes Swahilis , Paris
1909; Stigand, C.H., Dialect in Swahili , Cambridge 1915; Meinhof, C,
Introduction to the Phonology of the Bantu Languages , Berlin 1932;
Tucker/Ashton, "Swahili Phonetics", Afr.Stud, vol. 1 (l942), pp. 77-103,
161-182.
6. Vgl. hierzu bes. Allen (l97l) p. 11 ff.
7. Die Norddialekte scheinen sich insbesondere dadurch von den Süddialekten
zu unterscheiden, daß diese oft die "palatalisierenden" Elemente der re¬
konstruierten Bantuformen "ignorieren", z.B.*c-»'t^ (n_ti).
8. Unter kituana findet sich folgende Eintragung: " a boy; intuana a youth;
tuana (pl. wa- ) a full grown youth = mtu mpefu (sic! ).
9. Vgl. Damann, E., "Der Name tinku für Madagascar", Beiträge zur Na -
mensforschung (1954), S. 129-131.
1967.
Literaturangaben
Allen, J.W.T. , Tendi. London 1971.
Utendi wa Ayubu , Nairobi 1972.
Utendi wa Mikidadi na Mayasa . Nairobi 1972.
Utendi wa Masahibu. Nairobi 1972.
Utendi wa Qfyama . Nairobi 1972.
Bourquin, W • f Neue Urbantuwortstämme. Berlin 1923.
Dammann, E.,
"Weitere Urbantu- Wortstämme" . A.u.U. Bd. 38
( 1953), S. 27-48, 136.
Dichtungen in der Lamu-Mundart . Hamburg 1940.
(Die einzelnen Dichtungen tragen fortlaufende Num¬
mern).
Dempwolff, O.,
Eastman, C.M.,
Guthrie, M.,
Harries, L.,
Hichens, W. ,
Knappert, J .,
Krapf, J.L.,
Meeussen, A.E. ,
Meinhof, C.,
Ovir, E.,
Polome, E. ,
Sacleux, Gh.,
Seidel, A.,
Steere, E.
Stigand, C.H.,
"Beiträge zur Kenntnis der Sprachen in Deutsch-Ost¬
afrika. 9. Ostbantu-Wortstämme". Z.f.K. Bd. 7
(1916/17), S. 134-160, 167-191.
"Some lexical differences among verbs in Kenya
Coastal Swahili Dialects". Afr . Lang. Rev, vol. 8
(1969), S. 126-147.
Comparative Bantu , vol. 1-4. London 1967-71.
"Supplementary Vocabulary: Swahili-English" . J.E.
A.S.C. 28 (1958), pp. 49-78, 29/l (1959), pp.
55-80.
Al-lnkishafi. London 1939.
Het epos van Heraklios. Leiden 1958 ( Proof schrift )
(Knappert 4)
"The Hamziya deciphered". Afr.Lang. Stud. IX (l968),
pp. 52-81 (Knappert l).
"Utenzi wa Katirifu". A.u.U. Bd. 52 (1968/69),
S. 81-104, 264-315 (Knappert 3).
"The discovery of a lost Swahili Manuscript form
the 18th century". Afr.Lang.Stud. X (1969) S. 1-32
( Knappert 2).
A choice of flowers. London: Heinemann 1972.
A Dictionary of the Swahili Language. London 1882.
"Bemerkungen iiber die Zahlwörter von sechs bis
zehn in Bantusprachen". In: Wort und Religion
(Dammann-Festschrift). Stuttgart 1969, 11-18.
Introduction to the Phonology of the Bantu Langu ¬
ages. Berlin: Reimer 1932.
"Die abgeleiteten Verba im Kiswahili". Z.A.O.S.
II, no. 3 (1896), S. 249-266.
"Geographical differences in lexical usage in
Swahili". (Zusammenfassung eines Vortrages ani.
des Intern. Dialetologen-Kongresses, Marburg (1965),
Sektion VIII).
Grammaire des dialectes Swahilis. Paris 1909.
Dictionaire Swahili-Franfais. Paris 1939.
"Uza und Uliza im Swahili". Z.A.O.S. V, no. 2
(1900), S. 158-160.
A Handbook of the Swahili Language. London S.P . C . K.
1894, rev. ed. 1924.
Dialect in Swahili. Cambridge 1915.
1
Taylor, W.E., African Aphorism . London 1891.
Velten, C, Prosa und Poesie der Swahili. Berlin 1907.
Würtz, F., (bearb. von A. Seidel) "Beiträge zur Kenntnis des
Lamu-Dialektes der Swaihili-Sprache" . Z.A.O.S.
1, no. 2 (1895), S. 169-193.
SAPU LEGER, EIN BALINESISCHES SCHATTENSPIEL
ZUR RITUELLEN REINIGUNG
Von Peter Wilh. Pink, Hamburg
Die folgenden Ausführungen beruhen auf Ergebnissen einer von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft unterstützten Untersuchung über das balinesische wa¬
yang (Schattentheater), bei der im Jahre 1974 15 Schattenspieler der Provin¬
zen Gianyar, Bangli, Klungkung, Badung und Buleleng befragt wurden.
Obwohl das Nacht-wayang auf Bali bei Festen und Zeremonien aufgeführt
wird und sein Inhalt auf den Anlaß abgestimmt ist, dient es nach landläufi¬
ger Auffassung nur der Unterhaltung. Als zeremonielles wayang betrachtet
man das wayang lemah (l), das die Zeremonie des pedanda (Priester der Brah-
manenkaste) begleitet, das wayang sudamala (2) und das wayang sapu leger (3).
Während wayang lemah und sudamala zu mehreren Anlässen aufgeführt werden
können, dient das wayang sapu leger nur der rituellen Reinigung von Personen
mit einer falschen Geburt. Darunter versteht man Personen, die in der uku
(Schriftsprache: wuku) wayang geboren sind, der 27. Woche des balinesischen
Jahres, an deren letztem Tag, dem tumpek wayang (4), die dalang (Schatten¬
spieler) den Geburtstag (odalan) des wayang feiern. Wer in dieser Woche ge¬
boren ist, gilt als besonders gefährdet, denn er ist von Siwa seinem dämoni¬
schen Sohn Kala zur Speise freigegeben. Das kann sich daran zeigen, daß das
betroffene Kind schwächlich und häufig krank ist. Es besteht die Gefahr, daß
es früh stirbt. Ein Informant war der Auffassung, das Kind bekomme einen
schlechten Charakter, ähnlich dem von Kala, da beider Geburtstag in dieselbe
Woche fielen.
Um diesen Gefahren vorzubeugen, muß man ein wayang sapu leger veran¬
stalten, das an irgendeinem Geburtstag (otonan/odalan) (5) - maßgeblich ist
das balinesische Jahr von 210 Tagen - aufgeführt wird. Wenn den Eltern die
finanziellen Mittel dazu fehlen, können sie es aufschieben, sogar bis das Kind
erwachsen ist. Jedoch hält man es in Südbali für besser, wenn das sapu leger
vor dem 10. Geburtstag des Kindes stattgefunden hat. Als besonders günstig
betrachtet man den ersten und dritten otonan. In Buleleng (Nord-Bali) bestand
daneben die Auffassung, das Kind müsse mindestens 12 Jahre alt sein oder die
Milchzähne schon verloren haben.
Die Entsühnung besteht aus der Aufführung eines Schattenspiels und einer an¬
schließenden Reinigungszermonie. Der Lakon (Gang der Handlung, Drama)
eines wayang sapu leger ist immer "Kala Tatwa" (Kalas wahres Wesen), manch¬
mal auch "Sapu Leger" genannt: Siwas Sohn Kala, ein mächtiger Dämon, hat von
seinem Vater das Recht erhalten, alle Menschen zu verzehren, die in der uku
wayang geboren sind, so auch seinen Bruder Kumara. Der flieht und findet zu¬
letzt Unterschlupf bei einem dalang, der gerade ein wayang aufführt. Der da¬
lang rettet ihn vor seinem Bruder und erlöst ihn vom Fluch seiner Geburt (6).
Die Aufführung stellt also die mythische Begründung sowohl für die Gefähr¬
dung durch die falsche Geburt dar als auch den Weg der Befreiung aus ihr.