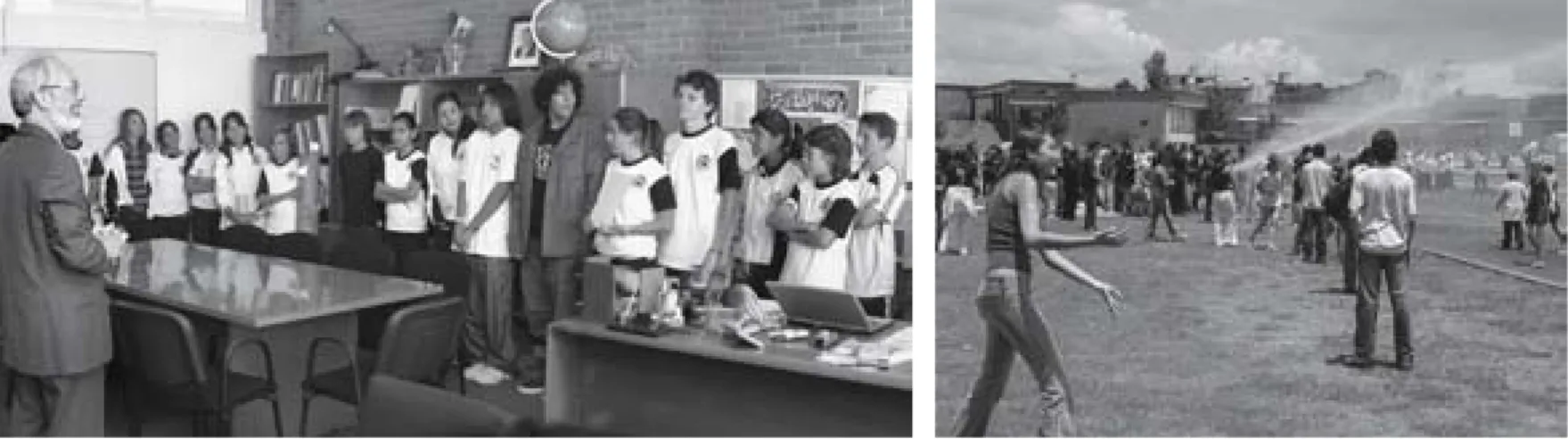2. WELTKONGRESS
DEUTSCHER AUSLANDSSCHULEN 2. WELTKONGRESS
DEUTSCHER AUSLANDSSCHULEN
2. WELTKONGRESS
DEUTSCHER AUSLANDSSCHULEN
2/2006
Informationen | Berichte | Bilder Informationen | Berichte | Bilder
Belgrad: Von v ielen Anfän gen Kapstadt: Vernetz ung, Q
ualitä t un
d 20 16 Kultu r min
ister in W
olff üb
er d as „
17. Bu
nd esl an d“
2. WELTKONGRESS
DEUTSCHER AUSLANDSSCHULEN
Herausgeber: Auswärtiges Amt, Berlin und Bundesverwaltungsamt, Köln – Zentralstelle für das Auslandsschulwesen – Internet: http://www.auslandsschulwesen.de
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht in jedem Fall die Meinung der Herausgeber wieder.
Die Redaktion behält sich das Recht vor, eingehende Beiträge redaktionell zu bearbeiten.
Schriftleitung: Dr. Boris Menrath · E-Mail: Boris.Menrath@bva.bund.de
Redaktion/Layout: Carina Gräschke, Berlin · Internet: http://www.auslandsschulwesen.de/zfa/begegnung Redaktioneller Beirat: Dr. Boris Menrath, Bundesverwaltungsamt – Zentralstelle für das Auslandsschulwesen – ·
Friedrich Broeckelmann, Sekretariat der Kultusministerkonferenz · Michael Dohmen, Auswärtiges Amt, Referat 605 Titelbild & Titelgestaltung: Carina Gräschke, Berlin
Texte: Alle nicht namentlich gekennzeichneten Beiträge stammen von der Redakteurin Carina Gräschke.
Fotos: DIS Kapstadt (S.5 unten), DS Puebla (S. 25-27), DSB Bratislava (S.28), DS Belgrad (S.29-32), DIS Zagreb (S.33-34), ZfA (S.34-37), Nehring (S.38-39), DSB Alexandria (S.40; 48), Lomakine/Jahnke/www.pixelquelle.de (S.41-42), DS Malaga (S.42 unten), Pissarenko/Schule Nr. 20 Krivoj Rog (S.46-47), Gräschke (S. 1-25), Pohle (Logos)
Gesamtherstellung: Bonifatius GmbH, Karl-Schurz-Str. 26, 33100 Paderborn, Tel.: 0 52 51 / 1 53-0, Fax: 0 52 51 / 1 53-1 04, Anzeigenverwaltung: Bonifatius GmbH, Karl-Schurz-Str. 26, 33100 Paderborn,
Karl Wegener, Tel.: 0 52 51 / 1 53-2 20, Fax: 0 52 51 / 1 53-1 04, E-Mail: karl.wegener@bonifatius.de
Hinweise für die Autoren: Eingehende Beiträge sollten 7000 Zeichen (mit Leerzeichen) nicht überschreiten.
Fotos sollten eine Druckqualität von ca. 300 dpi bei 10 x 15 cm haben.
IM P R ES SU M
INHALT
Dossier 2. Weltkongress
Kapstadt: 106 Auslandsschulen beim 2. Weltkongress . . . 2 Kapstadt: Das Auslands-
schulwesen – Kapstadt:
Probleme & Lösungen . . . 4 Kapstadt: Von Vernetzung,
Qualität und 2016 . . . 8 Kapstadt: Kurzinterviews –
Erwartungen, Mitbringsel
und mehr . . . 12 Kapstadt: Mehr Gewinn durch
Partnerschaft & Information . . . 14
Kapstadt: Qualitätsmanagement, Schulentwicklung und
Zertifizierung . . . 16 Kapstadt – Pretoria:
Amabala abunta . . . 18 Kapstadt: Die hessische
Kultusministerin Karin Wolff über das „17. Bundesland“ . . . 19 DIS Kapstadt: „Meine Schüler
sind farbenblind“ . . . 21
Unter die Lupe genommen
Köln: SEIS+ und dann? . . . 24 Puebla: Werkzeuge für
die Schulentwicklung . . . 25 Bratislava: Wachstum:
Pro Jahr eine Klasse . . . 28 Bratislava: Rekordverdächtiger
Schulstart . . . 28 Belgrad: Von vielen Anfängen . . . . 29 Belgrad: Perspektiven aus Sicht
der Deutschen Botschaft . . . 32 Zagreb: Von der Neugründung
2004 zum EuroCampus . . . 33 Feldkirchen: Der Kampf um
den WM-Titel . . . 34
Köln: Neue Materialsammlung
„Deutsch hat Zukunft“ . . . 36 Alexandria:
Eine junge Autorin . . . 40 St. Petersburg: Nach dem
Projekt ist vor dem Projekt . . . 41 Köln: Ode an
Diethelm Kaminski . . . 44 München: Zwei Weltsprachen:
Sport und Musik . . . 48 Tipp: 54. Europäischer
Wettbewerb 2007 . . . 49
Rubriken
Editorial . . . 1 Einblicke: 20 Jahre Anadolu
Lehrerentsendeprogramm . . . 38 Magnettafel . . . 43
Die andere Seite: Die Fahrt
zum Krummen Horn . . . 45 Leute . . . 47 Personalia . . . 49
Editorial
Hitzige Debatten trotz kühler Temperaturen
Es war kalt. Weder Kostüm noch Anzug schienen warm genug, um der fortwährenden Gänsehaut abzuhelfen. Unermüdlich blies die Klimaanlage kalte Frischluft in den gro- ßen Hörsaal der Universität Kapstadt. Doch die Delegierten des Weltkongresses ließen sich davon nicht beeindrucken. Die tiefen Temperaturen kühlten die heißen Debatten keineswegs ab. Denn der zweite Weltkongress deutscher Auslandsschulen in Kapstadt kann als Markstein in der Geschichte deutscher Auslandsschulen gelten.
Nur selten zuvor hatten sich Politik und Wirtschaft so eindeutig auf die Seite der Aus- landsschulen geschlagen. Noch nie hatte das Qualitätsmanagement der Schulen so im Blickpunkt gestanden. Und auch um ein Gütesiegel der deutschen Auslandsschulen
„Made in Germany“ war es bisher noch nicht gegangen. Bei alledem hatten die rund 300 Vorstände, Schul- und Verwaltungsleiter der deutschen Schulen ihre eigenen Messlatten in Form von Erfahrungen und Vorstellungen mitgebracht. Denn es ist und bleibt Tatsache: Jede deutsche Auslandsschule für sich ist ein Unikat. Dementspre- chend kompliziert ist eine Vereinheitlichung, egal in welcher Form.
Zugleich lebte der Weltkongress von diesen Unterschieden. Aber das lesen Sie besser selbst in dieser Begeg- nung (S. 2ff). Im Kapstadt-Dossier geht es um den Weltkongress als Politikum genauso wie um Lehrermangel und Budgetierung (S. 4ff), um Vernetzung, Qualität und das Auslandsschulwesen im Jahr 2016 (S. 8ff), außer- dem um die ideellen Mitbringsel dreier Delegierter (S. 12ff). Um dieses Bild abzurunden, haben wir die hes- sische Kultusministerin Karin Wolff zum Gespräch gebeten. Denn die Politikerin engagiert sich im Rahmen der KMK (Kultusministerkonferenz) seit Jahren für die Auslandsschulen (S. 19ff).
Natürlich widmen wir auch dem „Schauplatz“ des Weltkongresses seinen Platz. Ein kleines Porträt der Deut- schen Internationalen Schule Kapstadt, die maßgeblich zur Vorbereitung des Kongresses beigetragen hat, und sich als würdige wie kompetente Gastgeberin erwies, finden Sie auf Seite 21. Ihr bzw. den Menschen, die diese Schule ausmachen, sei an dieser Stelle noch einmal herzlich gedankt.
Auch wenn die Zukunft des Auslandsschulwesens einen Großteil dieser Begegnung einnimmt, kommt das Schulleben natürlich nicht zu kurz. Schließlich steht die Deutsche Schule Zagreb kurz vor ihrem zweiten Geburtstag (S. 33). Dort wie überall wird Schulentwicklung immer wichtiger. Auch die Deutsche Schule Bel- grad (S. 29) berichtet diesbezüglich über ihre Bemühungen. Wir neh-
men die ersten Ergebnisse, die mit dem Selbstevaluationsinstrument an deutschen Auslandsschulen Seis+ erzielt wurden, zum Anlass einer kurzen Analyse. Und schließlich erläutert Schuldirektor Dr. Janzen, wie die einzelnen Werkzeuge für Schulentwicklung an der Deutschen Schule Puebla eingesetzt werden (S. 25ff).
Lassen Sie sich all die Beiträge in der vorliegenden Begegnung also nicht entgehen. Und haben Sie zum einen oder andern Sachverhalt eine andere Meinung, diskutieren Sie mit ihren Kollegen und: mit uns.
Wir freuen uns auf Ihre Beiträge.
Zu guter Letzt: Wie Sie spätestens beim Blick ins Impressum bemerken werden, hat es im Redaktionsbeirat einen Wechsel gegeben. Diethelm Kaminski verließ die Begegnung mit seiner Pensionierung. Boris Men- rath übernimmt nun die Schriftleitung. Auch im Redaktionsbeirat ar- beitet nach Alexandra Nissen, die Mutter geworden ist – Herzlichen Glückwunsch –, jetzt Friedrich Broeckelmann mit, der vorher an der Deutschen Schule Washington unterrichtete. Und auch ich verab- schiede mich mit dieser Ausgabe von Ihnen. Vielen Dank für die freundliche Unterstützung, die ich an den deutschen Auslandsschulen rund um den Erdball erfahren habe. Egal wie kalt es war, ich wurde überall warmherzig empfangen.
Herzlich
Ihre Carina Gräschke
Zauberhaft und vielseitig:
Kapstadt mit deutscher Schule, Weltkongress, Menschen und viel, viel Gegend
R u br ik
O
b Staatssekretär im Auswär- tigen Amt oder hessische Kultusministerin, ob Bun- destagsabgeordnete oder Präsi- dent des Deutschen Industrie- und Handelskammertages – jede und jeder zeigte sich von der enormen Bedeutung und der Nachhaltigkeit des deutschen Auslandsschulwesens für die Bun- desrepublik Deutschland über-zeugt. „Jede Investition in die deutschen Schulen im Ausland trägt reife Früchte“, so Staatssek- retär Boomgaarden. Immer wie- der treffe er auf ausländische Füh- rungskräfte aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, die eine deut- sche Schule besucht haben. Der deutsche Staat brauche die Aus- landsschulen – wirtschaftlich, kul- turell, als Friedensstifter.
Der Vertreter des Auswärtigen Amtes stellte aber auch fest, dass in den vergangenen Jahren, in de- nen der Etat des Auswärtigen Am- tes für das Auslandsschulwesen geschrumpft ist, die Einspargrenze der Schulen erreicht bzw. über- schritten sei. Neue deutsche Schu- len in Regionen, in denen Deutsch- land bisher kaum vertreten ist, könnten nicht auf Kosten der be- stehenden Bildungseinrichtungen entstehen. Auch darüber scheinen sich die Vertreter der Länder und des Bundes wie auch die beiden Bundestagsabgeordneten Monika Griefahn und Lothar Mark einig.
Gegenwärtig unterstützt die Bun- desrepublik 117 deutsche Aus- landsschulen und fördert 362 Schulen in ausländischen Bil- dungssystemen – insgesamt rund 230.000 Schüler verschiedenster Nationalitäten.
„Die Konkurrenzfähigkeit Deutsch- lands im Ausland hängt wesent- lich davon ab, ob nicht nur wirt- schaftlich handelnde Personen kurz auftauchen und wieder ver- schwinden, sondern vor Ort eine Wurzel erzieherischen Handelns an einer Schule wahrnehmbar ist“, betont die hessische Kultusmi- nisterin Karin Wolff. Der Respekt unserem Land gegenüber könne nur dann erhalten werden, wenn es Menschen wie die Teilnehmer des Weltkongresses gebe, die vor Ort in den Dialog mit der Gesell- schaft des Gastlandes treten. Sie sind es, die unsere Ideale von Frei- heit, Frieden und Gerechtigkeit vermittelten und diese Überzeu- gungen vor Ort vorlebten. „Der Gewinn der Auslandsschularbeit“, so Wolff, „lässt sich nicht allein in Cent und Euro bemessen“.
Auf dem Kongress wurde wieder- holt deutlich gemacht, dass die Auslandsschulen auf dem interna- tionalen Bildungsmarkt bestehen
Musikanten und Sänger der DISK Kapstadt geben den Ton bei der Begrü- ßung an, bei der die Natio- nalhymnen Südafrikas und Deutschlands gesungen werden.
Kapstadt: 106 Auslandsschule n beim 2. Weltkongress
Aktiv dabei: Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft
D o ss ie r
„Bewährtes erhalten – die Zukunft gestalten“, so lautete das Motto des zweiten Weltkongresses der Deutschen Auslandsschulen vom 9. bis 11. September 2006 in Kapstadt. Rund 300 Vorstände, Schul- und Verwaltungsleiter deutscher Bildungseinrichtungen im Aus- land sowie führende Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissen- schaft waren der Einladung des Weltverbandes Deutscher Aus- landsschulen (WDA) und der Zentralstelle für das Auslandsschul- wesen (ZfA) im Bundesverwaltungsamt nach Südafrika gefolgt und diskutierten Entwicklungsperspektiven und Chancen der deutschen Auslandsschulen.
R u br ik
müssen. Sie schütze, so formuliert es der Präsident des Bundesver- waltungsamtes, Dr. Jürgen Hen- sen, kein staatliches Reglement vor der Konkurrenz der internatio- nal besten Schulen. „Kein Schul- amt wehrt unerfüllbare Kunden- wünsche ab, keine Verantwortung kann abgeschoben werden. Nur mit Flexibilität und Innovations- geist sind diese Aufgaben zu erfül- len. Beide sind nicht ohne Risiko.
Auch deshalb ist dieser Weltkon- gress für den Erfahrungsaustausch so notwendig“, sagte Hensen.
Die südafrikanische Erziehungs- ministerin Naledi Pandor verfolgte die sachliche, von der Vielfalt der deutschen Schulen im Ausland ge- prägte Debatte um Schulqualität und Schulstruktur, um Schulma- nagement und Internationalisie- rung. In ihrer Rede zeigte sie die Verbindungen ihres Heimatlandes zu Deutschland auf – Verbindun- gen, die auch stark von den deut- schen Schulen in Südafrika gestal- tet werden. Sie verwies auf die hohe Qualität dieser Schulen, in der seit Jahren jeder Gymnasiast die südafrikanische Hochschul- reife erreicht hat, auf die Arbeit der Schulen in ehemals benachtei- ligten Gebieten … Stolz berichtete sie von einem Abkommen zwi- schen Deutschland und Südafrika, das kurz vor seinem Abschluss steht. Es bildet die Basis dafür, dass Schüler ihre Bildungseinrichtun- gen künftig mit einem deutsch- südafrikanischen Abschluss verlas- sen können. Statt zweier Ab- schlüsse – dem Deutschen Interna- tionalen Abitur und dem National Senior Certificate – wird es einen gemeinsamen geben. „Damit ent- steht ein prestigeträchtiger Ab- schluss, der den Hochschulzugang an den meisten internationalen Universitäten erlaubt. Zugleich verbessert sich die internationale Vergleichbarkeit unseres nationa- len Abschlusses“, so Erziehungsmi-
nisterin Pandor. Besonders erfreut nahmen das die Vertreter der drei deutschen Schulen in Südafrika auf. Denn zuallererst werden ihre Schüler davon profitieren.
Für Diskussionsstoff sorgte auch der Beitrag des Präsidenten des Deutschen Industrie- und Handels- kammertages, Ludwig Georg Braun, der eigens zum Weltkon- gress der Deutschen Auslands- schulen angereist war. Er schlug vor, die lokalen Lehrer deutscher Auslandsschulen an deutsche Schulen in der Bundesrepublik zu schicken, damit diese sich in die Gedankenwelt, wie eine deutsche Schule in Deutschland funktio- niert, einfühlen können. Zugleich versprach er, seinen Einfluss wei- ter geltend zu machen, damit die deutschen Unternehmen die be- sondere Rolle der deutschen Aus- landsschulen für ihre Zukunft er- kennen und dementsprechend ak- tiv würden. Es reiche nicht, sie
„nur als Schulheimat für Kinder potenzieller Experten, die man entsendet, um im Tochterunter- nehmen oder Vertriebseinheiten im Ausland temporär tätig zu sein, wahrzunehmen“.
Am Ende des 2. Weltkongresses, an dem Verantwortungsträger des Auslandsschulwesens aus 60 Ländern teilnahmen, stellten die Initiatoren fest, dass es stärker denn je auf Netzwerke ankommt – an den Schulstandorten mit an- deren Mittlerorganisationen ebenso wie zwischen den ver- schiedenen Schulstandorten. Sie stimmten überein, dass Verläss- lichkeit und mittelfristige Pla- nungssicherheit unabdingbar seien, ebenso wie eine hinrei- chende Versorgung mit deutschen Lehrern. Der Vorsitzende des Weltverbandes Deutscher Aus- landsschulen, Jorge Pulido, hält als Qualitätsnachweis der deut- schen schulischen Arbeit im Aus- land auch die Teilnahme am Pisa- Test für unabdingbar. „Wir brau- chen die Unterstützung der deut- schen Wirtschaft. Wir sind Unternehmer in unserem Sitz- land. Dabei ist die Schule auch Kulturzentrum und Multiplikator der deutschen Kulturen im Aus- land“, sagt Jorge Pulido, der auf der WDA-Mitgliederversammlung am Rande des Weltkongresses mit 100 Prozent der Stimmen wieder gewählt wurde. (cg)
Luftholen für die National- hymnen – vorn im Bild (erste Reihe v.l.): Dr. Jür- gen Hensen, Präsident des Bundesverwaltungsamtes, Naledi Pandor, Erziehungs- ministerin Südafrikas, Georg Boomgarden, Staatssekretär im Auswär- tigen Amt, Jorge Pulido, Vorsitzender des WDA e.V.
sowie Joachim Lauer, Lei- ter der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen
Kapstadt: 106 Auslandsschule n beim 2. Weltkongress
Aktiv dabei: Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft
D o ss ie r
R u br ik
Von Lehrer mangel, Rohmateri al
und Budge tierung
Das Auslandsschu lwesen – Probleme & Lösun gen
Von Carina Gräschke
Die südafrikanische Erzie- hungsministerin Naledi Pandor hat die Delegier- ten des Weltkongress schon mit ihren ersten Worten für sich eingenom- men.
D o ss ie r
F
ür die meisten war es ein un- gewohntes Gefühl, wieder im Hörsaal unter Gleichgesinn- ten zu sitzen. Denn die Studienzeit lag für das Gros der Teilnehmer am Weltkongress der deutschen Auslandsschulen schon etwas län- ger zurück. Zugleich aber stand der Geist der Universität als Ort des Lehrens und Lernens, als Ort geistiger Auseinandersetzung und innovativer Ideen wie ein gutes Omen im Hörsaal 1 des Kramer Buildings der Universität Kapstadt.Zwei Tage lang drückten die rund 300 Vorstände, Schul- und Verwal- tungsleiter deutscher Bildungsein- richtungen im Ausland gemein- sam mit führenden Vertretern der deutschen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft die quietschenden Hörsaalsitze. Auch die südafrikani- sche Bildungsministerin Naledi Pandor hatte zeitweise in der Mitte der ersten Reihe Platz genommen.
Danach bedauerte sie einige Ent- scheidungen, die sie während ih- rer Zeit an der Universität Kap- stadt getroffen hatte. Denn die aufrechte Frau, die mit Beschei- denheit, Charme, Witz und Weis- heit die Herzen der Anwesenden im Sturm eroberte, hatte einst selbst an der Universität Kapstadt gelehrt.
Dabei sei sie auch für die Moderni- sierung der Universität mit verant- wortlich gewesen. „Bis heute dachte ich, das hier ist ein großar-
tiger Hörsaal. Aber jetzt, da ich das erste Mal aus der Mitte einer Bank nach vorn gekommen bin, sehe ich das anders“, begann sie humorvoll, um gleich darauf sach- lich und sehr bildhaft auf die in- tensive Zusammenarbeit beider Länder einzugehen. Besonders hob sie dabei das Engagement der deutschen Schulen in Südafrika hervor, die in den früher benach- teiligten Gebieten Herausragen- des geleistet hätten (mehr zur Rede der Ministerin auf S. 3).
Ihre, aber auch die Anwesenheit der zahlreichen hochrangigen Vertreter aus deutscher Politik, Re- gierung und Wirtschaft zeigte die in den vergangenen Jahren ge- wachsene Wahrnehmung der Be- deutung des Auslandsschulwe- sens. Allerdings, und das wurde in fast jeder Debatte auf dem Welt- kongress deutlich, spielen die deutschen Schulen im Ausland in der deutschen Öffentlichkeit nach wie vor kaum eine Rolle. Während in den Feuilletons großer Tages- zeitungen häufig über das Goe- the-Institut berichtet und gestrit- ten wird, kommt das Auslands- schulwesen kaum vor.
Deutsche Auslandsschulen sind schwarze Löcher …
„Wenn ich Goethe nehme und die deutschen Auslandsschulen, dann ist Goethe ein Stern, der sehr hell leuchtet. Die deutschen Auslands-
schulen sind an diesem Himmel der deutschen Öffentlichkeit schwarze Löcher“, so Eckhard Mehring vom WDA-Vorstand.
„Aber diese schwarzen Löcher sen- den in ihren Gastländern enorm helle Signale aus, weil wir nämlich einen Vorteil haben, den Goethe nicht hat. Wir haben 300 oder 500 oder 1000 oder 8000 … Kinder, die tagtäglich deutsche Kultur, deut- sche Werte, deutsches Leben ins Land tragen. Das ist ein Faktor, der für die Wirtschaft wichtig ist, ein Faktor, der für die auswärtige Kul- turpolitik wichtig ist, und was auch immer ein bisschen zu kurz kommt, das ist die auswärtige Kul- turpolitik.“
Seltener Schirmherr:
Bundespräsident Horst Köhler Das ist bis heute kaum in das Be- wusstsein der deutschen Öffent- lichkeit gedrungen. Aber – und das kam auf dem Weltkongress ständig zur Sprache – das kann, soll und muss sich ändern. Die hessische Kultusministerin nahm sich des Problems ganz pragma- tisch an, indem sie daran erin- nerte, dass Bundespräsident Köh- ler die Schirmherrschaft für den Weltverband Deutscher Auslands- schulen (WDA) übernommen hat.
„Ich glaube, es ist ein sehr wesent- liches Element, wenn der Präsi- dent unserer Republik sagt, eine der wenigen Schirmherrschaften, die ich übernehme, ist diese über
R u br ik
Von Lehrer mangel, Rohmateri al
und Budge tierung
Das Auslandsschu lwesen – Probleme & Lösun gen
Von Carina Gräschke
diesen Verband. Mit diesem Pfund muss man wuchern“, so Karin Wolff. Zugleich müsse man an Bi- ografien der öffentlichen Verant- wortungsträger ansetzen und das in die öffentliche Berichterstat- tung über internationales Gesche- hen und Wirtschaft bringen. „Da- mit können wir sehr wohl deutlich machen, welchen Einfluss, welche nachhaltige Relevanz die Arbeit der deutschen Schulen im Ausland hat“, sagte sie.
Ein Paradebeispiel dafür lieferte der Präsident des Deutschen In- dustrie- und Handelskammertages (DIHK), Ludwig Georg Braun. Er berichtete von einem Treffen vor wenigen Wochen. Aus Anlass des 50. Jubiläums der Industrie- und Handelskammer in Paraguay war er mit dem Präsidenten des Lan- des, dem Finanzminister, dem Lei- ter des Staatssekretariats für Steu- erwesen, dem Präsidentenberater in Wirtschafts- und Finanzfragen, der Leiterin der Zentralbank Para- guays … zusammengekommen.
„Sie alle sprachen fließend Deutsch. Alle hatten diese Prä- gung aus einer deutschen Schule oder Universität. Und: Wir haben in diesem Kreis Deutsch gespro- chen“, so der Unternehmer.
DIHK-Präsident macht sich für Auslandsschulen stark
Natürlich sei es nicht die Sprache allein, sondern auch die bikultu-
relle Ausbildung, die für die deut- sche Wirtschaft so wichtig ist.
Denn sie sorgt für ein positives In- vestitionsklima gegenüber deut- schen Unternehmen und zugleich für ein Reservoir gut ausgebildeter deutschsprachiger Mitarbeiter, die im Gastland verankert sind. Daher lohne sich jede Investition ins Aus- landsschulwesen, auch wenn kurz- fristig kein Gewinn zu sehen ist.
Das müssten auch die Unterneh- men in Deutschland wissen. Er für seinen Teil, versprach der DIHK- Präsident, werde das Wissen um die Bedeutung der deutschen Aus- landsschulen weiter in die Kreise der Wirtschaft tragen.
Auch wenn das Lob und die Be- kenntnisse gern gehört wurden, waren die Vertreter von 110 deut- schen Schulen im Ausland vor al- lem gekommen, um sich auszutau- schen. Sie wollten von den Erfah- rungen der anderen lernen, kleine Netzwerke bilden, Lösungen für ihre Probleme finden und anderen helfen. Denn auch wenn keine Schule der anderen gleicht, gibt es doch ähnliche Entwicklungen.
Qualitätsmanagement und Schul- entwicklung gehörten zu den im Großen und Kleinen diskutieren Themen, ebenso wie der teilweise Rückgang der Schülerzahlen und natürlich das immer knapper wer- dende Geld aus Deutschland.
Dabei ging es den meisten Schul- vertretern vordergründig gar
nicht darum, mehr Geld zu erhal- ten, als vielmehr um deutsche Leh- rer, um Verlässlichkeit und Pla- nungssicherheit. Darum stieß das vorgestellte Modell der Budgetie- rung, zu dessen großen Verfech- tern der Bundestagsabgeordnete
Erwartungsvolle Gesichter vor dem Auftakt des Kon- gresses – vorn im Bild (1.
Reihe v.l.): der Bundes- tagsabgeordnete Lothar Mark, der DIHK-Präsident Ludwig Georg Braun, die hessische Kultusministerin Karin Wolff sowie BVA-Prä- sident Dr. Jürgen Hensen
D o ss ie r
Die schönste deutsche Schule im Ausland
Es war vor allem das Engagement der deutschen Schulen in Südafrika, allen voran der Deutschen Internationalen Schule Kapstadt, das den Weltkongress ermöglicht hatte. Eine große Leistung, denn wie beim ersten Weltkongress vor vier Jahren in Mexiko lief auch hier alles wie am Schnürchen. So kam es, wie es kommen musste – die TeilnehmerIn- nen aus aller Welt konnten sich voll auf den Tagungsinhalt konzentrie- ren, bedauerten nur, nicht mehr von der Deutschen Schule Kapstadt (DISK) gesehen zu haben.
Die lernten einige nur am Abschiedsabend kennen. Denn die malerisch am Fuße des Lion Heads gelegene Schule bietet zwar Platz genug für all ihre Schüler, aber ein Weltkongress lebt davon, dass alle Delegierten zu- sammenkommen. Das war an der Universität Kapstadt besser möglich.
Die meisten hatten dennoch Glück. Denn die WDA-Mitglieder, die Schul- und Verwaltungsleiter tagten vor Beginn des Weltkongresses schon in verschiedenen Gebäuden der DISK. Danach gab es nur wenige, die diese Schule nicht für eine der schönsten der Welt hielten. Aber das nur am Rande.
R u br ik
Mark zählt, auf großes Interesse in der Podiumsdiskussion zur Zu- kunft des Auslandsschulwesens.
Kern ist die Festschreibung von Mittelzuweisungen für einen be- stimmten Zeitraum, so dass die Schulen eigenverantwortlich da- mit wirtschaften können. Im Un- terschied zum herkömmlichen Haushalt wird auf die detaillierte Vorgabe der Ausgaben verzichtet, so dass die Schulen eine neue Fle- xibilität, aber auch Planungssi- cherheit erlangen.
Mehr an Freiheit
muss zu Mehrwert führen Zugleich wird damit mehr Spiel- raum geschaffen, ohne dass es mehr Geld gibt. „Die Einführung von mehr Freiheit in der Mittelver- wendung, wie Hr. Mark sie vor- schlägt, muss allerdings gekoppelt sein mit Qualitätskontrolle, mit ei- nem System, das sicherstellt, dass das Mehr an Freiheit auch zu Mehrwert führt“, so Rolf-Dieter Schnelle vom Auswärtigen Amt.
Das sei mit Sicherheit der Weg der Zukunft, um konkurrenzfähig zu bleiben.
Vom Qualitätsunterschied in der Haushaltsbeurteilung Noch ist die Budgetierung gro- ßen Stils im Auslandsschulwesen Zukunftsmusik, was – so MdB Mark – vorrangig an den Vorga- ben des Bundesfinanzministeri- ums liege. „Aber gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt kämpfen wir darum, möglichst viele Berei-
che im Einzelplan des Auswärti- gen Amtes zu budgetieren“, ver- sprach der Abgeordnete. Mit der Zielvereinbarung und dem Be- richtswesen sei auf diesem Weg eine wesentlich vernünftigere und qualitätsvollere Kontrolle der Mittelverwendung möglich.
Schließlich gehe es nicht darum, wie viele Bleistifte auf dem Tisch des Schuldirektors liegen dürfen.
Entscheidend sei, was er damit macht. Das sei für ihn der wich- tige Qualitätsunterschied in der Haushaltsbeurteilung, so der Par- lamentarier.
Für die nächste Zeit, so der Leiter der Zentralstelle für das Auslands- schulwesen (ZfA), Joachim Lauer, sind in Lateinamerika Pilotpro- jekte geplant, die dann evaluiert werden müssten … Allerdings, auch dieser Einwurf kam in der Debatte um die Zukunft des Aus- landsschulwesens, dürfe bei allen Möglichkeiten dieses Modells nicht vergessen werden, dass die Budgetierung kein Allheilmittel ist. Es geht in erster Linie um Ver- waltungskompetenzen und -ver- antwortlichkeiten. Das mehrfach angemahnte Lehrerproblem kann auf diesem Weg aber nicht gelöst werden.
Deckten die Meinungen der Schul- vertreter zur Budgetierung so ziemlich jede Nuance zwischen
„für uns perfekt“ und „kommt überhaupt nicht in Frage“ ab, so herrschte nahezu Einigkeit in der Frage der Versorgung mit deut- schen Lehrern. „Wir brauchen
jetzt, morgen und in Zukunft deut- sche Lehrer. Denn ohne deutsche Lehrer gibt es keine deutsche Schule“, brachte der WDA-Vorsit- zende Jorge Pulido das auf den Punkt.
Es geht darum denken zu lernen
Schließlich ist es das pädagogische Konzept deutscher Auslandsschu- len – der wissenschafts-, problem- und schülerorientierte Unterricht, bei dem es darum geht denken zu lernen –, der an den verschiede- nen Standorten der deutschen Aus- landsschulen nachgefragt wird.
„Dieses Versprechen kann aber nur angemessen eingelöst werden, wenn entsprechend ausgebildete Lehrer, die diese spezifische Art des Unterrichtens gelernt haben und auch ausüben können, an die- sen Schulen lehren“, so Dr. Anton von Walter, vormaliger Schulleiter der Deutschen Schule Barcelona,
DIHK-Präsident Ludwig Georg Braun präsentiert sich als großer Fürspre- cher der deutschen Schu- len im Ausland (links). Ein Pausengespräch (v.l.):
Naledi Pandor, Georg Boomgarden, Monika Griefahn (MdB) und Jorge Pulido
D o ss ie r
R u br ik
jetzt Leiter des Studienseminars Speyer in Rheinland-Pfalz.
Allerdings ging das Verständnis der einzelnen Delegierten des Weltkongresses von „entsprechend ausgebildeten Lehrkräften“ ausein- ander. Dazu hatte nicht zuletzt WDA-Vorstand Mehring beigetra- gen, der den Begriff Rohmaterial in die Runde geworfen hatte.
Ausgangspunkt war eine Forde- rung, die wohl jeder im Hörsaal 1 der Universität Kapstadt unter- schreiben konnte: Lehrer, die von deutschen Auslandsschulen nach Deutschland zurückkommen, dür- fen keine Nachteile erleiden, weil sie im Ausland waren. Vielmehr müssen sie besonders gefördert werden, weil sie im Ausland eben nicht nur Lehrer gewesen sind.
„So ein deutscher Lehrer im Aus- land leitet mal gerade eben so ei- nen Kongress wie hier, er organi-
siert ihn. Das sind unternehmeri- sche Fähigkeiten, für die der Leh- rer keinerlei Ausbildung hat, die er aber haben muss und die die Vorstände ohne weiteres von ihm erwarten. Wir brauchen qualifi- zierte Lehrer im Ausland, Sie brau- chen qualifizierte Lehrer in Deutschland. Wir liefern Ihnen die. Schicken Sie uns nur das Roh- material! Wir machen daraus schon qualifizierte Lehrer“, hatte Mehring das Problem zugespitzt.
Gespenst des Lehrermangels Allerdings dürfte es in nicht allzu ferner Zukunft nicht nur an „mit- telgeschliffenen Diamanten, also hochgradig ausgebildeten Leh- rern mit Referendariat und auch noch zwei, drei Jahren Berufser- fahrung“ (Wolff) fehlen, sondern auch an Rohmaterial. Denn „ohne dass die deutsche Öffentlichkeit, ohne dass die Medien es bisher so klar bemerkt haben, sind wir in ei-
ner akuten Lehrermangelphase, die sich noch auf Jahre hinaus wei- ter verschärfen wird.
Einerseits werden also spezifisch vorbereitete Lehrkräfte im Aus- land gebraucht und gefordert, an- dererseits zeichnet sich ab, dass schon in naher Zukunft der Lehrer- bedarf im Inland nicht hinrei- chend gedeckt werden kann. – Eine Situation, die pragmatische Lösungen erfordert, weil natürlich auch die Bereitschaft der Bundes- länder, das vorhandene Personal zu entsenden, gegen Null geht, wenn sie die eigenen Unterrichts- versorgungsverpflichtungen nicht mehr einlösen können (Vgl. Inter- view mit Kultusministerin Karin Wolff S. 19ff).
Darum ist es äußert wichtig, dass der berufliche Weg für Lehrer im Auslandsschulwesen attraktiver gemacht wird. „Bis jetzt hatten wir ein gewaltiges Problem: wenig Geld. Wenn wir nicht rasch eine Lösung für dieses Problem finden, haben wir ein zweites: Herzlich wenig Lehrer, die ins Ausland ge- hen wollen“, so der ehemalige Schulleiter aus Barcelona, Dr. v.
Walter.
Wenn diese Worte die Kongress- teilnehmer nur partiell aufrüttel- ten, lag das vor allem daran, dass während der Kongresstage nicht nur die Forderung nach mehr aus Deutschland entsandten Lehrern im Hörsaal gestanden hatte, son- dern auf politischer Seite auch die Bereitschaft dazu, die Forderung
zu erfüllen. Impressionen vom Welt- kongress
D o ss ie r
R u br ik
B
ereits die erste Podiumsdis- kussion des Weltkongresses zeigte, vor welchen Heraus- forderungen die Auslandsschulen in der Zukunft stehen. Auf dem Podium diskutierten: die hessischeKultusministerin Karin Wolff, der SPD-Bundestagsabgeordnete Lo- thar Mark, der WDA-Vorstand Eck- hard Mehring, der stellvertretende Leiter der Kultur- und Bildungsab- teilung im Auswärtigen Amt, Rolf
Der Hörsaal 1 des Kramer Buildings der Universität Kapstadt bot einen würdi- gen Rahmen für den 2.
Weltkongress der deut- schen Auslandsschulen.
Diskutierten die Zukunft des Auslandsschulwesens (v.l.): Christian Wendt, der Schulleiter der DISK, Eck- hard W. Mehring, WDA- Vorstand, und Karin Wolff, hessische Kultusministerin.
Von Vernetzung, Qualität und 2016
Die Zukunft des Auslandsschulwesens – Auszüge einer Diskussion
D o ss ie r
Dieter Schnelle sowie der Leiter der Deutschen Internationalen Schule Kapstadt, Christian Wendt.
Als Vertreter der Kongressorgani- satoren hatten die Moderation übernommen: der WDA-Vorsit- zende Jorge Pulido und der ZfA- Leiter Joachim Lauer.
In dieser Runde wurde mit dem Plenum über den zukünftigen Stellenwert und die öffentliche Wahrnehmung (vgl. S. 4ff) des Auslandsschulwesens diskutiert.
Es ging aber auch um die Vernet- zung der Mittlerorganisationen vor Ort, die Qualität der Schulen im engen wie im weiteren Sinne sowie die finanziellen Mittel. Hier nun ein paar Auszüge aus der De- batte:
Vernetzung der Mittlerorgani- sationen: „Die Auslandsschulen haben bei mir einen sehr, sehr ho-
R u br ik
der Gesellschaft, mit der Kultur und mit der Bildung vor Ort zu- sammenarbeiten müssen“, schreite intensiv voran.
Rolf-Dieter Schnelle vom Auswär- tigen Amt bekräftigt das: Es sei eine stehende Aufforderung an alle Auslandsvertretungen vor Ort, dass sich alle Mittler und auch die Vertreter der deutschen Wirtschaft vor Ort regelmäßig treffen und vor Ort direkt konkret absprechen, wo sie sich gegensei- tig helfen und das gemeinsame große Ganze vorantreiben kön- nen.
„Natürlich müssen wir kooperie- ren. Es wird schon sehr viel koope- riert. In Den Haag z. B. machen wir die Sprachkurse, das Goethe- Institut das Examen …“, wendet WDA-Vorstand Mehring ein. In der weiteren Diskussionen kamen noch etliche Beispiele für die be- reits bestehende gute Zusammen- arbeit vor Ort wie beispielsweise aus Kapstadt. Auf jeden Fall kam die Botschaft von der dringend notwendigen Vernetzung der Mittlerorganisationen an.
Qualitätssiegel und Benchmar- king: Schulentwicklung, Qualitäts- siegel, Benchmarking, Pisa … sind nur einige der Stichworte, die in der Debatte häufiger fielen. Dabei ging es einerseits um ein aner- kanntes Qualitätssiegel, anderer- seits um die Abschlüsse an deut- schen Auslandsschulen.
„Jede Schule muss auch Rechen- schaft ablegen, muss sich messen
lassen – an der Konkurrenz vor Ort, muss zeigen, was sie kann. Sie muss darüber hinaus nicht nur das Wissen vermitteln, und das kann auch mit Benchmarks er- fasst werden, sondern auch erzie- herisch in die Gesellschaft wirken.
Das sollte man nicht vernachlässi- gen bei der Diskussion über Stan- dards und vieles andere, was wir messen wollen, können und müs- sen“, so die hessische Kultusminis- terin, die in der Debatte als erste auf den besonderen Qualitätsan- spruch der Auslandsschulen hin- wies.
WDA-Vorstand Mehring forderte ein Benchmarking – aber eben nicht innerhalb des deutschen Auslandsschulwesens, sondern mit den besten Schulen der Welt.
„Das können wir nur, wenn wir eine Art label, eine Art branding haben. D.h. wir müssen untersu- chen, was ist die Qualität unseres Abiturs, unseres Deutschen Inter- nationalen Abiturs … Was ist es eigentlich wert? Warum muss ein Kind durch die schwierige deutsche Reifeprüfung, wenn es auch mit dem viel, viel leichteren IB die gleichen Studiengänge be- legen kann? Wir müssen uns wirklich auch fragen, ob das, was sich bewährt hat, richtig ist.
Wenn wir feststellen, unser Abi- tur ist nicht mehr das, was nötig ist, dann müssen wir uns davon trennen. Wenn wir aber meinen, unser Abitur ist was, dann kleben wir uns auch ein Siegel drauf, dass es so verdammt gut ist, dass die Schüler zu uns kommen“, sagte er.
Auch Lothar Mark (MdB – v.l.) und Rolf-Dieter Schnelle (stellv. Vorsitzen- der der Kultur- und Bil- dungsabteilung des Auswärtigen Amtes) disku- tierten im Podium die Zukunft des Auslands- schulwesens. Die Modera- tion hatten Jorge Pulido (WDA-Vorsitzender) und Joachim Lauer (ZfA-Leiter) übernommen.
D o ss ie r
hen Stellenwert, weil ich fest da- von überzeugt bin, dass sie eine der nachhaltigsten Investitionen Deutschlands im Ausland darstel- len“, so MdB Mark. Die Auslands- schulen wirkten als Friedensstifter – insbesondere durch ihre kultu- relle Einbindung in das Gastland und die jeweilige Gesellschaft. Ge- rade darum sei es sehr wichtig, die deutschen Mittler vor Ort in- tensiver zu vernetzen. „Ich sage das bewusst, weil ich im Ausland sehr unterschiedliche Situationen gesehen habe“, so der Parlamen- tarier, der gelegentlich auch schon mal über kurzfristige Mit- telsperrungen nachgedacht hat, um die Vernetzung vor Ort voran- zutreiben. Allerdings habe sich bisher stets die Überzeugung durchgesetzt, dass es dieses Drucks nicht bedarf. Denn das Bewusst- sein, „dass wir ja für Deutschland im Ausland stehen, dass wir mit
R u br ik
Ein Markenzeichen „Deutsche Schule“, das zugleich ein Quali- tätssiegel ist, möchte auch Max Wachholtz vom Deutschen Leh- rerbildungsinstitut in Santiago:
„Wir müssen in den nächsten Jah- ren daran arbeiten, zwei Fragen zu beantworten: Was ist eine deut- sche Auslandsschule? Wie definie- ren wir sie? Nur so können wir ein Gütesiegel erarbeiten, das auch von unserer Konkurrenz akzep- tiert wird.“
Allerdings wird schon seit gerau- mer Zeit an einem solchen Quali- tätssiegel gearbeitet. Es könnte den stolzen Namen „Qualitäts- schule der Bundesrepublik Deutschland“ tragen. Aber der Name dieses Markenzeichens ist im Moment noch zweitrangig.
Viel wichtiger ist zu klären, wel- che Voraussetzungen eine Schule erfüllen muss, um es erst zu er- und dann zu behalten, schließlich soll es eine besondere deutsche Schulqualität garantieren. Neben einem Qualitätsrahmen, den Bund und Länder vorgeben wer- den, soll eine Bund-Länder-Schul- inspektion anhand bestimmter Kriterien über die Vergabe des Siegels befinden. Die Vorbereitun- gen sind bereits so weit gediehen,
dass schon 2007 ein Pilotprojekt beginnen wird.
Allerdings ist das nur die eine Seite des Siegels. Die andere: Es muss auf dem internationalen Bil- dungsmarkt etabliert werden, et- was wert sein, um den deutschen Auslandsschulen damit auch in ihrem Gastland einen Wettbe- werbsvorteil zu verschaffen.
Die deutsche Auslandsschule 2016 … braucht deutsche Lehrer.
„Sie muss zwei Dinge leisten: Zum einen die tradierten deutschen Stärken ausbauen und dauerhaft im Schulprogramm verankern, zum anderen muss sie schauen, wo Wettbewerber besser sind und in diesen Gebieten dazulernen“, so Dr. Reinhard Köhler vom Bund- Länder-Ausschuss für schulische Arbeit im Ausland (BLASchA). Er wies darauf hin, dass der Nachteil der Auslandsschulen gegenüber dem IB-System durch die Umstel- lung von Input- zu Outputsteue- rung gerade beseitig werde: „Wir sind jetzt auf dem Weg, das Zen- tralabitur einzuführen. Die Aus- landsschule der Zukunft kann nicht die uniforme Schule sein, sondern eine Schule, die zwar ihre Leistungsparameter erfüllt, die
aber auch verankert ist in der Kul- tur der Region einerseits und in deutscher Kultur andererseits.“
Dafür bedürfe es aber eines Mini- mums an deutschem Personal.
Muttersprachler seien auch wei- terhin notwendig, um ein gewis- ses Sprachniveau zu erhalten und bestimmte Minimalstandards nicht zu unterschreiten und um eine gute deutsche Schule zu sein.
„Aber wir können sicherlich im kulturell-sportlichen Bereich, im Nachmittags- und Ganztagsbe- reich von unseren Wettbewerbern lernen und dann noch was drauf- satteln. Dazu brauchen wir aller- dings das Commitment der deut- schen Behörden und Verbände, der deutschen Wirtschaft und Öf- fentlichkeit“, so der BLASchA-Län- dervorsitzende Köhler.
Ähnlich sieht das der Leiter der Deutschen Schule Kapstadt, der neben Planungssicherheit auch eine bessere Ausstattung im per- sonellen Bereich anmahnt. „Wir brauchen eine gute Anzahl an gut ausgebildeten Lehrkräften, ohne die Schulgebühren einschneidend zu erhöhen.“ Denn letztere ginge mit einem Verlust von Schülern einher. Und: „Dort, wo besondere Aufgaben hinzukommen, muss
Ein Gruppenfoto: die Teil- nehmer des 2. Weltkon- gresses in Kapstadt
D o ss ie r
R u br ik
diese Zahl auch erhöht werden. Es kann nicht sein, dass wir mit zehn Prozent Reduzierung weiterhin gute Arbeit leisten“, so Christian Wendt.
Der Bundestagsabgeordnete Mark möchte für die Auslandsschulen 2016 mehr entsandte Lehrkräfte, Budgetierung und damit einher- gehend Planungssicherheit sowie verstärkten Austausch deutscher Schulen und Einrichtungen vor Ort.
Wenn die Visionen der Auslands- schule 2016 in Kapstadt nur über die Rahmenbedingungen defi- niert wurden, liegt das an der Un- terschiedlichkeit der deutschen Schulen im Ausland. Denn jede Schule hat ihr ganz spezielles Pro- fil und muss entsprechend der Ge- gebenheiten vor Ort ihre eigene Vision entwickeln.
Die Finanzen: Nachdem in den vergangenen Jahren der Etat für das Auslandsschulwesen ge- schrumpft ist, besteht die nicht unbegründete Sorge, dass die In- vestitionen der Bundesrepublik in das Auslandsschulwesen weiter zurückgehen. Daher wies Rolf-Die- ter Schnelle darauf hin, dass er
sehr wohl die Forderungen der Schulen unterstützt, die darauf hinweisen, dass für zusätzliche Aufgaben auch ein Mehr an Fi- nanzen erforderlich ist: „Doch so- lange wir das nicht hinbekom- men, müssen wir weiter versu- chen aus dem, was wir haben, was zu wenig ist, mehr zu ma- chen.“
Doch ein Mehr an Investitionen ist in den vergangenen Jahren, wie der Bundestagsabgeordnete Mark begründete, nicht zuletzt an der Struktur des deutschen Bun- deshaushalts gescheitert. Zum ei- nen ist die Haushaltsstruktur über Jahrzehnte gewachsen. Zum an- deren gilt der bleierne Haus- haltgrundsatz:
„Wenn ihr da etwas draufsatteln wollt, müsst ihr sagen, wo ihr das hernehmen wollt – aber aus dem gleichen Etat. Das heißt also, wenn ich für die Auslandsschulen 100 Millionen mehr möchte, muss ich im Auswärtigen Amt woanders 100 Millionen wegnehmen“, so MdB Mark. Allerdings gibt es im Haushalt des Auswärtigen Amtes viele Pflichtaufgaben, so dass dort überhaupt kein Spielraum für Um- schichtungen besteht. „Deswegen
ist meine Quintessenz und auch die vieler anderer: Wir müssen eine Umstrukturierung im Bun- deshaushalt vornehmen. Denn die Zukunft liegt nicht in den mi- litärischen Konfliktlösungen, son- dern in der Prophylaxe.“ Dafür brauche es mehr denn je die Aus- wärtige Kultur- und Bildungspoli- tik und die Entwicklungspolitik, erklärt der Parlamentarier.
Die hessische Kultusministerin weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es auch Ausnah- men gibt und geben muss – ge- rade in Hinblick auf Bildung.
Denn wenn in diesem Bereich nicht investiert und dafür auch in Kauf genommen werde, dass an- dere Haushalte geringer werden, würden Investitionen für die Zu- kunft versäumt. „Wenn wir im- mer gesagt haben, in der Entwick- lungszusammenarbeit ist der Kern 1. Bildung, 2. Bildung, 3. Bildung, dann muss es auch möglich sein, dass hier ein engerer Austausch zwischen der Auslandsschularbeit und Bildungsarbeit aus dem Seg- ment des Ressorts für Entwick- lungshilfe möglich ist, ohne dass man die Auslandsschulen in das Entwicklungshilferessort umsat-
telt“, so Karin Wolff. Pausen- gespräch
D o ss ie r
R u br ik
Optimismus und
Gemeinsamkeit im Gepäck
Der Schuldirektor der DS New York über den Weltkongress Begegnung: Mit welchen Erwar- tungen sind Sie nach Kapstadt ge- kommen?
Udo Bochinger, Schulleiter DS New York und Vorsitzender des ZfA-Di- rektorenbeirats: Ich hoffte, hier mit den verschiedensten Vertretern deutscher Auslandsschulen zusam- menzukommen und Kontakte zu knüpfen. In diesem Kreis trifft man sich sehr selten. Da sind insbeson- dere die Gespräche am Rand wich- tig, die eine engere Zusammenar- beit wie beispielsweise zwischen Di- rektorenbeirat, ZfA, KMK und WDA erst möglich machen, die helfen, dass die Kommunikation besser fließt. Zum anderen ist es mir ein Anliegen, die Zukunftsfähigkeit der Auslandsschulen mitzugestalten – durch den Austausch, aber auch durch das geschlossene Auftreten von Vorständen, Schulleitern etc. Es ist wichtig, alle am Auslandsschul- wesen Beteiligten in ein Boot zu be- kommen und in die gleiche Rich- tung zu rudern.
Begegnung: Was nehmen Sie wie- der mit?
Udo Bochinger: Drei Erkennt- nisse: 1. Ohne Schulentwicklung und Marketing kommen wir heute nicht mehr voran. 2. Die Auslands- schulen sind auch ein Vorteil für die Inlandsschulen, weil an den deutschen Schulen im Ausland vieles bereits umgesetzt wird, was den Einrichtungen im Inland nutzt. 3. Die Auslandsschulen wer- den von der Politik wahrgenom- men. Sie wissen: Über unsere Schü- ler lässt sich Völkerverständigung schaffen. Und dann nehme ich viel Optimismus mit, den ich aus dieser Gemeinsamkeit, die hier in Kapstadt zu spüren war, schöpfe.
Begegnung: Was wird bleiben?
Udo Bochinger: Das Gefühl, nicht allein zu sein. Wir stehen geschlos- sen da und wissen, dass das deut- sche Auslandsschulwesen auch weiterhin Zukunft hat und in den kommenden Jahrzehnten nötiger denn je gebraucht wird. Und na- türlich die vielen Begegnungen, die Kontakte, die eine enge und konstruktive wie zielorientierte Zusammenarbeit erleichtern.
„Das Rad muss nicht immer neu erfunden werden“
Die Vorstandsvorsitzende der DS Paris über den Weltkongress Begegnung: Mit welchen Erwar- tungen sind Sie nach Kapstadt ge- kommen?
Birgit Kleinert, Vorstandsvorsit- zende DS Paris: Ich war gespannt auf die Erfahrungen der vielen Kolleginnen und Kollegen, die in aller Welt eine vergleichbare Auf- gabe ausüben: als Ehrenamtliche eine doch ziemlich verantwor- tungsvolle Aufgabe zu erfüllen. Da ich selber die Funktion der Vorsit- zenden erst seit November 2005 ausübe, gehöre ich nicht zu den
„alten Hasen“, die es an einigen Standorten gibt. Für mich sind die Themen Finanzierung, Wettbe- werbsituation vor Ort, Fluktuation im Vorstand und die Gestaltung von Veränderungsprozessen von großem Interesse gewesen.
Begegnung: Was nehmen Sie wie- der mit?
Birgit Kleinert: Schon die ver- schiedenen Problemstellungen ha-
ben gezeigt, dass es so viele Paral- lelen wie Unterschiede zwischen den einzelnen Schulen gibt. In der Regionalgruppenarbeit während der Mitgliederversammlung des WDA kamen die spezifischen The- men der westeuropäischen Aus- landsschulen zur Sprache: alte Standorte, stagnierende bis rück- läufige Schülerzahlen. Problema- tisch ist dort auch die starke Kon- kurrenz vor Ort. Das können, wie in Brüssel, die europäischen Schu- len sein oder, wie bei uns in Paris, die öffentlichen französischen Schulen mit starken deutschen Ab- teilungen, die ebenfalls von der Bundesrepublik mit Lehrkräften subventioniert werden. Allerdings sind diese Schulen – im Gegensatz zu uns – für die Kunden kosten- frei.
Die entstandenen Kontakte kön- nen zu sinnvollen Synergieeffek- ten in der Arbeit führen, wir alle brauchen diese Netzwerke. „Ver- lässlichkeit und Planungssicher- heit“ waren die beiden wohl am häufigsten benutzten Wörter wäh- rend des Kongresses. Sie drücken aus, was die Verantwortlichen vor
Die vielen Gespräche am Rande des Kongresses waren ebenfalls von unschätzbarem Wert.
D o ss ie r
Erwartungen, Mitbr ingsel und mehr
Drei Fragen – drei Antworten
Es waren so viele verschiedene Menschen auf dem Weltkongress, dass wir unmöglich alle nach ihren Eindrücken vom Weltkongress befragen konnten. Stellvertretend unterhielten wir uns am Rande der Veranstaltungen in Kapstadt mit einem Schuldirektor, einer Vor- sitzenden des Schulvorstandes und einem Bundestagsabgeordneten.
R u br ik
Ort in ihrer Arbeit beunruhigt, was sie aber dringend benötigen.
Außerdem habe ich den Eindruck gewonnen, dass das Auslands- schulwesen einen immer stärke- ren Stellenwert im Bewusstsein von Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft erlangt, was si- cherlich auf die hervorragende (Aufbau-)Arbeit der Kollegen der ZfA als auch des WDA zurückzu- führen ist. Dafür gebührt ihnen ausdrücklich Dank!
Was ich auch mitnehme, sind die Anerkennung und der Dank an die Verantwortlichen der DISK für die hervorragende Organisation dieses Kongresses und mein ge- wecktes Interesse an diesem Land – ich werde schon bald wieder- kommen.
Begegnung: Was wird bleiben?
Birgit Kleinert: „Nichts ist bestän- diger als der Wandel“, sagte He- raklit schon im Jahr 500 v. C.. Ver- änderung ist also keine Erfindung der Neuzeit, die Zyklen werden nur immer kürzer, dadurch ent- steht Beschleunigung. Das Deut- sche Auslandsschulwesen kann sich diesem Sog nicht entziehen, der Titel dieses Kongresses spricht da für sich. Ich hoffe und denke, dass die entstandenen Kontakte und Netzwerke zu und mit ande- ren Kollegen und Kolleginnen bleiben werden und in diesen Ent- wicklungsprozessen unterstützen.
Schon in der Vergangenheit ha- ben sie mich vereinzelt bei ver- schiedenen Fragestellungen durch
ihre Sichtweisen auf das Thema unterstützt, was ich sehr hilfreich fand. Wir können gegenseitig von unserem Know-how, unseren Er- fahrungen profitieren, das Rad muss nicht immer wieder neu er- funden werden. Bleiben wird auch meine Motivation für dieses Eh- renamt. Sie hat einen enormen Auftrieb erfahren. Es ist eine so lohnenswerte Aufgabe.
Von Offenheit, Argumen- ten und Begeisterung
Der Bundestagsabgeordnete Mark über den Weltkongress Begegnung: Mit welchen Erwar- tungen sind Sie nach Kapstadt ge- kommen?
Lothar Mark, Mitglied des Deut- schen Bundestages: Ich habe in meiner Eigenschaft als Mitglied des Auswärtigen Ausschusses schon viele Auslandsschulen kennen ge- lernt. Meine Kolleginnen und Kol- legen, von Hause aus bin ich Studi- endirektor, wollte ich wieder tref- fen. Dann ging es mir um die Posi- tionierung der deutschen Schulen im Ausland im Rahmen der Aus- wärtigen Kultur- und Bildungspoli- tik, die mir für meine Arbeit wei- tere Argumente liefern soll. Und nicht zuletzt ging es mir darum, Veränderungen im Bewusstsein der deutschen Auslandsschulen wahrzunehmen. Denn in den ver- gangenen Jahren habe ich sehr wohl einen Wandel gegenüber der
Sorgte am Abschlussabend für zuckende Hände und Füße: die Sonwabile Marimba Band der DISK.
D o ss ie r
Erwartungen, Mitbr ingsel und mehr
Politik gespürt – hin zu mehr Selbst- bewusstsein der gesamten Öffent- lichkeit, der Politik und anderen Mittlerorganisationen gegenüber.
Begegnung: Was nehmen Sie nun tatsächlich mit?
Lothar Mark: Es war für mich sehr ergiebig. Ich nehme viele neue Ideen und Überlegungen mit, die in die Beratungen zum Problem der Budgetierung in den Haus- haltsausschuss einfließen, mir aber auch bei meiner Arbeit im Aus- wärtigen Ausschuss helfen werden.
Gleichzeitig fühle ich mich für die Diskussionen und Auseinanderset- zungen mit dem Bundesfinanzmi- nisterium gestärkt. Daneben gibt es noch viele andere Dinge. Da wäre zum einen dieses gute Ge- fühl der Offenheit, die hier allen zueigen war. Ich habe das Ver- ständnis der Auslandsschulen für die Probleme der Politik in Deutsch- land genau so gespürt wie die Be- reitschaft, über gemeinsame Lö- sungen nachzudenken. Auf der an- deren Seite fühle ich mich in mei- nem Engagement bestätigt: Eine Aufstockung der Mittel für die Aus- landsschulen ist mittelfristig unab- dingbar, wenn in absehbarer Zu- kunft weitere deutsche Auslands- schulen entstehen sollen.
Begegnung: Was wird bleiben?
Lothar Mark: Viel von dem, was ich soeben schon nannte. Aber na- türlich kann und wird sich vieles ändern. Daran arbeite ich ja selbst.
Aber bleiben wird die Begeiste- rung für die deutschen Auslands- schulen. Denn je mehr von ihnen ich kennen lerne, umso mehr er- kenne ich deren Bedeutung. In meiner Aufklärungsarbeit in der deutschen Öffentlichkeit werde ich auf keinen Fall nachlassen, denn ich halte die deutschen Aus- landsschulen für eine rentierliche und nachhaltige Investition in die Zukunft Deutschlands.
R u br ik
D
eutschland kann die Bil- dungsdividende der Inves- titionen in die deutschen Auslandsschulen teilweise nicht einlösen, so eine der Thesen der Podiumsdiskussion „Der Studien- standort Deutschland“. Die durch- aus provokant formulierte Be- hauptung bezieht sich dabei we- niger auf die Auslandsschulen als Friedensstifter, als vielmehr auf den Gewinnanteil, der sich an der Anzahl ausländischer Studen- ten in Deutschland misst. Gerade viele der hervorragenden Schü- ler, so Dr. Kretzschmann (Schul- vorstand in Istanbul), gingen nach Ende ihrer Schulzeit zum Studium nicht nach Deutschland, sondern nach England oder in die USA. Eine Erfahrung, die viele im Hörsaal der Universität Kap- stadt gemacht haben, wenn mandem zustimmenden Raunen glauben will.
Dafür sind aber nicht nur das häu- fige Fehlen eines behüteten Cam- pus’ wie er in Deutschland kaum anzutreffen ist, verantwortlich, sondern auch viele andere Fakto-
ren. Zu denen gehörten bislang auch die Studienabschlüsse. Durch die Umstellung von Diplom und Staatsexamen auf Bachelor (BA) und Master, die bis 2009 abge- schlossen sein soll, fällt dieser Wettbewerbsnachteil weg, so dass es im Ausland auch einfacher wird, die deutsche Studienland- schaft zu vermitteln. „Unsere Ab- schlüsse werden damit weltweit vergleichbar. Jeder versteht, was ein BA, was ein MA ist, zumindest vom Etikett her. Das macht uns in- ternational wieder interessant“, so Professor Karl-Richard Bausch. Der Experte von der Universität Bo- chum, der dem ZfA-Beirat „Deutsch als Fremdsprache“ vorsitzt, ver- weist in diesem Zusammenhang auf den besonderen Glanz dieser Umstellung: Mit diesen gestuften Studiengängen geht eine rigorose Studienzeitverkürzung einher.
Problem: die unglaubliche Vielfalt der Schulabschlüsse weltweit
Doch es gibt andere Hürden. Dr.
Georg Krawietz, Experte für Studi- enberatung, versuchte in Kapstadt kurz zu analysieren, warum die Absolventen deutscher Schulen kaum im Fokus deutscher Hoch- schulen bzw. Universitäten stehen.
Dr. Georg Krawitz (am Mikrofon) überraschte bei der Podiumsdiskussion
„Der Studienstandort Deutschland“ mit seinen Thesen, auf die auch Dr.
Andreas Hettiger (vorn), DAAD-Vertreter in Johan- nesburg, einging.
D o ss ie r
Mehr Gewinn durch
Partnerschaft & Information
Der Studienstandort Deutschland –
aus Auslandsschulperspektive
R u br ik
Bislang, so Krawietz, hätten aus- ländische Studienanfänger für die deutschen Universitäten kaum eine Rolle gespielt. Das liege u.a.
an dem unglaublich vielfältigen System von Schulabschlüssen welt- weit, mit dem sie sich auseinan- dersetzen müssen. Bis heute hät- ten die Hochschulen Probleme mit der großen Zahl der Bewer- bungen. „Es wird verwaltet. Und das meist noch nicht einmal sehr gut“, so der Fachmann aus Köln.
Man habe Mühe mit der Quantität zurechtzukommen, so dass eine qualitative Auseinandersetzung die Ausnahme bleibe: „Das muss besonders die Absolventen deut- scher Auslandsschulen treffen, die die besten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Studium in Deutschland mitbringen.“
Absolventen deutscher Schulen sind Studienanfänger allererster Güte
Eine DAAD-Umfrage von 2004 hatte gezeigt, dass das Wissen um die besondere Güte der Absolven- ten deutscher Auslandsschulen bei Studienkollegs und Akademischen Auslandsämtern gleichermaßen gering ist. „Die grundständigen Studierenden müssen vielmehr in das Bewusstsein der deutschen
Hochschulen gebracht werden.
Wir brauchen eine Verknüpfung auf systemischer Ebene, denn die deutschen Hochschulen und Uni- versitäten müssen die deutschen
Auslandsschulen als eine Quelle für Studienanfänger allererster Güte erkennen“, schlägt der Ex- perte vor. Außerdem braucht es ein Partnerschaftssystem. Wenn jede deutsche Auslandsschule fünf bis sechs verschiedene Hochschul- partner hätte, gäbe es eine solide Vertrauensbasis, mit der sich auch terminliche Probleme wie Zeug- nisvergabe und Bewerbungster- min bilateral lösen ließen. „Auf diesem Wege könnte man jedem Absolventen, der sich für ein Stu- dium in Deutschland interessiert, ein Angebot machen und die Aus- bildungsleistung nachhaltig si- chern“, so Krawietz von der Ein- stieg GmbH.
Eine Aufklärung darüber, wer diese deutschen Auslandsschulen sind, was sie auszeichnet, wo ihr Gewinn gerade für deutsche Uni- versitäten liegt, scheint dringend geboten. In diesem Sinne forderte Rolf-Dieter Schnelle vom Auswärti- gen Amt: „Ihr nächster Kongress muss in Deutschland sein. Dazu müssen ausgewählte Hochschulen eingeladen werden.“
Carina Gräschke
Meldete sich auch aus dem Plenum zu Wort: Prof Dr. Claus Buhren, Sport- hochschule Köln.
D o ss ie r
Am Rande notiert
Umstellung auf BA- und Master-Studiengänge heißt für die Hochschulen, sich vom Humboldt-Konzept der Bildungsideale, von Einheit von Forschung und Lehre und der viel gepriesenen deut- schen akademischen Freiheit des Studiums verabschieden, so Pro- fessor Bausch von der Universität Bochum. Es gelte auch, sich von den wissenschaftsimmanenten Bildungsbegriffen zu trennen und sich zunehmend mit Studienkonzepten zu beschäftigen, die auf die lebensweltlichen Realitäten vorbereiten. „Wir befinden uns mittendrin in einem konzeptionellen kruxialen Veränderungspro- zess, insbesondere was die Lehre anbetrifft“, schätzt der Vorsit- zende des ZfA-Beirates für Deutsch als Fremdsprache die Lage ein.
Eine Chance für Hochschulen und Universitäten seien die ge- stuften Studiengänge, in denen sechs Semester für den Bachelor (BA) und weitere vier für den Master ausreichen müssen. Aller- dings äußerte sich Prof. Claus Buhren von der Universität skep- tisch, dass das alle Hochschulen umsetzen werden. „Wir sehen das am augenblicklichen Desaster bei den Lehramtsstudiengän- gen, wo die KMK beschlossen hat, wir erkennen alles an, was ir- gendwie ein Lehrabschluss im Bereich der Staatsexamina ist. Ich bezweifele, dass sich die 16 Bundesländer in den nächsten zehn Jahren auf eine einigermaßen vernünftige Lehrerausbildung ei- nigen werden“, skizziert Buhren ein offensichtliches Problem. Der Ländervorsitzende des BLAschA, Dr. Reinhard Köhler, rückt das Bild zurecht. Es liege nicht an den Bundesländern, sondern an der Autonomie der Hochschulen, dass keine Einigung erzielt werde. „Wir haben in Thüringen versucht, alle Hochschulen an einen Tisch zu bekommen, um über ein Kerncurriculum für die Lehrerbildung zu sprechen. Das ist abgelehnt worden – vonseiten der Hochschulen. Die Kultusbürokratie hat es sehr wohl versucht, weil wir glauben, dass es ein verlässliches Grundstudium und Kernstudium geben muss, damit ein Lehrer und die Vielfalt nicht zur Beliebigkeit werden“, erklärt Dr. Köhler. (cg)
R u br ik
Prof. Claus Buhren, Experte für Pädagogisches Qualitätsmanage- ment (PQM), hat die Instrumente von Seis+ (vgl. S. 24ff) vorgestellt.
Danach haben bis jetzt knapp 60 Auslandsschulen dieses Erhe- bungsinstrument für sich ent- deckt. Wenige Tage vor dem Welt- kongress hat er die kumulierten Seis+-Daten der teilnehmenden Schulen – insgesamt 770 Seiten – erhalten. Die Grundlage dafür bil- dete die Befragung von rund 10.000 Schülern, Eltern und Leh- rern, die diesen Daten durchaus repräsentativen Charakter für die Auslandsschulen verleihen. Die erste Auswertung stimme durch- aus hoffnungsfroh, so der Experte.
Demnach werde beispielsweise das Leistungsniveau von Eltern und Schülern noch höher einge- schätzt als von den Lehrern. Ein anderes Beispiel: Im Bereich der Fragen zum Qualitätsmanage-
ment gehe es viel um Leitbild und gemeinsame Vision. Wenn in die- sem Fall über 70 Prozent der El- tern und der entsprechenden Leh- rer sagen: An unserer Schule gibt es eine gemeinsame Vision, ein gemeinsames Leitbild, gemein- same Ziele, die wir verfol- gen und die uns bekannt sind, dann, so Prof. Buhren, sei das keine Aussage, die man als Sonntagsrede be- zeichnen kann, sondern sei Ausdruck für die Nachhal- tigkeit der Qualitätsbemü- hungen – ein deutlicher Er- folg des PQM.
Dr. Anton v. Walter, ehe- maliger Leiter der Deut- schen Schule Barcelona, jetzt Leiter des Studiensemi- nars Speyer in Rheinland- Pfalz, wies darauf hin, dass die Schulen sehr wohl als
Dienstleistungsunternehmen ver- standen werde müssen, dass aber im Zentrum dessen, was die Quali- tät einer Schule ausmache, der Un- terricht stehe. Erhebungen, wie die oben skizzierte, seien sehr ver- dienstvoll, weil sie Fakten lieferten, auf deren Basis sich gut begrün- dete Entscheidungen treffen lie- ßen, sagte er. Aber Unterricht sei etwas anderes als die quantitative
Praktiker und Theoretiker im Podium vereint – bei der Diskussion „Qualitäts- management, Schulent- wicklung und Zertifizierung“.
Letzte Abstimmung unter den Veranstaltern des 2. Weltkongresses: Jorge Pulido und Joachim Lauer (v.l.)
D o ss ie r
Qualitätsmanagement, Schulentwicklung
und Zertifizierung
Eine Podiumsdiskussion in Kürze
Die Zeit war knapp, das Thema heiß, das Podium mit Prof. Claus Buhren, Max Wachholz, Dr. Peter Janzen und Dr. Anton von Walter gut besetzt. Hier eine kurze Zusammenfassung:
R u br ik
Erhebung der Verwendungen ein- zelner Unterrichtsformen oder das Messen von Anteilen bestimmter Gesprächsformen. Unterricht sei ein ganzheitlicher, schwer zu be- schreibender Prozess. Da die 117 deutschen Auslandsschulen alle unterschiedlich seien (in Marktsi- tuation, Logistik, Ausstattung, In- frastruktur, Personalsituation etc.), müsse jede Schule für sich ein Kon- zept entwickeln, um sich vor Ort zu behaupten. Bei allen Unter- schieden steht aber die Frage nach dem Kern, nach dem Gemeinsa- men in dieser Firmenbezeichnung.
Und das, so v. Walter, könne nur der Unterricht sein – der spezifisch deutsche wissenschafts-, problem- und schülerorientierte Unterricht.
Aber die Lehrkräfte, die diesen Un- terricht anbieten können, gebe es bald nicht mehr.
Bund-Länder-Schulinspektion – Was kann eine systematische
Bund-Länder-Schulinspektion mit Vergabe des Gütesiegels „Quali- tätsschule der Bundesrepublik Deutschland“ zur Qualitätsent- wicklung beitragen?
Bis vor ca. 20 Jahren brauchte es für eine gute Schule nur Schulge- bäude, Lehrer, Schüler und Lehr- pläne, so Prof. Buhren. Erst in den 80er Jahren habe es eine fast ko- pernikanische Wende gegeben.
Heute müssten gute Schulen (1) sich systematisch selbst reflektie- ren (z. B. mit SEIS+). Sie bräuchten (2) externe Evaluation (vor dem Hintergrund klarer Parameter und mit einem Qualitätsrahmen, der vor allem den Unterricht in den Focus nimmt) sowie (3) eine In- spektion mit abschließender Zerti- fizierung (anhand eines entspre- chenden Qualitätskataloges und in Kontakt mit den jeweiligen Schu- len). Damit, so Buhren, gebe es die Chance, dass die Bund-Länder-In-
spektion sich als ein sehr mächti- ges Instrument zur Weiterquali- fizierung von Schulen bzw.
zur Qualitäts- sicherung und -entwicklung eta- blieren könnte.
Dr. Peter Janzen, Leiter der Deut- schen Schule Pu- ebla, betrachtete das Instrumen- tarium SEIS+, Peer Review,
Bund-Länder-Inspektion und Güte- siegel aus rein praktischer Pers- pektive. Seine Schule hatte bereits 2001 mit der Zertifizierung nach ISO 9000 begonnen. Darum herrschte erst die Sorge vor, dass SEIS+ einen ganz anderen Prozess des Qualitätsmanagements erfor- dere. Die große Erleichterung kam erst beim Durcharbeiten der SEIS- Unterlagen. „SEIS+ hat uns un- glaubliche Arbeit abgenommen.
Darin ist ein Indikatorenkatalog angelegt, den wir sonst hätten sel- ber beschreiben müssen“, so Jan- zen. Jetzt hat die DS Puebla SEIS+
implementiert (vgl. S. 25ff).
Das viergliedrige Instrumenta- rium beschreibt dabei eine Teil- menge der Fragen, die gebraucht würden, um Wettbewerbsfähig- keit herzustellen – nicht aber alle wichtigen Aspekte. „Es wäre schön, wenn wir auf dem Bildungsmarkt ein «Made in Germany» hätten.
Aber solange wir dort in Pisa ste- hen, wo Deutschland heute steht, ist das ein bisschen schwer zu ver- markten“, so der Schulleiter. Dr.
Janzen zweifelt an, dass die Instru- mente von interner Evaluation bis zur Bund-Länder-Inspektion dazu geeignet sind, den Prozess der Schulentwicklung voranzutreiben.
Denn es gehe nur um das Messen, die Analyse und die Bewertung, aber der ganze Bereich der Umset- zung nach der Evaluation, das Handwerkszeug fehle hier. „Schul- entwicklung ist kein Messprojekt.
Schulentwicklung ist Change- Projekt“, schließt der Praktiker.
(cg)
Lebhafte Diskussionen draußen wie drinnen
Südafrikanisches Ambi- ente am Abend: Die Bun- destagsabgeordnete Monika Griefahn wird zünftig bemalt.