Mit einer Analyse der okzitanischen Urkundensprache und der Graphie.
Volltext
Abbildung
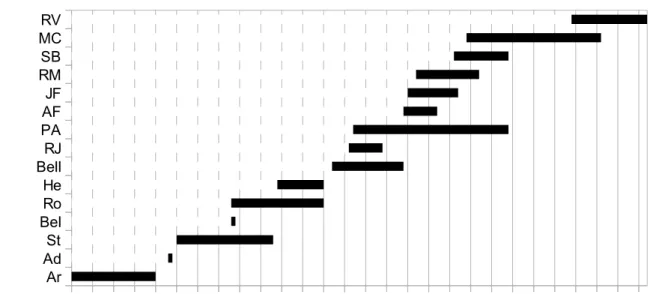
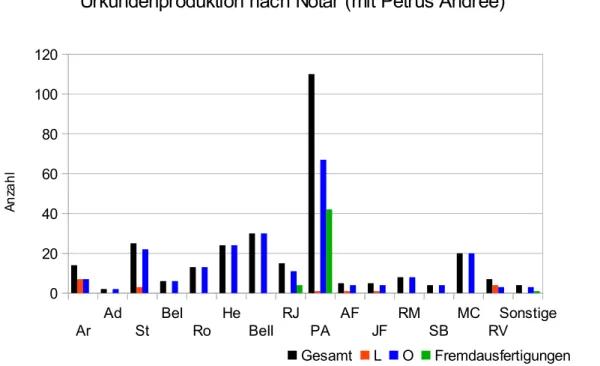
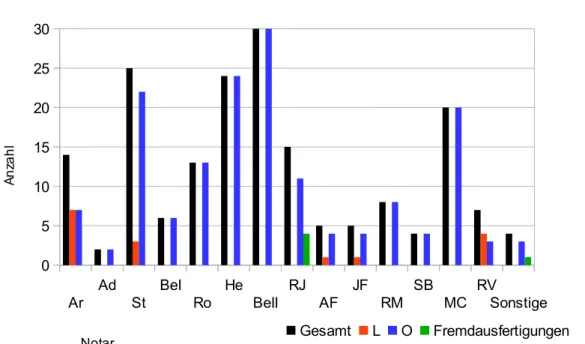
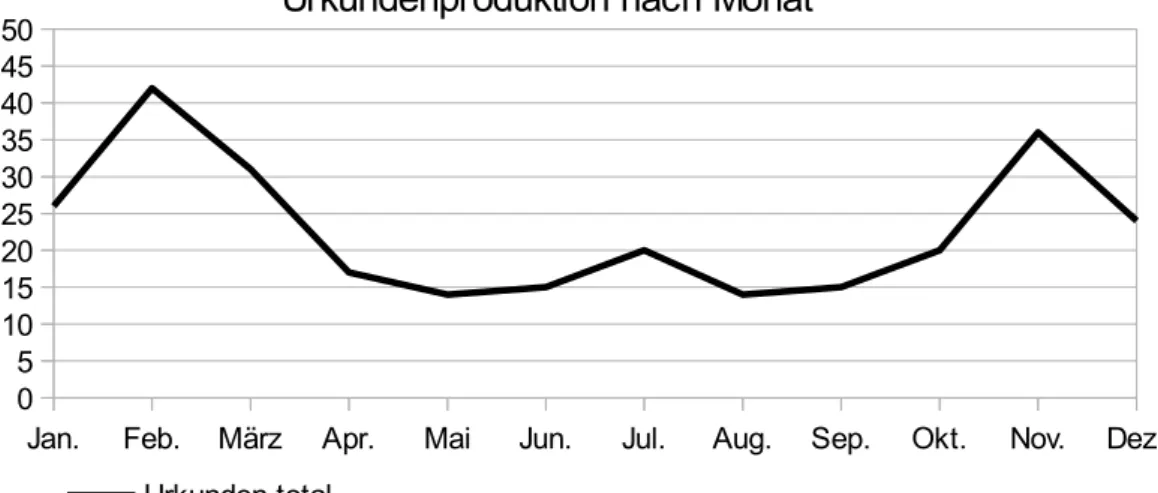
ÄHNLICHE DOKUMENTE
• verwendet wird das Supinum I zur Umschreibung des Infinitivs Futur Passiv (vgl. das Material zum Futur) sowie nach Verben des Bewegens (ire, venire...) und des
Diese Kritik an der Organisation des Qualitätsmanagements darf aber nicht da- rüber hinwegtäuschen, dass Monasterium.net als Plattform für die Darbietung von Digitalisaten
170 Darüber hinaus ist von maßgeblicher Bedeutung, dass in der SapSal die Liebe zur δικαιοσύνη und das Einhalten des νόμος als Voraussetzungen für das Erlangen
gemeinsam, bezeichnet aber den Anfang und nicht den Abschluß der Referenzsituation und steht daher links von ante; (3) sicoex ist links ad- jazent zu siover wegen der
Für ein erstes Digitalisierungsprojekt wurde mit „Z 1. Anhaltisches Gesamtarchiv“ ein zentraler Bestand des Standortes Dessau ausgewählt. Dieser vereinigt die Überlieferung
Die ornamentale Ausstattung päpstlicher Litterae cum serico (darunter auch Ablassbriefe) nimmt teilweise in den letzten Jahrzehnten des 13. und zu Beginn des 14. ein ziemlich
Jahrhunderts, ist aber bezeichnenderweise bei der Abschrift dieses Abschnitts in das eben erwähnte Stadtrecht, um 1510, überall durch die Form G ö n st a r t ersetzt worden,
er komme / käme er sei / wäre gekommen er werde / würde kommen er sehe / sähe er habe / hätte gesehen er werde / würde sehen er höre /hörte er habe / hätte gehört