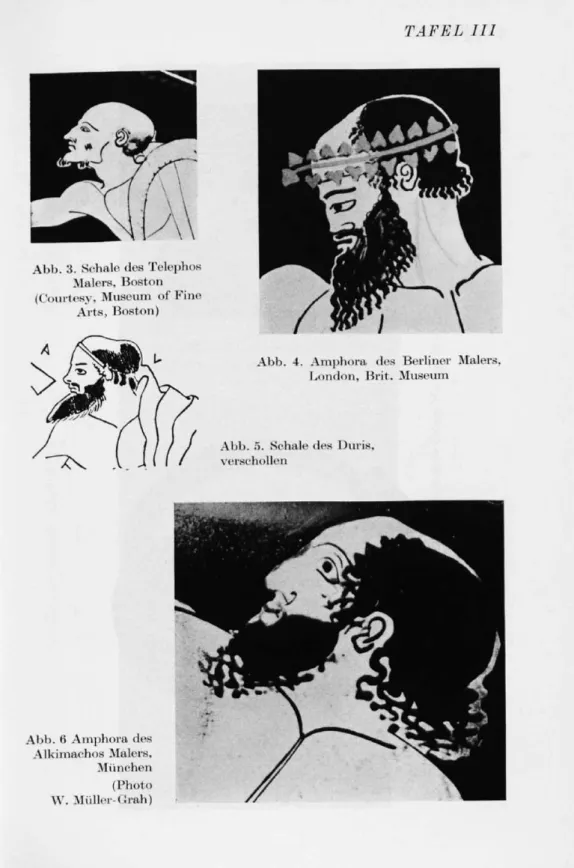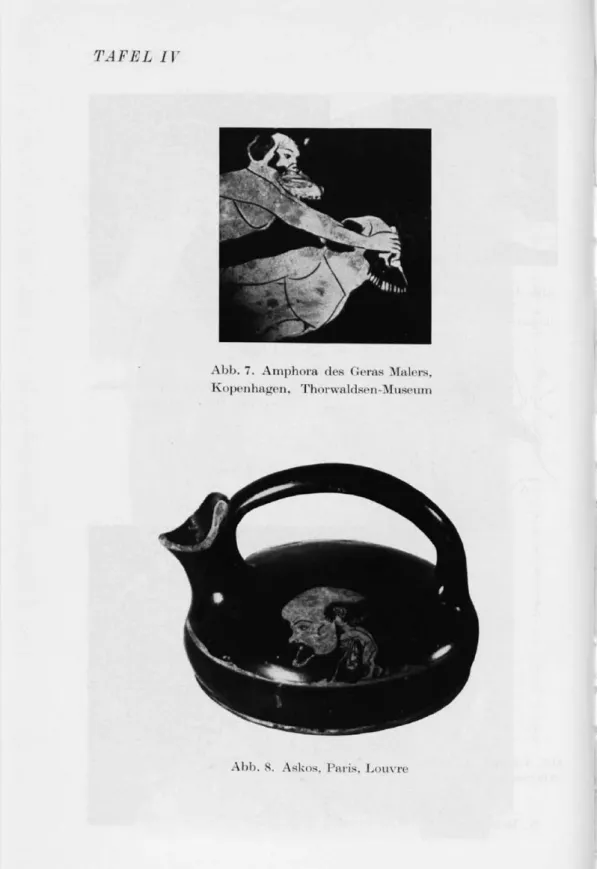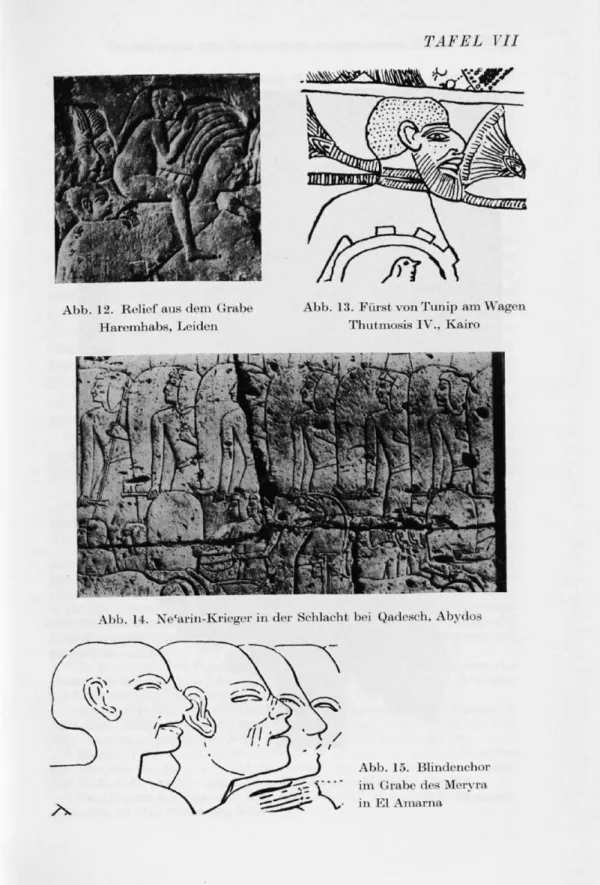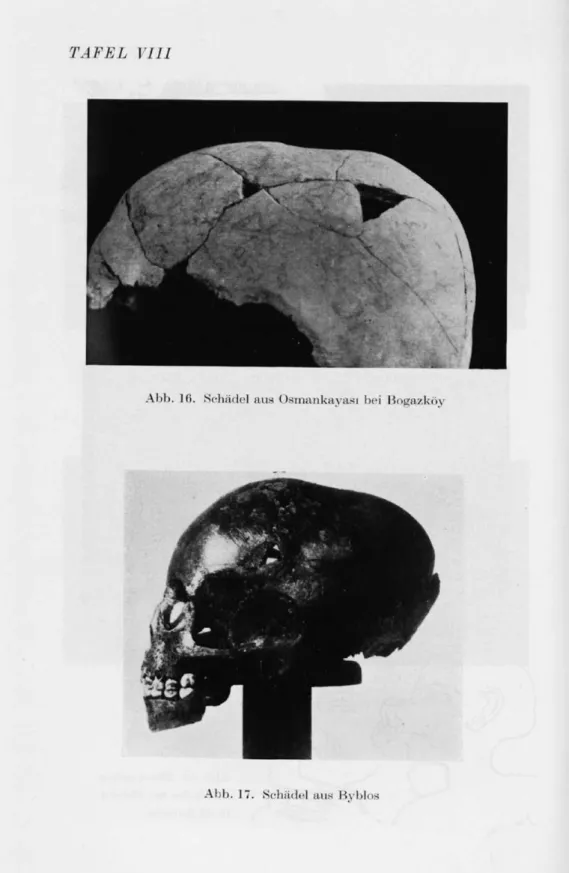Darstellungen
von Vorderasiaten auf griechischen Vasen^
Von Ludwig Schnitzlee, Freiburg i. Br.
Im ersten Drittel des 5. Jahrhunderts v. Chr., im Zeitraum der Über¬
windung der Archaik und des Aufstiegs der Klassik durch die Griechen
entstanden in athenischen Töpfereien Gefäße, deren rotfigurige Bilder
für die Ethnographie des Alten Orients von besonderer Wichtigkeit sind.
Sie werden Malern verdankt, die bestrebt waren, Vertreter vorder¬
asiatischer Völkerschaften, welche sie mit eigenen Augen gesehen hatten,
in bildnisähnlicher Form festzuhalten. Dabei legten sie das Schwer¬
gewicht ganz auf die physiognomische Erscheinung und nicht auf die
Wiedergabe der Tracht. Das Interesse für somatische Charakteristika
ist beachtlich. Es lag im Geist der damahgen Zeit, deren Geschlecht den
epochalen Schritt von der statisch-vorstelligen zur dynamisch-wahr¬
nehmigen, vornehmlich auf Beobachtungen beruhenden Gestaltungs¬
weise vollzogt, und auch um die individuelle Erfassung der seelischen
und körperlichen Eigenschaften der zum Vorwurf genommenen Persön¬
lichkeit bemüht war, wie es z. B. das höchst realistisch gehaltene, um
470 geschaffene Porträt des Themistokles lehrt*.
Zeitlich steht unter den Vasenbildern die Schale des Töpfers Hegesi-
boulos (Abb. 1—2)* an der Spitze; sie entstand am Beginn des 5. Jahr-
* Herr Prof. J. Schaeuble gab für unsere Darlegungen Anregungen und
förderte sie durch stets bereitwillig erteilte Auskünfte und Belehnmgen in
anthropologischen Fragen. Ebenso stellte er die bisher nur in einem knappen
Bericht publizierten Ergebnisse seiner mehrfach erwähnten Forschungen
(Homo 5, 2.—4. Heft 1954; die endgültige Veröffentlichung ist in den
WVDOG. vorgesehen) für die Ausarbeitimg der vorliegenden Abhandlung
großzügig zur Verfügung. Für alle diese Liebenswürdigkeiten dankt ihm
herzlich der Verfasser.
" Darüber grundlegend H. Schäfeb, Von ägyptischer Kunst (3. Aufl. 1930);
Die Kunst des Alten Orients (Propyläen Kunstgeschichte Bd. 2, 4. Aufl. 1942);
Jahrb. des Deutschen Archäolog. Inst. 57, 1942, 158ff. ; Leben, Ewigkeit und
ägyptische Kunst (Nachr. Akademie Göttingen, phil.-hist. Kl. 1944 Nr. 5).
3 G. Calza, Le Arti 2, 1940, 152ff., Taf 60; B. Schweitzer, Antike 17,
1941, 77—81, Abb. 1—4; L. Curtius, Römische Mitteilungen 57, 1942, 78ff.
Taf. 5.
«New York 07.286.47; G. M. A. Richter-L. F. Hall, Red-figured Athe¬
nian Vases in the Metropolitan Museum of Art Nr. 10, Taf. 9—10; 179;
A. Furtwängler-K. Reichhold, Griechische Vasenmalerei II, Taf. 93,2;
E. Pfuhl, Malerei und Zeichnung der Griechen III Abb. 340—41; J. D.
Beazley, Attic Red-figured Vase-painters, 77.
Darstellungen von Vorderasiaten auf griechischen Vasen 55
hunderts. Der nach dem Töpfer genannte Hegesihoulos-Maler, dem kein
weiteres Werk zugeschrieben werden kann*, hinterheß uns auf dem
Gefäß in New York eine Arbeit, die thematisch eine Sonderstellung unter
den griechischen Vasenbildern einnimmt. Während auf seiner Außenseite
ein konventionelles Thema (Abb. 2), Zecher und Hetären, das Feld
beherrschen, begegnen wir im Innenbild einem bärtigen Mann in Be¬
gleitung eines Hundes. Auf seinem Hals, bei dem der Adamsapfel oder
gar ein Kropf hervortritt, sitzt ein gänzlich ungriechischer Kopf, der den
Mann, wie man schon längst erkannte^, als Orientalen kennzeichnet. Und
auch einige Figuren der Außenbilder* besitzen eindeutig orientalische
Köpfe. Eine so äußerst scharf und individuell gezeichnete Darstellung
eines Fremdländers ist innerhalb der attischen Vasenmalerei nicht häufig.
Sie ist umso erstaunlicher und anerkennenswerter, weil hier allem An¬
schein nach ein besonders eigentümlicher Menschenschlag des Ostens
wiedergegeben wurde. A. Fübtwänolee, der sich als erster eingehend
mit dieser Gestalt beschäftigte, und sie für das Abbild eines Phönikers
oder Hebräers hält, bemerkt u. a. ,,auch der Umriß des Schädels ist von
dem der normalen griechischen Köpfe verschieden"*. In der Tat, die
Kontur der Schädelkalotte weist bei dem Bregma eine deutliche Ein¬
sattelung auf. Diese ist mit allem Nachdruck vom Maler gezeichnet
worden, wie es die helle Farblinie, die den ganzen Schädel vom dunklen
Hintergrund markant abhebt und außerdem die bereits durch die
kontrastreiche Behandlung des Gesichtes und Haares hervorgerufene
plastische Wirkung des Kopfes erhöht, beweist. Ihr Vorhandensein
schließt die Annahme, diese Einsattelung könnte durch eine Verzeich-
mmg oder durch eine unsaubere Aussparung des Schädelumrisses ent¬
standen sein, aus. Auch handelt es sich nicht um eine Wellung im Haar,
erzeugt von einer Binde^ oder einem Kranz. Letzterer ziert wohl den
* Die weißgrundige Schale A 891 im Musee Royal zu Brüssel (Corpus Vas.
Antiq. Illd — III Jb Taf. 1,2; Fubtwänglbr-Rbichhold a. O. 181 Abb. 61;
Beazley a. O. ibd.) mit einer Hegesiboulos-Signatm läßt sich nioht mit ihr
verbinden. Sie wurde erst um 475 geschaffen. Auch ist es fraglich, ob ihr
Töpfer mit dem der älteren Schale identisch ist. Erklärungen für das Auftreten ein und desselben Töpfer- aber auch Malernamens auf zeitlich auseinander¬
liegenden Gefäßen gibt Beazley, Potter and painter in ancient Athena, 39ff.
2 FuBTWÄNGLEB a. O. 179; Pfuhl a. O. I 421; Richteb a. O. 25; diess.
Attic Red-figured Vases, 52.
' FuBTWÄNGLEB ibd. : „... die Figuren dieser Außenseiten zeigen Köpfe
von merkwürdig individuellem Gepräge". Am Komosfries (Abb. 2) die links und rechts außen laufenden Figuren ; beim Gelage die rechts sitzende Hetäre.
Unter griechischen Zechern ausländische Gesichter zu finden, ist gewiß über¬
raschend, findet aber im Werk des Berliner Malers eine Entsprechung (s.
S. 57). « ibd.
' Z. B. bei einem Athleten auf einem Kolon nettenkrater unter italischer
Herkimft aus dem späten 5. Jahrhundert, Not. d. Scavi 1917, 110.
56 Ludwig Schnitzleb
Kopf, doch sitzt er vor der Eindellung und ist, wie eine genaue Beob¬
achtung dieser Stelle lehrt*, oben offen . Auch kann es sich nicht um eine
natürliche Haarwelle handeln, da die Haare strähnig und in einzelnen
dünnen Strängen herabhängend wiedergegeben sind. Es ist hier also keine
äußerliche, jederzeit vergängliche Erscheinung gemeint, sondern ein auf¬
fallendes, keiner Veränderung unterworfenes anatomisches Merkmal des
Schädels. Die Richtigkeit unserer Interpretation erfährt durch eine ge¬
wisse Anzahl von Parallelen auf Vasenbildern^ ihre Bestätigung. Der
Mehrzahl der nun zu betrachtenden Beispiele fällt eine gewichtige Rolle
zu, da hier Darstellungen von Kahlköpfigen vorliegen. Außerdem handelt
es sich in der Regel um ungriechische, so gut wie ausschließlich um vorder¬
asiatische Physiognomien.
Dem Telephos-Maler gelang zwischen 480—70 die vortreffliche Studie
eines aus dem Osten stammenden alten Sklaven, der mit einem Sack
beladen, gebrechlich hinter seinem Herrn dahinschlurft (Ahb. 3)*. Auf
seinem kahlen Kopf findet sich an dem gleichen Punkt wie bei dem vorhin
betrachteten eine Einsenkung. Diese ist zwar nicht so tief wie diejenige
des Mannes auf der Hegesiboulos-Schale, die ihre Intensität der breit
gezogenen Konturlinie verdankt, läßt sich aber dennoch nicht übersehen.
Die sichere und saubere Ausführung schließt die Annahme einer Ver¬
zeichnung aus. Dazu kommt, daß, wie noch andere Bilder lehren, der
Telephos-Maler eine ausgesprochene Neigung zur Wiedergabe von Cha¬
rakterköpfen besaß*. Es besteht kein Anlaß den Sklaven als Skythen
zu bezeichnen^, zumal alle auf uns gekommenen Skythendarstellungen
* Miss Dr. Christine Alexander teilte dazu freundlichst ihre Feststel¬
lungen mit: ,,The man .... wears a wreath with midrib and leaves as in
Reichholds drawing" (Taf 93,2).
" Die bier gegebene Zusammenstellung erhebt in Anbetracht des zahl¬
reichen, zum Teil schwer zugänglichen Materials keinen Anspruch auf Voll¬
ständigkeit.
" Boston 95.28; E. Petersen, Jahrb. des Deutschen Archäolog. Inst. 32,
1917, Beil. zu S. 137; Pfuhl a. O. Abb. 449; L. Deubneb, Attische Feste,
Taf. 24. E.Bielefeld, Zur griechischen Vasenmalerei des 6. — 4. Jahrhunderts V. Chr., Taf. 11; G. Becatti, Archeologia Classica 4, 1952, Taf. 33; 35. Die
Deutung Petersens im Bilde eine Wiedergabe eines Festes zur Erinnerung
an die Eroberung von Salamis durch die Athener unter Solons Führung zu
sehen, fand bis vor kurzem allgemeine Zustimmung. Erst Becatti a. O.
162ff. erhob Widerspruch, der in ihm die Rückkehr des Kephalos siebt.
Bielefeld, a. O. 10, hält es für unerklärlich. Die Abbildungsvorlage wird
der Freundlichkeit H. Palmers verdankt. Beazley a. O. 542, Nr. 1.
* Bielefeld, Würzburger Jahrb. f. d. Altertumswissenschaft 2, 1947,
358. Zur geistigen und künstlerischen Situation schon Franz Studniczka, Zeitschr. f. bildende Kxmst 62, 1928/29, 121ff.
' Sie geht auf Petersen a. O. 138, und P. Hartwig, Die griechischen
Meisterschalen der Blütezeit des strengen rotflgurligen Stiles, 438, zurück.
TAFEL I
Abb. 1. Schale des Hegesiboulos, New York
(rourtesy, Metro|)olitan Museum, New York)
TAFEL III
TAFEL IV
Abb. 8. Askos. Paris, l.ouvre
TAFEL V
TAFEL VII
Abb. 12. Relief aus dem Grabe Abb. 13. Fürst von Tunip am Wagen
Haremhabs, Leiden Thutmosis IV., Kairo
Abb. 14. Ne'arin-Krieger in der Schlacht bei Qadesch, Abydos
Abb. 15. Blindenchor im Grabe des Meryra in El Amarna
TAFEL VIII
Abb. 17. Schädel aus Bybios
Darstellungen von Vorderasiaten auf griechischen Vasen 57
andere Menschentjrpen wiedergeben*. Wir erkennen in ihm mit Becatti^
einen Orientalen. Dafür sprechen außer der Einmuldung vor dem Bregma
der Wulst über der Nasenwurzel*, der dickliche Hals und die fleischigen,
vorgeschobenen Lippen. Diese Eigenarten lassen sich auch bei dem Alten
des Hegesiboulos-Malers feststellen. Weitere Ähnlichkeiten bestehen aber
nicht. Beide stellen vielmehr rassisch gesehen, zwei wenig verwandte
Individuen dar. Das Vorhandensein der eingemuldeten Scheitellinie bei
sonst verschieden gearteten Naturen ist bedeutsam und verdient beson¬
ders beachtet zu werden (dazu s. S. 60, 63).
Ein vom Berliner Maler um 490 geschaffener Zecher weist dieselbe
Kopfbildung auf (Abb. 4)*. Er zieht durch die Straßen Athens. Aber es
begegnet uns kein hellenischer, sondern ein wohl orientalischer Tjrp. Ein
markant geschnittenes Profil mit höckriger Nase und einem scharf vor¬
springenden Wulst zwischen den Augenbrauen verleiht diesem Kopf
seinen besonderen Reiz, der durch die Eintiefung der Scheitellinie noch
erhöht wird. Auch dieser Darstellung können wir volles Vertrauen
schenken, da ihr Schöpfer ein scharfes Auge für Fremdländer besaß.
Dies bezeugt das Bild eines anderen ,, Barbaren"^, der, wie BEAZi;Ey
sah*, eine unleugbare Verwandtschaft mit den von F. Hauser' als
Agathyrsen erklärten Exoten auf einer Schale in Orvieto besitzt.
Die Londoner Amphora und die New Yorker Schale veranschaulichen
in deutlicher Weise die ständige Anwesenheit von Menschen aus dem
Osten in Athen und an allen, vornehmlich an der Küste gelegenen Plätzen
* Nachweise bei E. H. Minns, Skythians and Greeks und bei M. Rostovt¬
zeff, Iranians and Greeks in South Russia. Auch H. B. Walters, History
of ancient Pottery II, 179, bringt einige Beispiele.
Der Skythe in der um 200 entstandenen hellenistischen Gruppe mit
Marsyas (Florenz, W. H. Schuchhardt, Die Kunst der Griechen Abb. 366 und
368), sicherlich die ethnologisch verläßlichste Wiedergabe eines Skythen läßt
mit unserem Alten kaum einen Vergleich zu, wie es Hartwig, a. O. 437, Anm.
2, tat (Er verweist aber dabei auch auf , .einige Porträts der Mischlingsrasse
aus den Gräbern von El-Fajum".) Lediglich der spärliche Bartwuchs und
in entfernterem Sinne die Nase können als beiden gemeinsame Elemente an¬
gesprochen werden. " a. O. 165.
^ Er wird auch fast dmchgängig bei den ägyptischen Darstellungen dea
Neuen Reiches von orientalischen Völkerschaften wiedergegeben (Beispiele
bei Flinders Petrie, Racial Types from Egypt, 1887).
* Amphora E 266 des Britischen Museums; Journal of Hellenic Studies 31,
1911, Taf 11 (danach unsere Abbildimg) ; Corpus Vas. Antiq. III Ic Taf. 8.3;
12a; Beazley, Der Berliner Maler, Taf. 14 rechts; a. O. 133, Nr. 21.
^ Fragment Athen, Akropolis G 251; E. Langlotz, Die antiken Vasen von
der Akropolis zu Athen II., Taf. 64, 702a; Beazley, Der Berliner Maler,
Taf. 13,3; a. O. 143, Nr. 195. « Der Berliner Maler 21, Nr. 202.
' Fr. Hauser bei Hartwig, a. O. 422ff., zu Taf. 38 und 39, 1; Beazley, a. O. 575, Nr. 11 (Pistoxenos-Maler).
i m
58 Ludwig Schnitzleb
der griecliischen Oikomene*. Diesen als Metöken oder Sklaven in der
Diaspora lebenden oder als Kaufleute und Seefahrer Reisen unter¬
nehmenden Leuten aus dem Orient werden in allererster Linie die Dar¬
stellungen ihres Menschenschlages auf griechischen Gefäßen verdankt,
da abgesehen von den aus lonien^ oder direkt aus Asien stammenden,
wie Lydos und Skythes die allerwenigsten Vasenmaler* der Osten und
seine Völkerwelt aus unmittelbarer Anschauung bekannt war.
Einige Vasenmaler übertrugen diese absonderliche Schädelform auch
auf mythologische Wesen. Sie wollten mit ihr deren dämonische Natur
* Darüber s. Jacob Bubckhabdt, Griechische Kulturgeschichte I 144ff.
(Gesamtausgabe von F. Stähelin, 1930); J. Hasebboek, Staat und Handel
im alten Griechenland, 2 Iff.; 42ff. ; Griechische Wirtschafts- und Gesellschafts¬
geschichte, 266ff. ; F. Schachebmeyb, Indogermanen und Orient, a. O. 75 u. ö.
In diesem Zusammenhang muß auch das Buch Joel 4,6 erwähnt werden, in
welchem der Verkauf von Juden als Sklaven an Griechen zur Sprache
kommt. Diese Stelle wird mit anderen Argumenten als Beweismittel für die
Spätdatierung des Joel-Textes herangezogen. Nach der Entdeckung der
protogeometrischen Funde von al-Mina an der Orontesmündung und Abu
Hawan in Palästina, die für das Bestehen von griechischen Faktoreien an
diesen Punkten während des frühen 1. Jahrtausends sprechen, hat sie an
Beweiskraft verloren.
' Es ist möglich, daß der Maler der besprochenen New Yorker Schale von
dort herkommt. Sein etwas weicher und eigenwilliger Stil, den man früher
mit Skythes verband, ließe sich mit ionischer Manier vereinbaren. Sollte er
mit dem Töpfer identisch sein, wofür es in der griechischen Keramik genügend Parallelen gibt, dann wäre ein weiterer Hinweis auf die ionische Abstammung gegeben, da der Name Hegesiboulos bis jetzt nur in lonien nachgewiesen ist.
Der Vater des Anaxagoras, ein Klazomenier, hieß ebenfalls Hegesiboulos
(W. Pape, Wörterbuch der griechischen Eigennamen, 452, s. v. Hegesiboulos).
' Der Meister der bekannten Hydria mit der Schilderung des Herakles¬
abenteuers bei Busiris (Furtwängleb-Reichhold a. O. Taf. 51,2; Pfuhl
a. O. III Abb. 152—53; E. Buschoe, Griechische Vasen, Abb. 112) mag zu
ihnen gehört haben (so F. Matz, Archäolog. Anzeiger 1921, Sp. 12. „Die
wohlgetroffenen Physiognomien der Ägypter und die Tracht" müssen je¬
doch kein Beweis für .eigene Anschauung in Ägypten' sein. Diese war
genauso daheim zu gewinnen, wenn ägyptische Händler oder Sklaven sich in
der Stadt aufhielten), vorausgesetzt, er sah das Motiv des bündelweise seine
Widersacher erschlagenden Herakles, das auf den in gleicher Weise mit
seinen Feinden verfahrenden Pharao auf ägyptischen Reliefs zurückgeht,
nicht in einem imter ägyptischen Anregungen entstandenen Gemäldes eines
Griechen. Darüber vermag ein in einer unteritalischen Werkstatt, die korin¬
thische Erzeugnisse nachahmte, etwa im dritten Viertel des 6. Jahrhunderts
entstandener Aryballos eine gewisse Vorstellung geben (Paris, Bibl. Nat.
Corpus Vasorum Antiquorum III Cb Taf. 18, 1—7; Text S. 15 nach Jahrb.
des Deutschen Archäolog. Inst. 7, 1892, Taf. 2). Auf ihm ist die Iliupersis in
ägjqDtischer Streifenkomposition wiedergeben (F. Dimmleb, Archäolog. An¬
zeiger 1892, Sp. 75. Zu den ägyptischen Amegungen s. auch E. Buschor,
Münchner Jahrb. d. bildenden Kunst 11, 1919, 34 und P. Jacobsthal,
Archäolog. Anzeiger 1928, Sp. 77ff.).
Darstellungen von Vorderasiaten auf griechischen Vasen 59
besonders hervorheben, wie es Duris, der Alkimachos- und der Geras¬
maler taten. Auf einer verschollenen, in Nachzeichnungen bekannten
Schale des zuerst genannten Meisters finden wir an Syleus' kahlem Kopf
eine Einsenkung im Bregmagebiet (Abb. 5)*. Er kann nicht ohne weiteres
als orientalischer Typ bezeichnet werden, aber auch nicht als ideal grie¬
chischer auf Grund der derben Nase mit klobiger Spitze. Beim Prokrustes
des Alkimachos-Malers (Abb. 6)^, der wiederum einen vorderasiatischen
Gesichtsschnitt besitzt, wollte der Künstler nach den Spuren der Vor¬
zeichnung zu urteilen, ursprünglich einen normal gebauten Schädel
wiedergeben und entschloß sich erst hei der endgültigen Fassung des
Bildes zu einer Deformierung, die auch die Stirn ergriff. Ebenso erhielt
die Nase erst im letzten Stadium der Ausarbeitung ihre Hakenform. Der
Geras-Maler (Abb. 7)* verlieh Satyrköpfen eine Eindellung.
Das jüngste Beispiel aus der griechischen Vasenmalerei ist proble¬
matischer Art. Ein unbekannter Maler schuf gegen Ende des 5. Jahr¬
hunderts auf einem Askos-Kännchen (Abb. 8)* einen gnomenhaften Mann
mit riesigem Kopf. Über der stark ausgeheulten Stirn ist die Scheitellinie
ein wenig eingebuchtet. Ein vorsätzliches Abweichen von der konkaven
Schädelform dürfte vorliegen. Es entsprang aber eher dem Bestreben die
groteske Note der Figur zu erhöhen, als mit ihr eine anatomische Be¬
sonderheit festzuhalten.
Die betrachteten Gefäße erbringen den Nachweis, daß zur Zeit ihrer
Entstehung in Vorderasien eine Volksschicht existierte, deren Glieder
rassisch ein unhomogene, durch ihre eingesattelte Scheitellinie aber doch
eine Art genetische Einheit bildeten. Leider wird auf ihnen weder durch
die Tracht noch durch Beischriften ein Hinweis auf deren Heimat
gegeben.
Diese wichtige Frage müßte offen bleiben, wenn uns nicht noch das
ägyptische Bildmaterial aus der 18. und 19. Dynastie zur Verfügung
stünde. Neben dem Nachweis der Wohnsitze gibt es auch Aufschluß über
ihre Geschichte und ergänzt und bestätigt die Beobachtungen der grie¬
chischen Zeichner. Von diesen sind die Reliefs aus dem Grabe Haremhabs
* Zeichnung im Gerhardschen Apparat in Berlin ; abgebildet mit freund¬
licher Erlaubnis der Direktion der Staatl. Museen zu Berlin. Archäolog.
Zeitung 1861, Taf. 149; Jahrb. d. Deutschen Archäolog. Inst. 59/60, 1944/45,
74; Beazley, Attic Red-figured Vase-painters 281, Nr. 24.
* Halsamphora München 2325, Corpus Vas. Antiq. Taf. 58, 1; Beazley
a. O. 356, Nr. 16.
'Amphora Kopenhagen, Thorwaldsen Museum 99; Die Antike 6, 1930,
Taf. 20; Beazley a. O. 175, Nr. 19. Abbildung nach einer Museumsphoto-
graphie.
* Louvre G 610; E. Pottieb, Vases antiques du Louvre III, Taf. 157. Hier
abgebildet nach einer von den Herren Direktoren der Antikenabteilung des
Louvre freundlich zur Verfügung gestellten Neuaufnahme.
eo Ludwig Schnitzleb
(Abb. 9—12)* die wichtigsten. Unter den Scharen von Gefangenen, die
Haremhab dem König vorführt, bewegen sich dieselben Gestalten, die
fast 1000 Jahre später das Interesse der griechischen Vasenmaler wach¬
riefen. Selbst ein nur flüchtiger Vergleich schließt jeden Zweifel an der
ethnischen Wesenseinheit der von hellenischen und ägyptischen Künst¬
lern mit gleichem Scharfblick festgehaltenen Menschen aus. Die wich¬
tigste Übereinstimmung ist das Auftreten von zwei rassisch nicht gleichen
Typen — der eine mit feistem, fast speckigem Nacken, gekrümmter Nase
und korpulentem Körper (Abb. 10 rechts), der andere allem Anschein
nach feiner und elastischer gebaut mit geradliniger, spitzer Nase und
hagerem Gesicht (Abb. 10 links; Abb. 11 links)^ — beiden ist aber die
Einsattelung am Schädel gemeinsam. Aueh bei einem zopftragenden
Kind zeigt sich diese deutlich ausgeprägt (Abb. 12). Dieselbe Haartracht
besitzt auch der Sohn eines im Grabe Mencheperre-senb, der im Dienste
Thutmosis III. stand, dargestellten Fürsten von Tunip*. Damit ist uns
ein fester Anhaltspunkt für die engere geographische und politische Ein¬
ordnung dieses Volkstums gegeben, dessen Vertreter auf den Flach¬
skulpturen aus dem Grabe Haremhabs auch als Einwohner Kanaans
bezeichnet wurden*. Diese Benennung läßt sich durch das Alte Testament
rechtfertigen, das an verschiedenen Stellen^ von Hethitern berichtet, die
zusammen mit anderen Völkern das Land Kanaan bewohnen. Daß es
sich bei dem uns interessierenden Menschenschlag um ein der engeren
hethitisch-syrischen Sphäre angehörendes Element handeln muß, geht
eindeutig aus weiteren Belegen der ägyptischen Kunst hervor. Von ihnen
ist das älteste Dokument eine Darstellung am Wagen Thutmosis IV.
(Abb. 13)*. An der Innenwand sind Fürsten namentlich genannter feind-
1 Leiden 40, P. A. A. Boeseb, Beschreibung der ägyptischen Sammlung dea
niederländischen Reichsmuseum der Altertümer in Leiden IV, Taf. 21 und 24;
G. Steindoeff, Die Kunst der Ägypter 246—247; K. Lange, Ägyptische
Kunst 110— III ; H. Schäfeb, Die Kunst des Alten Orients (Propyläen Kunst¬
geschichte Bd. 2, 4. Aufl. 1942), Abb. 383 (Bärtiger rechts stehend). Sie
fehlen bei Flindees Peteie a. O. Die Abbildungsvorlagen wurden in freund¬
licher Weise von der Museumsdirektion zur Verfügung gestellt.
^ Eine bestimmte rassenkundliche Benennung ist schwer vorzunehmen ;
s. J. Schaeuble a. O. 186 (138).
^Theben Grab 86; W. M. Mülleb, Egyptological Researches II (1910)
Taf. 8; W. Weeszinski, Atlas zur altägyptischen Kulturgeschichte I, Taf. 274
oberster Streifen (Mitte); G. Roedeb, Ägypter und Hethiter (AO. 20, 1919)
Abb. 4.
* Ed. Meyeb, Oesch. d. Alt. II, 1 (2. Aufl.) 404f.; H. E. Stieb, Die neue Propyläen Weltgeschichte I S. 159.
' Z. B. 1. Mose 15,20; 23,5; 2. Mose 3,8; 3,17; Josua 3, 10; 1. Könige 9, 20.
Weitere Belege bei A. Alt, Volker und Staaten Syriens im frühen Altertum
(AO. 34, Heft 4, 1936), 21 f.
• Kairo; nach Wbeszinski, a. O. II Taf. 3.
Darstellungen von Vorderasiaten auf griechischen Vasen 61
licher Völker mit Kopf und Oberleib, aufgesetzt auf einem Inschriftenoval
skizziert. Unter diesen befindet sich der ,, Fürst von Tunip", dessen
,, kahlgeschorener, flacher, langer Schädel, vor dem Scheitel eingebeult"
(Weeszinski) ist. Sein Gebiet liegt in Nordsyrien; es wird in der Regel
zwischen Qadesch und Aleppo lokalisiert. Tunip* gerät während der Zeit
der späteren 18. Dynastie unter hethitische Oberherrschaft, nachdem es
zuvor von Thutmosis III. erobert und Ägypten zur Stellung von Geiseln
verpfhchtet worden war, wie es aus dem Wandgemälde im Grabe Menche¬
perre-senb (s. S. 60) und aus Urkunden^ hervorgeht. Wir werden nicht
fehlgehen, wenn wir Tunip als eine der ersten Lokalgewalten Nordsyriens
einschätzen, das dann den Hethitern als ein Eckpfeiler ihrer Position
gegenüber Ägypten diente und innerhalb der hethitischen Klientel eine
vorrangige Stellung einnahm.
Nach Nordsyrien führen auch die die Schlacht bei Qadesch erzählenden
Reliefwände in Abydos. Auf der westlichen (Abb. 14)* eilt die Nea'rim-
Truppe Ramses' II. in den Kampf. Dieses ganz nach ägyptischer Art
ausgerüstete Kontingent kommt aus Amurru. Nach Weeszinski* setzt
es sich aus Ägyptern zusammen. J. Stüem' hingegen hält seine Soldaten
für eine vom Amurrufürsten Penteäina — durch dessen Abfall vom
hethitischen Großkönig die Ereignisse in Rollen kamen, die schließlich
die Schlacht bei Qadesch auslösten — dem Pharao gestellte Hilfstruppe.
Diese von philologischen und historischen Gründen getragene Auffassung
erhält durch die Reliefs in Abydos eine Stütze. Unter der dort marschie¬
renden Nea'rim-Mannschaft besitzen einige Soldaten eine deutlich
wiedergegebene Einsenkung der Scheitellinie. Sie tritt auch, allerdings
in nicht so augenfälliger Weise wie hier wiederum an Nea'rim-Kriegern
im Bilde der Schlacht bei Qadesch in Luxer* auf. Geht dieses, nur auf
die Abteilung von Nea'rim beschränkte Detail auf eine feste Absicht
zurück, was uns wahrscheinlich erscheint, dann wollte mit ihm der
Künstler den Betrachter darauf hinweisen, daß jene in ägyptischem
Habitus erscheinenden Soldaten zwar als Kämpfer auf der Seite Ägyptens
stehen, aber nicht von dort herstammen. Sollte es sich jedoch um ein in
Amurru stationiertes, aus Ägyptern bestehendes Korps handeln, dann
^ Zu seiner Geschichte vor allem Meyer a. O. passim; F. Bilabel, Ge¬
schichte Vorderasiens und Ägyptens vom 16. — 11. Jahrhundert v. Chr., passim;
J. H. Breasted-H. Ranke, Geschichte Ägyptens, passim.
^ EA. 59 besprochen von Bilabel a. O. 303 § 90 und teilweise im Wortlaut von Breasted, a. O. 228 (Phaidon-Ausgabe 1936) zitiert.
' Nach G. J^QuiBR, Les temples Ramessides et Saites, Taf. 29; Wreszinski
a. O. Taf. 16—17. ♦ Text zu Tafel 17.
* Der Hethiterkrieg Ramses II. (Beihefte zur Wiener Zeitschr. für die
Kunde des Morgenlandes 4. Heft, 1939), 131 ff., 140f.
* Wreszinski, a. O. Taf. 64 (mittlere Riege).
62 Ludwig Schnitzleb
ist mit dieser, gleichsam nur ab und zu unter eine größere Menschenmenge hineingestreute Schädelbildung eine Durchsetzung dieses Truppenkörpers
mit Ausländern gemeint. Die aus einem wälirend der Regierungszeit
Amenophis' IV. angelegten Grabe in El-Amarna entnommene Abbildung
15 lehrt*, daß diese nicht unbedingt im besetzten Lande angeworben sein
mußten, sondern in Ägypten rekrutiert sein konnten. In einem Blinden¬
chor sitzt ein kahlköpfiger Sänger, an dessen sehr ausdrucksvoll wieder-
gegehenem Schädel das Bregmagebiet eingedellt ist. Auch er ist eher
vorderasiatisch-,,hethitischer", als ägyptischer Herkunft. Das ist keine
willkürliche Behauptung, befanden sich doch, wie z. B. noch aus anderen
Bildern desselben Grabes ersichtlich wird^, neben afrikanischen auch
zahlreiche asiatische Fremdlinge in ägyptischen Diensten*.
Die griechischen und ägyptischen Darstellungen von Vorderasiaten
können dank der eingehenden anthropologischen Forschungen in den
letzten fünfundzwanzig Jahren mit im anatolisch-syrischen Kreis zu Tage
getretenen Kranien konfrontiert werden. J. Schaeuble* stellte beim
Studium der Skelette der im 18.—13. Jahrhundert angelegten Gräbern
bei Bogazköy und Ali§ar Hüyük an einer bestimmten Anzahl von
Schädeln, die er auch mit zeitgenössischen Darstellungen von ,, Hethi¬
tern" verglich, die Eindellung in der Bregmazone eindeutig fest. Es steht
außer Frage, daß die auf den griechischen Vasen und ägyptischen Reliefs
zu sehenden Köpfe ihre unmittelbare Entsprechung in dem aus einem
Grabe bei Bogazköy (Abb. 16)^ stammenden Schädel finden.
Bedeutend höheren Alters sind die in der aeneolithischen Nekropole von
Bybios gefundenen Schädel. Henei V. Vallois, der sie einer anthropo¬
logischen Untersuchung unterzog*, erkannte in ihnen die Überreste der
ältesten Bevölkerung des Landes, deren Angehörigkeit zur mediterranen
Raase er für möglich hält. Sie stehen in enger Verwandtschaft mit den
Trägern der mesolithischen Natoufien-Kultur Palästinas und gehören
wahrscheinlich nach W. F. Albeight' dem Substrat an, aus dem später
die Hamiten und Semiten hervorgingen. Bei etlichen der meist lang-
1 Nach N. DB G. Davies, The Rock tomba of El Amama I, Taf. 21; 23;
G. STEiNDOBFr, Die Blütezeit des Pharaonenreiches, 159, Abb. 134.
^ N. de G. Davies, a. O., Taf. 15; 26 (Ausschnitte von Taf. 10 und 25);
II Taf 10; III Taf. 31; VI Taf. 29; 43; vgl. auoh Meyeb a. O. 136.
' Sie sind zu allen Zeiten im alten Ägypten anzutreffen; s. W. M. MiJLLEB, Asien und Europa nach ältägyptischen Darstellungen, 37 ff. ; H. Kees, Kultur¬
geschichte Ägyptens (Handb. der Altertumswiss. III 1, 3, 1), 237ff.
* a. O. 187 (139). ^ Nach einer Aufnahme Prof. Schaeubles.
• Bulletin du Mus6e de Beyrouth I, 1937, 23ff.
' From the Stone Age to Christianity, Deutsche Ausgabe (Sammlimg Dalp
Bd. 55, 1949) 129; The Archaeology of Palestine (Pelican Books 199, revidierte Ausg. 1954) 59.
Darstellungen von Vorderasiaten auf griechischen Vasen 63
gezogenen Schädel mit giebelartig abgeschrägten Scheitel- und Stirn¬
beinen von Bybios tritt im Zusammenhang mit der orbicularen De¬
formation eine sehr deutlich wahrnehmbare Einsattelung auf (Abb. 17)*.
Unter den hauptsächlich aus bronzezeitlichen Gräbern Cyperns ent¬
nommenen Schädeln wies C. M. Fürst^ bei wiederum deformierten
Exemplaren dieselbe Eigentümlichkeit nach. Sowohl der französische
als auch der schwedische Gelehrte sind sich einig*, daß während des
2. Jahrtausends das Zentrum dieser kranialen Sonderform in Asien,
nämlich im ,,Mitanniland oder in Syrien" (Fürst) gesucht werden muß.
Leider ließen beide Forscher das von uns vorgelegte Bildmaterial un¬
berücksichtigt.
Die vielzähligen Denkmäler, welche betrachtet wurden, verlangen eine
abschließende Zusammenfassung und Beurteilung. Die griechische und
ägyptische Überlieferung zeigt in allen wesentlichen Punkten eine be¬
achtenswerte Übereinstimmung. Aus ihr geht hervor, daß die Menschen
mit eingedellter Bregmaregion sicher eüier vorderasiatischen Volksgruppe
angehören. Ihre engere Einordnung, die sich durch die griechischen
Vasenhilder nicht bündig vornehmen läßt, ist durch die ägjrptischen Dar¬
stellungen der 18. und 19. Dynastie gegeben. Diese lehren, daß sie in
jener Zeit dem hethitischen Großreich angehörten. Fixpunkte innerhalb
seiner ausgedehnten Ländermasse nennen die ägyptischen Monumente
nur einen, nämlich Tunip (Abb. 13). Daneben läßt sich Amurru (Abb. 14)
mit einem gewissen Grad an Wahrscheinlichkeit archäologisch und philo¬
logisch erschließen. Ferner besteht zwischen den griechischen und ägyp¬
tischen Darstellungen ein auffallender Einklang in der rassischen Charak¬
terisierung. Kein einheitlicher Schlag tritt als Träger der bewußten
Schädelbildung auf. Im Gegenteil deren Vertreter sind differenzierte
Naturen. Sogar der Grad der Eindellung schwankt merklich ; neben sehr
kräftigen (Abb. 1; 10 rechts) schwache (Abb. 3; 11 links).
Von den Schädelfunden stimmen die der anatolischen Bestattungen
mit dem aus den griechischen imd ägyptischen Quellen gewonnenen Bild
am besten überein. Die Skelettfunde von Bogazköy und Ali§ar Hüyük
beweisen, daß auch unter der Einwohnerschaft des hethitischen Kern¬
gebietes Angehörige jener kranialen Sondergruppe lebten. Daraus aber
den Schluß zu ziehen, wir hätten in ihnen echte Hethiter vor uns, wäre
verfehlt.* Dies gilt selbstverständlich auch für die Darstellungen der
Alten, die bei der Wiedergabe von Fremden in erster Linie auf die Fest-
* Nach Vallois, a. O. Taf. 7 rechts unten.
" Zur Kenntnis der Anthropologie der prähistorischen Bevölkerung der Insel
Cypern (Lunds Universitets Arsskrift, N. F. Avd. 2. Bd. 29. Nr. 6, 1933) be¬
sonders 91 ff. ' Vallois, a. O. 33; Fürst, a. O. 99.
* Dazu ScHABUBLB, a. O. 186 (138).
64 Ludwig Schnitzle»
haltung der typischen und markanten Wesenszüge bedacht waren, jedoch
niemals ,,den Ehrgeiz" besaßen ,, ethnographisch getreue Zeichnungen
herzustellen"*. Diese Einschränkung untersagt aber nicht den Versuch
der volklichen und rassischen Einordnung. Die These Eduard Meyers,
die Gestalten mit „in der Mitte ein wenig eingedrücktem Schädel"^ auf
den Haremhabs-Reliefs seien indogermanische Mitanni, fand manchen¬
orts Anklang*. Dagegen ist einzuwenden, daß das angeführte Kriterium
auch einem eher semitischen als arischen Kopf (Abb. 10 rechts) eignet.
Andere (Abb. 13; 1; 6) können ihm beigesellt werden. Ferner fehlt es
allen inschriftlich gesicherten Mitannidarstellungen ägyptischer Her¬
kunft*. Die eingesenkte Scheitellinie, die, wie schon einige Male hervor¬
gehoben wurde, bei rassisch verschieden gearteten Menschen auftritt,
sehen wir als eine Art überzeithche und überrassische Konstante in der
Völkerwelt des kleinasiatisch-syrischen Raumes während des 2. und
1. Jahrtausends an. Sie läßt sich nicht als spezifisches Charakteristikum
für ein bestimmtes historisches Volk in Anspruch nehmen. In ihr wird
man vielmehr ein Element erkennen dürfen, dessen Ursprung bei den
Autochthonen^ liegt — eine Auffassung, die von den aeneolithischen Ske¬
letten in Bybios geradezu postuliert wird — und das in der Ära der
jüngeren und zugewanderten Völker weiterlebte.
Die Schädel von Bybios und Cypern verdanken ihre Einsattelung einer
nicht natürlichen Deformierung*. Gleiches auch für die auf den Bild-
1 Wreszinski, a.O. II Text zur Taf. 46, 3. Spalte. ^ a. O. 34.
* A. Götze, Kulturgeschichte Kleinasiens (Handb. der Altertumswiss. III
1, 3, 3, 1), 34; Alt a. O. 14, Anm. 1.
* Wreszinski, a. O. II Taf. 3; Taf. 46; Taf. 76.
^ Ob diese vorzeiten auch in Mesopotamien siedelten (dazus. V. Christian,
Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien 55, 1925. 183ff.;
Vallois a. O. 29; A. Parrot, Archiologie misopotamienne II 308 ff. ; G. Con¬
tenau, Manuel d'Archeologie orientate IV 1764ff. ; F. Schachermeyr, Die
ältesten Kulturen Griechenlands 228), soll uns hier nicht beschäftigen. Es gibt
in Kis Schädel, die nach vorbehaltlicher Auffassung Schaeubles (gewonnen
dm-ch die Beschreibung Buxtons, Journal of Royal Anthropological Institute N. S. 34, 1931, 57ff.) eine Einsattelung besitzen können.
« FtjRST,a. O. 93 sieht die Schädel der in Karnak (Fürst, Abb. 41; Wres¬
zinski a. O. Taf. 46 danach H. Th. Bossert, Altanatolien Abb. 759) wieder¬
gegebenen Hethiter auch als deformiert an. Ihnen nahestehend erscheinen
die Köpfe von drei in Samos gefundenen, aus dem 6. Jahrhundert stammen¬
den Freiplastiken (Bronzen aus dem Heraion: E. Buschob, Altsamische
Standbilder III, Abb. 35, 37, 38; Frühgriechisohe Jünglinge Abb. 176—58;
Abb. 165—66; Jüngling von Thigani, Athenische Mitteilimgen 1906, Taf
10—12; E. Langlotz, Frühgriechische Bildhauerschulen, Taf. 57a; G. M. A.
Richter, Archaic Greek Art, Abb. 170), die keinen griechischen, sondern
einen kleinaaiatischen Typus wiedergeben (Buschor, Altsamische Standbilder, 46 hält eine kleinasiatische Provenienz der Thigani-Figur für möglich).
Darstellimgen von Vorderasiaten auf griechischen Vasen 65
werken dargesteUten Köpfe anzunehmen, ergibt sich fast von selbst.
Langlebigkeit zeichnet sie aus*. Durch die griechischen VasenbUder
— darin liegt ihr größter dokumentarischer Wert — ist eindeutig er¬
wiesen, daß die Deformierung, die bisher durch die ägyptische Kunst und
die antliropologischen Entdeckungen lediglich für die Jungsteinzeit und
für die Zeitspanne etwa vom 18.—13. Jahrhimdert ermittelt wurde, zu¬
mindest noch im 5. Jahrhundert auftrat^. Diese Kunde läßt sich gut mit
der Lehensgeschichte der alteingesessenen Völkerschaften Kleinasiens
und Sjrriens in Einklang hringen, die sich bekanntlich trotz aller fremden
Überschichtungen und damit verbundenen Zurückdrängung als äußerst
zählebig erwiesen und ihre Eigenständigkeit sehr lange behaupteten. Die
letzte Klärung des von uns angeschnittenen, durch die anthropologischen
Erkenntnisse und die griechischen und ägyptischen Bildwerke sehr akut
gewordenen Problems, muß aber der Archäologe dem Anthropologen und
Ethnologen überlassen.
5 ZDMG 108/1
Was ist ein ^HilanH, was ein >bit hilänii?
Von Friedkich Wachtsmuth, Marburg/L.
Die vorstehende Frage hat zuerst Robert Koldewey 1898 zu beant¬
worten versucht, als er mit seinem Bericht über die Ausgrabungen in
Sendschirli (Sam'al) an die Öffentlichkeit trat*. Aus dem Vergleich der
inschriftlichen Überlieferungen mit den freigelegten Bauresten kam er
zu dem Ergebnis, daß unter >Hilani< ein aus der 1. Hälfte des 1. vor¬
christlichen Jahrtausends stammender Bautyp zu verstehen sei, der in
dem von den Hethitern eroberten nordsyrischen Gebiet Verbreitung
gefunden habe. Koldewey stellte als Merkmale dieses Bautyps die Zwei¬
turmfassade mit einer dazwischenliegenden Stützenvorhalle und den
querliegenden Hauptinnenraum mit begrenzenden Stirnseitengemächern
hin. Schon Koldewey verschloß sich nicht der Tatsache, daß die
charakteristische )Hilani<-Fassade sich auch vor einen Langraum (z. B.
beim salomonischen Tempel in Jerusalem) wie vor einen quadratischen
Hauptraum (z. B. bei den Apadanas in Persepolis und an den naba¬
täischen Tempeln in Syrien) habe setzen können^. Wie dem auch sei, der
Bautyp mit den oben geschilderten Eigentümlichkeiten erhielt seit
Koldeweys Darlegungen die Bezeichnung >Hilani<, die als terminus
technicus allgemeine Verbreitung fand.
Die Schlüsse, die Koldewey seinerzeit aus den Grabungsfunden
gezogen hatte, und seine geschichtlichen Einordnungen der Einzelfunde
haben im Laufe der Zeit Widersprüche, Ergänzungen und auch andere
Deutungen erfahren. Zuerst war es F. Oelmann*, der den Begriff
,, Hilani" im Gegensatz zu Koldewey auch auf die Einturmbauten in
Sam'al ausdehnte und neue Planungsvorschläge brachte. Im Jahre 1923
griff ich zum ersten Mal die Frage auf* und gab 1929 und 1931 eine
Typenentwicklimg vom Ischtar-Tempel der E-Schicht zu Assur bis zum
Bau HI in Sam'al ; — mit der TypendarsteUung war eine neue Zeitenfolge
* Robebt Koldewey, Die Architektur von Sendschirli, in Mitteilungen aus
den Orientalischen Sammlungen, Berlin 1898, Heft XII, insbesondere
Seite 183ff. ^ ß Koldewey, a. a. O. Seite 187 bzw. 191ff.
' F. Oelmann, Die Baugeschichte von Sendschirli, Berlin 1921, JDAI
38, Seite 85 ff.
* Fbiedbich Wachtsmuth, Die Baugeschichte von Sendschirli (Samal), in
JDAI 38/39, Berlin 1923/24, Seite 158—169; — derselbe. Der Raum I.,
Marburg-Lahn, 1929, Seite 76—92, insbes. Seite 81 u. 87; derselbe. Zum
Problem der hethitischen und mitannischen Baukunst, Berlin 1931, JDAI 46,
Seite 32—44.