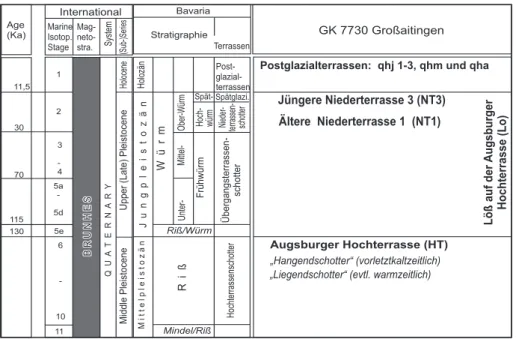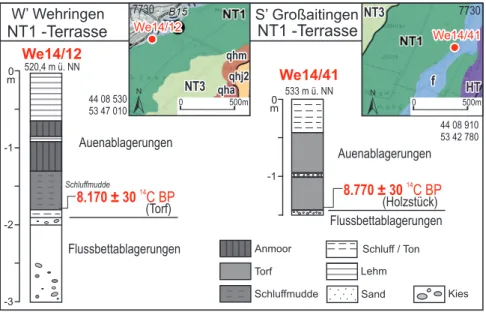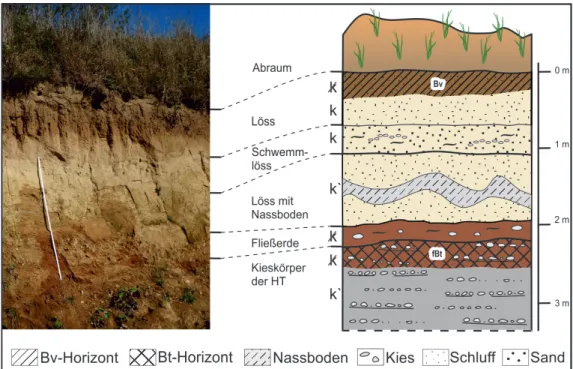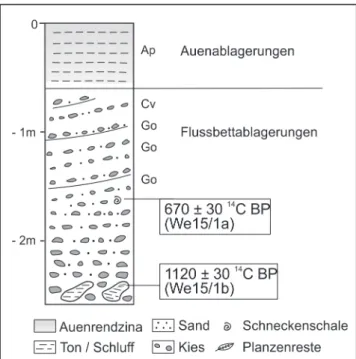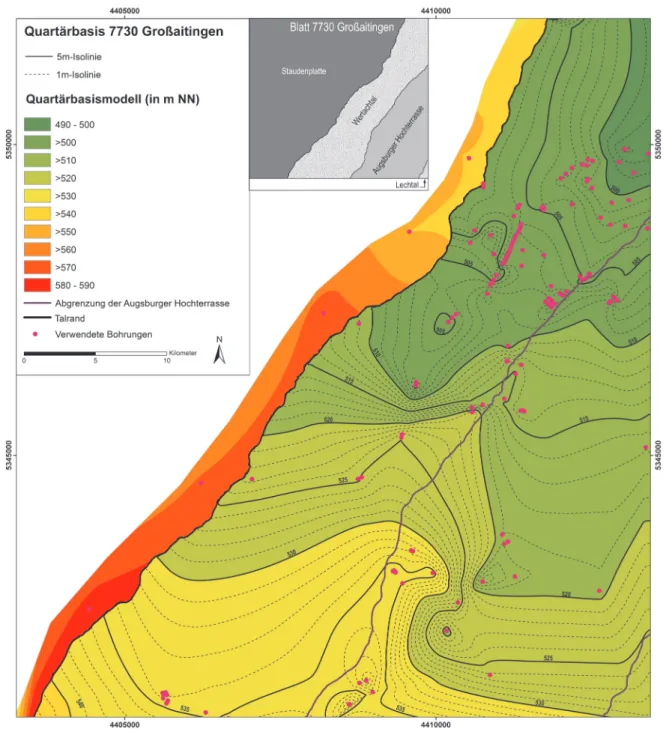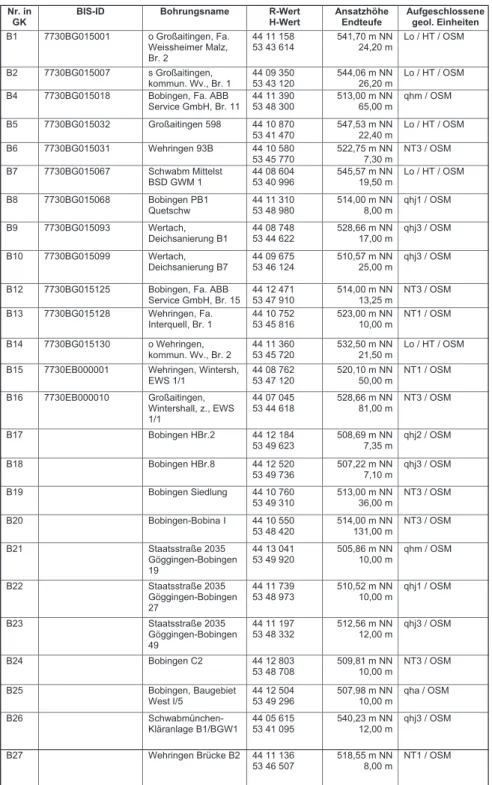Quartärgeologische Karte 1: 25.000 Blatt Nr. 7730 Großaitingen
7730 Grossaitingen – Beilagen
Beilage 1: T alquerprofil N ord (Quellenverzeichnis der Bohrungen in Beilage 3).
ET131 m
ET131 m
ET7 m
ET10 m
ET15 m
ET53 m
ET10 m
ET59,8 m
ET40 m
ET35 m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T alquerprofil 7730 Großaitingen - Nord
qhj2
NT3 HT qhj3
qhm
qhj1
qha
NT3 NT1
Wertach Singold
510 500
520
530
540 0 1000 m
[m ü. NN] [m ü. NN] 510 500 520 530 540 Löss (Würm) Jungholozäne T errasse 1 qhj1
SE NW Obere Süßwassermolasse (Miozän) ET Endteufe inm relativ zur Ansatzhöhe Bohrungen: Bohrung liegt nördlich des Profils Bohrung liegt südlich des Profils Spätglaziale Niederterrasse (Würm) Hochterrasse (Riß)
Hochflutablagerungen NT3 HT
Jungholozäne T errasse 3 Mittelholozäne T errasse Altholozäne T errasse
qhj3 qhm qha Jungholozäne T errasse 2 qhj2 Hochglaziale Niederterrasse (Würm) NT1
? ? ?
? ?
Beilage 2: T alquerprofil S üd (Quellenverzeichnis der Bohrungen in Beilage 3).
?