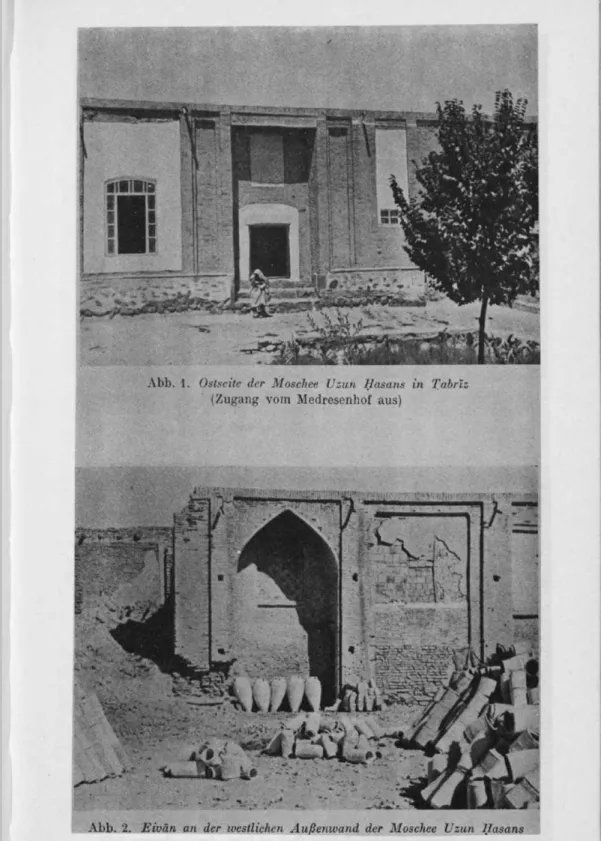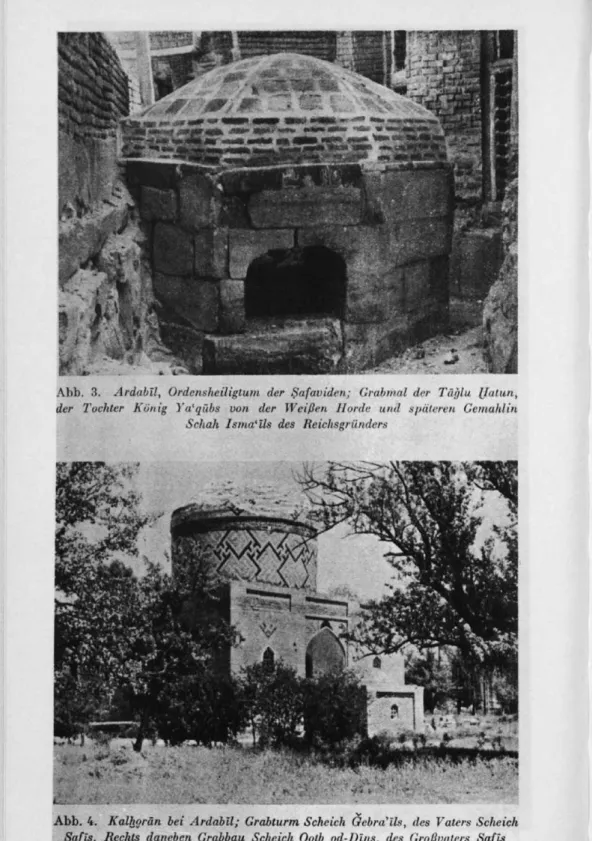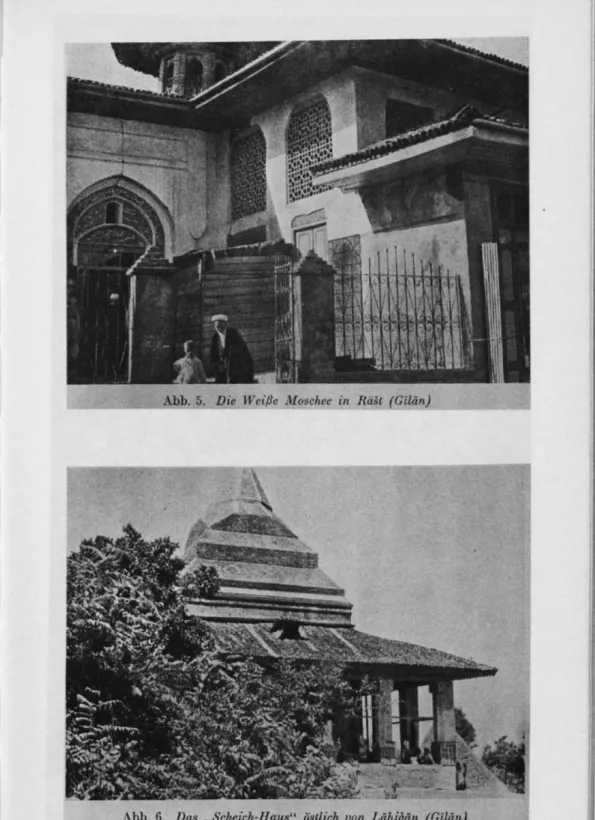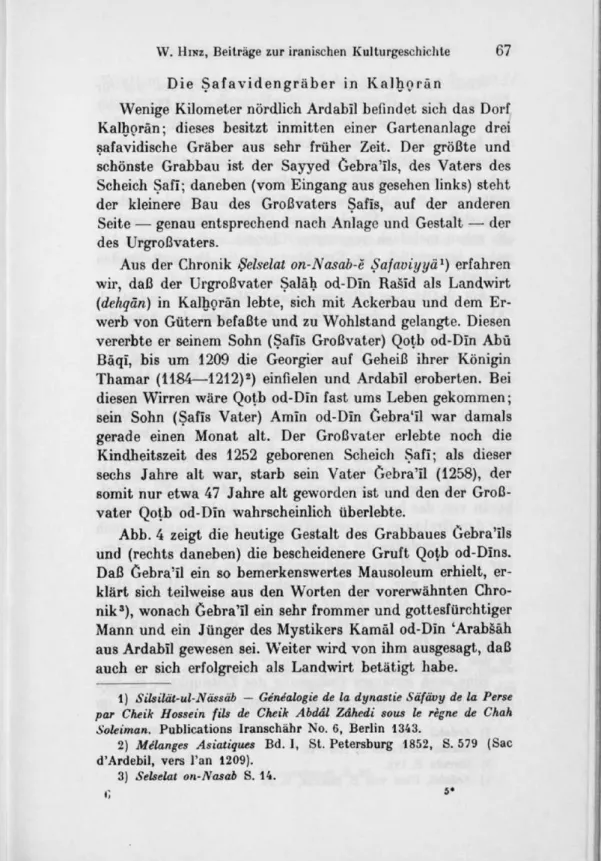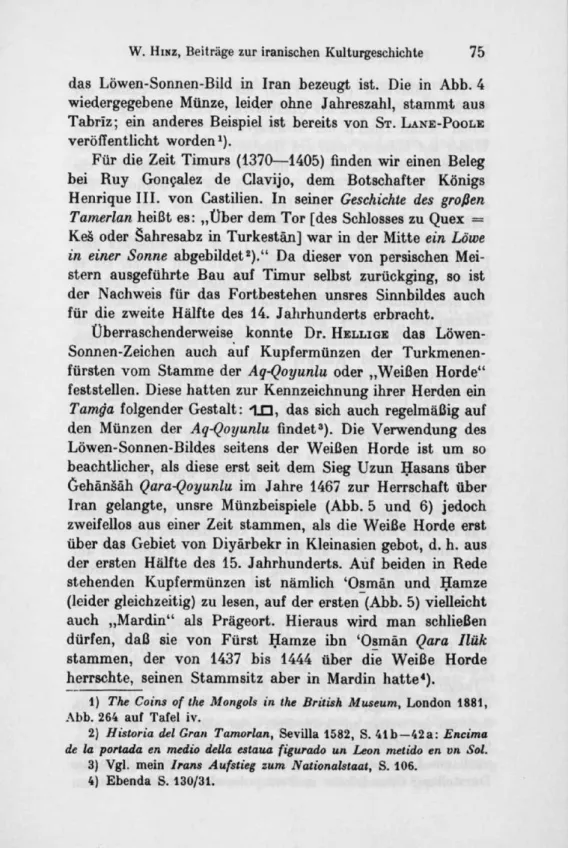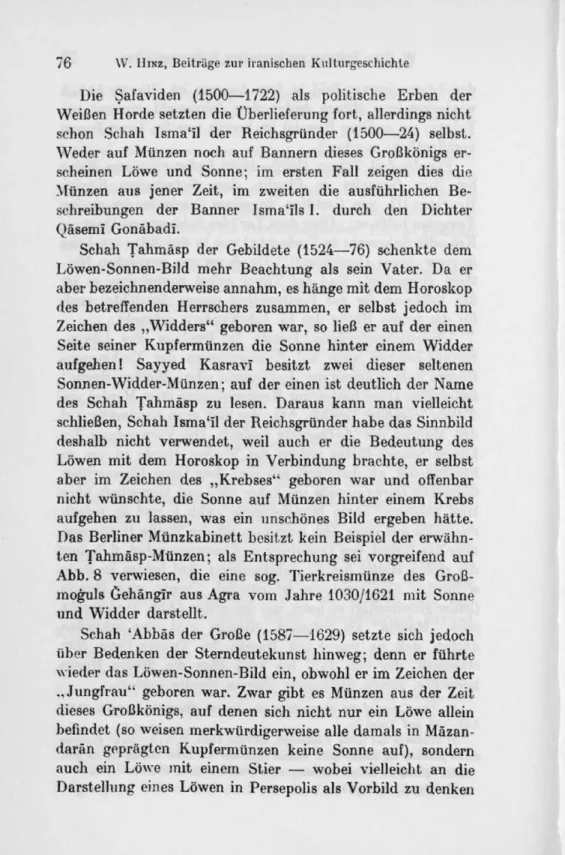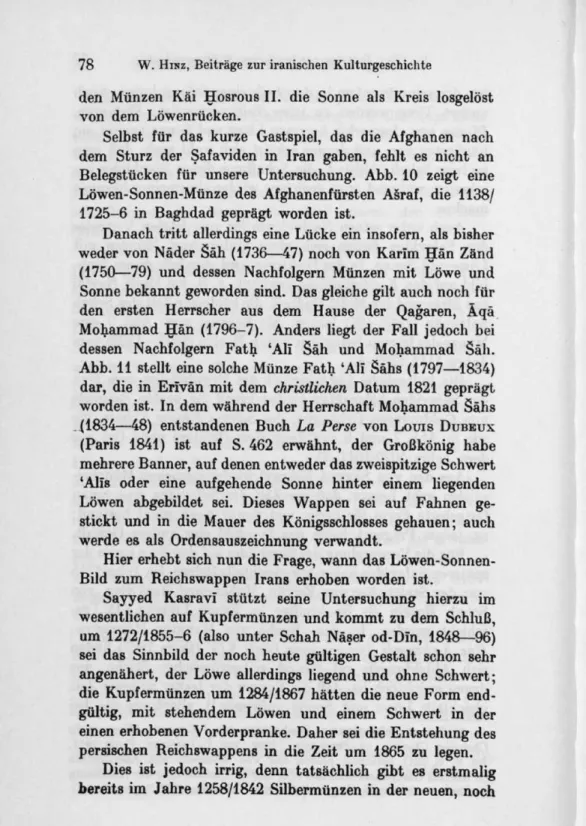Beiträge zur iranischen Kulturgescliichte Von Walther Hinz-Göttingen
I.
Ergebnisse einer Forschungsreise nach Iran
Mit Unterstützung des Reichserziehungsministeriums und
der Deutschen Forschungsgemeinschaft unternahm ich in
der Zeit von Juli bis November 1936 eine wissenschaftliche
Reise nach dem Nahen Osten, vornehmlich nach Iran. Im
Zusammenhang mit meinen Forschungen zur Geschichte der
Safaviden und ihrer Wegbereiter ergaben sich aus dieser
Reise mancherlei aufschlußreiche Beobachtungen. Über einige
von diesen berichte ich im folgenden, und zwar als Ergänzung
zu früheren Veröffentlichungen.
1.
Tabriz
Die Blaue Moschee
Die Blaue Moschee {gök gämi\ masged-e kabüd), das
schönste der wenigen erhaltenen Bauwerke des mittelalter¬
lichen Tabriz, steht heute unter Denkmalschutz und ist sorg¬
fältig ummauert worden, um einem weiteren Schwund der
kostbaren Einlegefliesen vorzubeugen. Infolge mehrfacher
Erdstöße, die Anfang August 1936 die Bewohner von Tabriz
in Schrecken versetzt hatten, waren erneut solche Fayence¬
verkleidungen abgefallen. Es stellt dem Baukönnen Irans im
15. Jahrhundert ein schönes Zeugnis aus, daß trotz zahlloser
Erdbeben noch so eindrucksvolle Teile der Blauen Moschee
erhalten geblieben sind.
Obwohl im einschlägigen Schrifttum die Blaue Moschee
ausführlich erwähnt und erörtert worden ist, besteht über
W. Hinz, Beiträge zur iranischen Kulturgeschichte 59
die eigentliche Erbauungszeit bisher noch keine Klarheit.
F. Sarre bemerkt hierüber im Textband seiner Denkmäler
Persischer Baukunst (Berlin 1910, S. 32), das große Schrift¬
band, das sich in der Nische des Nordeiväns unterhalb der
Wölbung hinziehe, stelle die Bauinschrift dar. „Leider sind
nur noch einige Teile dieser Inschrift erhalten: ,. . der Ge¬
bieter, der Ghakan, der Gelehrte .. Sohn des Schah Jusuf . .
Gott der Erhabene, der Hohe, erhöhe . Weiter unten stellt
Sarre sodann fest, daß sich hieraus zwar ergebe, daß Gehän-
ääh Qara-Qoyunlu die Erbauung der Moschee veranlaßt habe,
die Zeit der Fertigstellung aber leider nicht mehr aus der
Inschrift ersichtlich sei.
Die Lesung der Inschriftreste war seinerzeit auf Grund
von Lichtbildern erfolgt. Der Augenschein ergab nun, daß
der von Sarre vermißte Name des Erbauers (GehänSäh) in
Goldbuchstaben angebracht worden war, die in der Aufnahme
infolge mangelnder Gegensätzlichkeit der Tonwerte nicht
heraustraten. Die Namensinschrift in der Mitte des großen
Eiväns lautet demnach:
[A'fiuH-Mu?affar öehänSäh bin Säh Yüsuf nüyän
{noyon, Mong. = Fürst).
Darüber hinaus ist glücklicherweise auch der Teil einer
großen Inschrift erhalten, der den genauen Zeitpunkt der
Fertigstellung angibt. Dieses Schriftband befindet sich an
der linken vorderen Seitenwand des Nord-Eiväns und ent¬
hält in voll ausgeschriebenen arabischen Zahlen das Datum:
4. Rabi' I 870 = 25. Oktober 1465^).
Hieraus ergibt sich, daß die Blaue Moschee zu einer Zeit
fertig wurde, als Gehänääh gerade seine aufrührerischen
Söhne Pir Budaq und Hasan 'Ali in Baghdad belagerte*). Da
1) Die Inschrift erscheint gründlicher Untersuchung wert, da sie
an ihrem Ende auch den Namen eines Meisters zu enthalten scheint,
der mit dem Bau in Zusammenhang zu bringen ist; ich vermag vor¬
läufig nur Ibn Mohammad zu entziffern.
2) Vgl. W. Hinz, Irans Aufstieg zum Nationalstaat im 15. Jahr-
hundert, Berlin-Leipzig 1936, S. 134/35.
*
GO W. Hinz, Beiträge zur iranisclien Kulturgescliiciite
ihm die Niederwerfung dieses Aufstandes erst nach einjähriger
Aushungerung der Stadt im Juni des Jahres 1466 gelang,
konnte der Führer der Schwarzen Horde erst bei der im An¬
schluß daran erfolgten Rückkehr in seine Hauptstadt Tabriz
das fertiggewordene Meisterwerk besichtigen.
Es dürfte sich verlohnen, der Bautätigkeit Gehänsähs auf
iranischem Boden sorgfältiger, als bisher geschehen, nach¬
zugehen. So fand ich beispielsweise in Kä§än ein anscheinend
unbeachtet gebliebenes Bauwerk dieses Herrschers. Mitten
im Bazar Käsäns steht die Mäidän-Moschee, von dem Mon¬
golenfürsten Abü Sa'id (1316—35) gestiftet. Den Eingang zu
ihr von der Bazarseite aus bildet ein Eivän, den — nach der
schönen Inschrift, die um ihn herumführt — Gehänsäh im
Jahre 868/1463-4 hat errichten lassen. Als weiteres Beispiel
wäre die Heiligengruft Dar-e Imäm in Isfahän zu nennen, wo
Gehänsäh seiner Mutter ein reizvolles Kuppelgrab erbaut hat.
Die Moschee Uzun Hasans
Auf Grund sämtlicher schriftlichen Quellen konnte man
bisher über die Moschee, die Uzun Hasan — der Führer der
Weißen Horde {Aq-Qoyunlu) und Gegenspieler Gehänsähs —
gleichfalls in Tabriz gestiftet hatte, nur äußerst wenig aus¬
sagen^). Nach dem Bericht des venedischen Kaufmannes, der
die Moschee um 1510 besichtigte 2), befand sie sich etwas
außerhalb der Hauptstadt, in der Siedlung Sähebäbäd, in der
die Fürsten der Weißen Horde in der Zeit von 1468 bis 1500
Hof hielten. Meinen Aufenthalt in Tabriz benutzte ich im
wesentlichen dazu, diese örtlichkeit ausfindig zu machen.
Zwei Umstände lieferten dabei wertvolle Fingerzeige. Der
venedische Kaufmann berichtet einmal, die Siedlung Sähe¬
bäbäd sei durch einen Flußlauf vom eigentlichen Tabriz ab¬
getrennt gewesen. Dieser konnte nach Lage der Dinge nur
der linke Nebenfluß des Agi-cai (des ,, Bitterbaches") sein,
1) Ebenda S. 108/09, Minorskij in der Enz. d. Isläm iv, S. 642
(Artiliel Tabriz).
2) Works issued by The Hakluyt Society, Bd. 49, Teil II,
London 1873, S. 173.
W. Hinz, Beiträge zur iranischen Kulturgesciiiclite 61
d. h. der Mehrän-rüd, heute Mäidän-cai genannt. Durch ihn
wird ein kleinerer nördlicher Teil der heutigen Stadt von dem
überwiegenden südlichen getrennt; es war daher anzunehmen,
daß Sähebäbäd (dem heutigen Tabriz ist diese Bezeichnung
unbekannt) nördlich des Flüßchens zu suchen sei.
Einen zweiten Hinweis bot die Bemerkung Wilson's i),
Moschee und Medrese Uzun Hasans befänden sich unfern der
Moschee Säheb ol-'Amr. Nicht nur enthielt diese Bezeich¬
nung einen Anklang an Sähebäbäd, sondern es konnte auch
bald festgestellt werden, daß die letztgenannte Moschee sich
tatsächlich in jenem nördlich des Mäidän-cai gelegenen Stadt¬
teil befindet. Daraufhin ist es mir dann — nicht zuletzt dank
der Unterstützung des Herrn Iskenderi von der Unterrichts¬
verwaltung des Gaues Ost-Äzarbaigän — gelungen, die fast
verschollene Moschee Uzun Hasans in Tabriz wieder aufzu¬
finden.
Nach Durchquerung des eindrucksvollen und weitschich¬
tigen Bazars hat man das trockene Flußbett des Mäidän-cai
zu überschreiten; dieses wurde gerade reguliert und bot daher
einen Schauplatz eifriger Tätigkeit. Maurer, Händler, Esel
und Kinder drängten und stießen sich auf den schmalen
Brückenköpfen; doch erreichten wir wohlbehalten den jen¬
seitigen Teil des Bazars, an dessen Stelle sich im 15. Jahr¬
hundert höchstwahrscheinlich jener große Platz mit all den
prunkvollen Bauten Uzun Hasans und seines Sohnes Ya'qüb
befand, die der venedische Kaufmann so begeistert geschil¬
dert hat.
Etwas gegen Osten, aber ganz nahe dem Flußlauf, steht
die Moschee Säheb ol-'Amr, über die in den Quellen, soweit
ich sehe, nichts Näheres mitgeteilt wird. Da unter Säheb
ol-^Amr der Mahdi zu verstehen ist, könnte der Bau auf die
Zeit der (äl'itischen) Safaviden zurückgehen, um so mehr als
Evliyä Celebi mitteilt*), der Moschee Uzun Hasans gegenüber
befinde sich die von Schah Isma'il dem Reichsgründer erbaute
1) S. G. Wilson, Persian life and customs, New-Yorlc 1899, S. 65.
2) Siyäset-Näme, Stambuler Ausgabe, Band II, von 1314/1896,
S. 249.
62 VV. Hinz, Beiträge zur iranischen Kulturgeschichte
Moschee. Näheren Aufschluß hierüber dürfte erst eine
archäologische Untersuchung ergeben.
Etwa hundert Meter von der Moschee Säheb ol-'Amr ent¬
fernt befinden sich, zwischen Lagerspeicher und andere
Räumlichkeiten eingezwängt, die bescheidenen Überreste der
Moschee Uzun Hasans.
Über dem Eingang in den Moschee- bzw. Medresenhof,
unmittelbar neben einem Lagerraum, ist ein Stück altes
Schriftfries eingemauert, das sich einst gewiß an andrer
Stelle befunden hat; die Schrift könnte man als blühendes
Nashi bezeichnen. Darüber befindet sich eine längere ara¬
bische Inschrift in kleinem gewöhnlichem Nashi. Betritt man
diesen Eingang, dessen heutige Form kein Jahrzehnt alt sein
dürfte, so erreicht man durch einen überdeckten Gang von
etwa fünf Metern Länge den alten Hof der Moschee Uzun
Hasans.
Dieser Hof bildet ein Rechteck, das wir an der südlichen
Längsseite betreten; er ist mit Bäumen und ausgetrockneten
Wasserbecken bestanden. An der nördlichen Längsseite sind
noch zwei große Marmorplatten erhalten, mit denen einst
gewiß der ganze Medresenhof bepflastert war.
Die eigentliche Moschee Uzun Hasans (siehe Abb. 1) liegt
an der westlichen Schmalseite ; man betritt sie der Nordwest¬
ecke zu durch ein paar Stufen, da der mit Strohmatten
bedeckte Fußboden etwa zwei Meter über der Hofebene liegt.
Die Moschee bildet ein ungefähres Rechteck, dessen längere
Seite gleich der Schmalseite des Hofes ist; bar fast allen
Schmuckes, wird sie innen durch zahlreiche Holzpfeiler von
mäßiger Dicke gegliedert, die das durch waagerechte Balken
gebildete Holzdach mit aufgelegtem Strohgeflecht tragen.
Ein großer Teil der Wände ist weiß getüncht; nach den Mit¬
teilungen des Schließers sollen sich unten an ihnen entlang
P'ayencemosaiken befunden haben, die teils zerstört, teils
unter dem Verputz verschwunden seien.
Von Überresten aus der Zeit Uzun Hasans ist außer dem
Mauerwerk nur noch ein Teil des Schriftfrieses vorhanden,
der sich einst gewiß um die gesamten Wände hingezogen hat
W. Hinz, Beiträge zur iranisclien Kulturgeschichte 63
und von dem wir ein Bruchstück über dem Eingang (vom
Bazar her) bereits erwähnten. Im ganzen machen die noch
vorhandenen Stücke eine Länge von schätzungsweise acht
bis zehn Metern aus; es handelt sich um eine ausgesprochene
Zierschrift, die möglicherweise*) auf den berühmten Schön¬
schreiber Yäqüt Musta'simi zurückgeht.
Es ist fraglich, ob die Moschee Uzun Hasans in gleicher
Höhe lag wie heutzutage; der .Schließer, ein nicht schlecht
unterrichteter Alter, meinte, sie habe tiefer gelegen als die
jetzige Moschee. An deren Südfront steigt man tatsächlich
in eine Art Kellergewölbe hinab, das durch eine trübe Scheibe
kärgliches Licht erhält. Das Gewölbe wird durch mehrere
runde Pfeiler von gewaltiger Dicke mit kapitellartiger Ver¬
breiterung getragen. Hier soll sich, in der mittleren der drei
durch die Steinpfeiler gebildeten Nischen, das Grab Uzun
Hasans befinden. Die örtliche Überlieferung erwähnt noch
drei weitere, kleinere Gräber an jener Stelle. Auch habe es
zur Zeit Uzun Hasans hier eine Quelle gegeben, die für die
Bewässerung der schönen Gartenanlagen herangezogen wurde.
An der Westseite der Moschee, die durch einen Umweg —
durch ein Stück Bazar hindurch — von außen einsehbar ist,
erkennt man noch deutlich den einstigen Eivän (Abb. 2), der
auf den großen Platz führte, von dem der Venezianer berichtet
und auf dessen der Moschee gegenüberliegenden Seite das Tor
stand, das Zutritt zu Park und Schloß Häii BeheSt gewährte.
Von diesem scheint nichts erhalten zu sein; jedenfalls stehen
jetzt Gebäude auf diesem Platz, während der dem Eivän
vorgelagerte Hof als Lagerstätte für Tonkrüge dient.
Kehrt man in den Medresenhof zurück, so betritt man von
dessen Südostecke aus durch einen Gang das sogenannte
Houi-hänä, ein kunstvoll überwölbtes, in den Steinboden ein¬
gelassenes rechteckiges Wasserbecken von eineinhalb Meter
Tiefe, in das Stufen hinabführen. Hier wurde ersichtlich das
für die vorgeschriebenen Waschungen benötigte Wasser auf¬
bewahrt.
1) Nach Evliyä Celebi, a.a.O.
64 W. Hinz, Beiträge zur iranischen Kulturgeschichte
Rings um den Medresenhof herum sind die einzelnen
Zellen noch deutlich zu erkennen; doch sind sie heute durch
Bretter vernagelt oder sonstwie als Speicher benutzt. Alles
aber ist ordentlich gehalten und verputzt, obschon vom alten
Glänze nur noch ein leiser Schimmer über dem Bauwerk
liegt. Auch in diesem Fall können uns weitere Aufschlüsse
nur die Archäologen vermitteln.
2.
Ardabil
Das safavidische Heiligtum
Einen mehrtägigen Aufenthalt in Ardabil benutzte ich zu
einer Überprüfung der bisherigen baugeschichtlichen Unter¬
suchungen bezüglich des safavidischen Ordensheiligtums.
Hierin wurde ich durch zwei iranische Sachverständige
unterstützt, denen ich wertvolle Hinweise verdanke. Es war
dies einmal der örtliche Kultusvorsteher {ra'is-e ma'äref),
Herr Safi'zädä; er hat es im besonderen übernommen, die
Wiederherstellungsarbeiten am Heiligtum zu betreuen. Dieser
großen Aufgabe widmet er sich mit Hingabe und Selbstver¬
leugnung; seine Amtsräume hat er sinnfällig über dem Tor¬
bogen errichten lassen, der in den von Sarkk so genannten
„Küchenhof" Zutritt gibt, wodurch er allezeit die Kuppeln
des unvergleichlichen Bauwerkes vor Augen hat. Der andere
Sachverständige, Herr Mostoufi-zädä von der Ardabiler Statt¬
halterschaft, hat sich das Studium der Safaviden und ihres
Ordensheiligtums zur Lebensaufgabe gemacht; er gehört
heute zweifellos zu den sachkundigsten Persönlichkeiten auf
diesem Gebiet.
Ich habe oben kurz die Wiederherstellungsarbeiten er¬
wähnt. Tatsächlich hat das neue Iran auch hierin eine Unter¬
lassungssünde der Qagarenzeit gutgemacht. Besonders ge¬
litten hatte der Grabturm Safis, dessen Einsturz bevorstand ;
außerdem hatte die mit herrlichen Fayencemosaiken bedeckte
große Längswand des Vorhofes viel von ihrem Glänze ein¬
gebüßt. Im Jahre 1935 wurde erstmalig mit Wiederherstel-
Abb. 2. Eivän an der westlichen Außenwand der Moschee Uzun Hasans
Abb. 3. Ardabil, Orderisheüigtum der Safaviden; Grabmal der Täglu Ilatun,
der Tochter König Ya'qäbs von der Weißen Horde und späleren Gemaldin
Schah Isma'ils des Reichsgründers
Abb. 4. Kalhgrän hei Ardabil; Grabturm Scheich öcbra'lls, des Vaters Scheich
§a[ls. Rechts daneben Grabbau Scheich Qutb od-Dlns, des Großvaters !}afls
Abb. 6. Das „Scheich-Haus" östlich von Lähijän (Gilän)
Reihenfolge der Abbildungen von links oben in seitlicher Reihung bis rechts unten
W. Hinz, Beiträge zur iranisclien Kulturgesciiiclite 65
lungsarbeiten begonnen; bald ließen diese jedoch erkennen,
daß nur gründliches Vorgehen fruchten konnte. Daraufhin
bewilligte Kultusminister Hekmat im Jahre 1936 einen Be¬
trag von 16000 Mark. Auf diese Weise ist inzwischen der
Grabturm völlig wiederhergestellt worden (mit Eisenträgern
gestützt); die Erneuerung des Kachelbelages ist in vollem
Gange. Hierfür hatte man eigens zwei Meister aus Isfahän
('Abd or-Razzäq und Nasro'lläh Rafä'il) verschrieben, die
sich auf die Kunst des käSl-taräSi, der Fayencemosaik-An¬
fertigung verstehen. Die Arbeit dieser Künstler ihres Faches
ist erstaunlich anzusehen; eine genaue Beschreibung der
Technik hat Sarre in seinem Werk über Ardabil gegeben,
erübrigt sich daher an dieser Stelle. Im Jahre 1938, eher
früher, wird die Aufgabe gelöst sein und die berühmte
Moscheewand in alter Schönheit erstrahlen, für deren Schilde¬
rung Worte nicht ausreichen.
Die Scheich-Gräber
Im Anhang zu meinem Buche*) hatte ich unter Heran¬
ziehung aller schriftlichen Quellen eine Übersicht über die
Gräber der einzelnen safavidischen Scheiche zu geben ver¬
sucht. Im folgenden halte ich mich an die Auffassung des
Herrn Mostoufi-zädä, die mir vorläufig die einleuchtendste
zu sein scheint. Danach verhält es sich mit den Sarkophagen
im Grabturm des Scheich Safi folgendermaßen:
In der Mitte befindet sich unbestritten der sehr große und
in kunstvoller Schnitz- und Einlegearbeit verfertigte Schrein,
unter dem Safi selbst bestattet liegt. Der davor befindliche,
wesentlich niedrigere Schrein dürfte Sadr od-Din, seinem
Sohne, zugehören; den noch weiter davor stehenden, sehr
kleinen Schrein bringt Herr Mostoufi-zädä mit Sadr od-DIns
älterem Bruder Mohyi od-Dln in Verbindung, der als Kind
gestorben zu sein scheint.
Hinter dem Mittelschrein Safis, unmittelbar vor dem
Fenster, steht ein Doppelschrein, unter dem Vater und Gro߬
vater des Reichsgründers bestattet sein dürften, nämlich die
1) Irans Aufstieg zum Nationalstaat, S. 141/42.
ZeitKhiUt d. DMO Bd. 91 (Neue I'olge Bd. 16) S
66 \V. Hinz, Beiträge zur iranisclien Kulturgeschichte
Scheiche Öonäid und Haidar. Die Frage nach der Bedeutung
des Grabturmes zu Hiyäv (92 km nordwesthch von Ardabil)
bleibt damit freilich offen.
Der wuchtige Grabturm neben dem des Scheich Safi,
gornbad-e haram, d. h. „Kuppelgrab der Frauen" benannt, ist
zweifellos ursprünglich für Bibi Fätemä, die Gemahlin Safis,
erbaut worden. Zu diesem Raum hatte Sarre einst keinen
Zutritt erhalten. Tatsächlich befindet sich der Schrein Bibl
Fätemäs gleich rechts beim Eingang; außerdem sind dort
aber noch eine ganze Reihe von Sarkophagen aufgestellt,
vermutlich alles von Frauen der safavidischen Scheiche.
Außer dem vorgenannten glaubt Herr Mostoufi-zädä nur
noch den der Gattin des Scheichs Sadr od-Din bestimmen
zu können, nämlich den Schrein unmittelbar links neben dem
Bibi Fätemäs.
Das Grabmal der Großkönigin Täglu Hatun
In dem Grundriß des safavidischen Ordensheiligtums, den
Sarre veröffentlicht hat*), ist zwischen dem Grabturm Safis
und dem großen Vorhof ein kleines Bauwerk schraffiert ein¬
gezeichnet, über das nichts ausgesagt wird. Es handelt sich
um einen etwa zwei Meter hohen Grabbau von eigenartig
backofenförmiger Gestalt, der nur vom Friedhof {m auf dem
Plan) aus einsehbar ist, und diesen zu betreten war Europäern
früher nicht verstattet. Abb. 3 zeigt diese Gruft; in ihr liegt
Täglu Hatun begraben, die Tochter König Ya'qübs von der
Weißen Horde aus dessen Ehe mit einer schirvanischen Prin¬
zessin, nämlich einer Tochter des SirvänSäh Halil. Täglu
Hatun wurde später die Gemahlin Schah Isma'ils des Reichs¬
gründers, den sie überlebte. Der Grabbau liegt, bezogen auf
die Gruft Safis, ziemlich genau symmetrisch zu der Isma'ils,
und dürfte auf Schah Tahmäsp (1524—76) zurückgehen. Im
Innern befindet sich ein Steinsarkophag, unter dem die
Fürstin ruht; dieser ist auch durch eine Nisciie in der Längs¬
mauer des großen Vorliofes zu erkennen.
1) A. a. O. S. 0.
W. Hinz, Beiträge zur iranisclien Kulturgesciiiclite 67
Die Safavidengräber in Kalhorän
Wenige Kilometer nördlich Ardabil befindet sich das Dorf
Kalhorän; dieses besitzt inmitten einer Gartenanlage drei
safavidische Gräber aus sehr früher Zeit. Der größte und
schönste Grabbau ist der Sayyed Gebra'ils, des Vaters des
Scheich Safi; daneben (vom Eingang aus gesehen links) steht
der kleinere Bau des Großvaters Safis, auf der anderen
Seite — genau entsprechend nach Anlage und Gestalt — der
des Urgroßvaters.
Aus der Chronik Selselat on-Nasab-e Sajaviyyä^) erfahren
wir, daß der Urgroßvater Saläh od-Din Rasid als Landwirt
(dehqän) in Kalhorän lebte, sich mit Ackerbau und dem Er¬
werb von Gütern befaßte und zu Wohlstand gelangte. Diesen
vererbte er seinem Sohn (Safis Großvater) Qotb od-Din Abü
Bäqi, bis um 1209 die Georgier auf Geheiß ihrer Königin
Thamar (1184—1212)*) einfielen und Ardabil eroberten. Bei
diesen Wirren wäre Qotb od-Din fast ums Leben gekommen;
sein Sohn (Safis Vater) Amin od-Din Gebra'il war damals
gerade einen Monat alt. Der Großvater erlebte noch die
Kindheitszeit des 1252 geborenen Scheich Safi; als dieser
sechs Jahre alt war, starb sein Vater Gebra'il (1258), der
somit nur etwa 47 Jahre alt geworden ist und den der Gro߬
vater Qotb od-Din wahrscheinlich überlebte.
Abb. 4 zeigt die heutige Gestalt des Grabbaues Gebra'ils
und (rechts daneben) die bescheidenere Gruft Qotb od-Dins.
Daß Gebra'il ein so bemerkenswertes Mausoleum erhielt, er¬
klärt sich teilweise aus den Worten der vorerwähnten Chro¬
nik'), wonach Gebra'il ein sehr frommer und gottesfürchtiger
Mann und ein Jünger des Mystikers Kamäl od-Din 'Arabääh
aus Ardabil gewesen sei. Weiter wird von ihm ausgesagt, daß
auch er sich erfolgreich als Landwirt betätigt habe.
1) Sikilät-ul-Nässäb — Genealogie de la dynaslie Säfävy de la Perse
par Cheik Hossein fils de Cheik Abdäl Zdhedi sous le regne de Chah
Soleiman. Publications Iranschähr No. 6, Berlin 1343.
2) Melanges Asiatiques Bd. I, St. Petersburg 1852, S. 579 (Sac
d'Ardebil, vers Tan 1209).
3) Selselat on-Nasab S. 14.
s*
68 W. Hinz, Beiträge zur iranischen Kiilturgeschiclite
Nach Sarre*) dürfte der Turm des Grabbaues, der für
Gebra'il errichtet worden ist und eine gewisse Ähnlichkeit
mit dem seines Sohnes Safi in Ardabil besitzt, aus dem
14. Jahrhundert stammen. Auch er wird daher auf Safis
Sohn Sadr od-Din (Ordensmeister von 1334 bis 1393) zurück¬
gehen. Den umgebenden Sockelbau setzt Sarre erst viel
später an, nämlich in die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts
(aus stilkritischen Überlegungen). Erfreulicherweise enthält
die schon mehrfach angezogene Chronik auch genauere An¬
gaben hinsichtlich der Errichtung des in Frage stehenden
fünfseitigen Sockelbaues.
Am 9. Oktober 1600 war durch Verfügung des Schah
'Abbäs an Stelle des unfähigen Verwalters des Ardabiler
Heiligtums, Mirzä Isma'ils, ein neuer Motavalli oder Schrein¬
hüter eingesetzt worden, nämlich Scheich Abdäl Beg Pir-
zädä^). Den Beinamen Plrzädä verdankte er seiner Abstam¬
mung von Scheich Zähed Giläni, dem Pir oder Lehrmeister
Scheich Safis, von dem noch unten die Rede sein wird. Abdäl
Beg machte sich unverzüglich ans Werk, um die Versäum¬
nisse seines Vorgängers wieder gutzumachen, nicht zuletzt
hinsichtlich der Erhaltung der safavidischen Bauwerke. Als
erstes nahm er sich das Grabmal Sayyed Gebra'ils in Kal¬
horän vor, das besonders bedroht war. Abdäl Beg ließ nicht
nur den Grabturm wiederherstellen, sondern veranlaßte auch
einen Fayencebelag der Kuppel. Das Eingangstor, das offen¬
bar aus einer Holzverkleidung bestanden hatte und gleich¬
falls verfallen war, ,,ließ er mit Lehmziegeln und Mörtel über¬
wölben, indem er gleichzeitig acht Eiväne anbrachte, mit einem
Geländer davor^)". Tatsächlich zeigt der von Sarre ver¬
öffentlichte Grundriß des Grabbaues acht Spitzbogennischen
in den Seiten des Steinsockelbaues*).
Eine noch genauere Festlegung des Zeitpunktes, zu dem
mit den Bauarbeiten eingesetzt wurde, ermöglicht der im
1) Ardabil S. 23.
2) Selselat on-Nasab S. 108-10.
3) Ebenda S. 112.
4) Ardabil, Plan von B. Schulz, S. 24.
W. Hinz, Beiträge zur iranisclien Kulturgeschichte 69
Wortlaut überlieferte Erlaß des Schab 'Abbäs vom 6umädi II
des Jahres 1010; dieser Monat begann am 27. November 1601.
Der an Scheich Abdäl Beg gerichtete Fermän lautete*):
Es wird kund und zu wissen getan, daß der an den
großköniglichen Hof gesandte Bericht eingegangen ist.
Von seinem Inhalt wurde Kenntnis genommen.
Bezüglich des Kuppelbaues Sayyed Gebra'ils wird
darin gemeldet, daß dieses ursprünglich aus Lehmziegeln
errichtete Bauwerk in Verfall geraten ist und daß Ihr
als Oberschreinhüter beabsichtiget, das Gebäude mit
Kachelbelag auszustatten, ja bereits damit begonnen
habet. Dies ist sehr zu begrüßen usw. (folgen Ermah¬
nungen, in diesem Sinne fortzufahren).
Scheich Abdäl hat übrigens auch im eigentlichen Ardabil
viel in ähnlicher Richtung veranlaßt, so z. B. die Wiederher¬
stellung des Frauengrabgewölbes, die Ausbesserung der
Kuppel am Grabturm Safis, durch deren Ritzen Wasser ein¬
gedrungen war, so daß sich bereits Schwamm angesetzt hatte,
ferner die Neuverglasung der Fenster, die Erneuerung des
Verputzes am ältesten Moscheebau, den schon Scheich Safi
als Betraum (tellä-hänä) benutzt hatte, und anderes mehr.
3.
Gilän
Die Weiße Moschee in Rä§t
Von der Weißen Moschee in Rä§t, über deren Bau¬
geschichte wenig Nachrichten vorliegen dürften, wird berich¬
tet, daß in ihr der siebenjährige Isma'il und spätere Reichs¬
gründer (1494) auf seiner Flucht aus Ardabil vor den Turk¬
menen der Aq-Qoyunlu abgestiegen sei. Die Bauweise dieser
Moschee gefiel ihm so gut, daß er nicht in das Haus des
Statthalters Amirä Ishaq übersiedeln wollte, so sehr ihn
dieser auch darum bat*).
1) Selselat S. 114.
2) Irans Aufstieg zum Nationalstaat, S. 98.
70 W. Hinz, Beiträge zur iranischen Kulturgeschichte
Zu meiner Überraschung fand ich die Weiße Moschee
{Masged-e safld) in Räst in noch gut erhaltenem Zustand vor,
wie auch ihr Name unverändert geblieben ist. Einen Begriff
von der wirklich eigenartigen und für Gilän kennzeichnenden
Bauweise vermittelt Abb. 5.
Lähigän
Weniger glücklich verliefen meine Nachforschungen in
dem 38 km östlich von Räst gelegenen Lähigän, einst Haupt¬
stadt von Ostgilän. Dort hielt sich der junge Isma'il von
1494 bis 1499 auf, beschirmt von Kärkiyä Mlrzä 'All, der dem
Scheichsohn eine Unterkunft gegenüber einer Medrese ver¬
schaffte. Diese bezeichnete ich nach dem Vorgang von Sir
Denison Ross mit dem Namen Käi Äfrldün^); in Lähigän
belehrte man mich, daß es sicher Kiyä Faridün heißen müsse —
was mir ohne weiteres einleuchtete. Allein eine Medrese
solchen Namens war nirgends mehr bekannt. Erschwert
wurde das Suchen durch den Umstand, daß Lähigän un¬
gewöhnlich reich an alten Bauwerken ist, die mir näherer
wissenschaftlicher Erforschung wert erscheinen. Es ist mir
vorläufig nicht gelungen, den Aufenthaltsort des jungen
Safaviden vor seinem Auszug zur Reichsgründung ausfindig
zu machen.
Das Scheich-Haus östlich Lähigän
In Lähigän erfuhr ich aber von einem anderen Bau¬
werk, das man dort allgemein mit dem Lehrmeister des
Scheich Safi in Verbindung bringt, d. h. mit Scheich Zähed
Giläni. Dieses sogenannte säih-hänä oder Scheich-Haus be¬
findet sich etwa 4—5 km östlich von Lähigän, unfern der
nach Längärüd führenden Straße, jedoch verborgen auf
einem waldigen Hügel. Seine Bauform ist so ungewöhnlich
(Abb. 6), daß ich nicht anstehe, dieses Scheich-Haus stilmäßig
als in ganz Iran einzigartig zu bezeichnen. Man glaubt sich
unwillkürlich in ceylonesische Gefilde versetzt, zu welcher
1) Irans Aufstieg, S. 99.
W. Hinz, Beiträge zur iranisclien Kulturgeschichte 71
Vorstellung das üppige Wachstum und die unerträgliche
feucht-heiße Witterung nicht wenig beitragen.
Ich sehe keinen Grund, der örtlichen Überlieferung zu
mißtrauen, die das Gebäude mit den beiden genannten
Scheichen in Zusammenhang bringt*). Offenbar besaß näm¬
lich Scheich Zähed nicht nur eine Klause am Kaspischen
Meer (in Siyävorüd), sondern noch eine zweite mehr land¬
einwärts, im Dorfe Heliyyä-gerän (?), von dem mir weiteres
allerdings nicht bekannt ist*).
II.
Das iranische Löwen-Sonnen-Wappen (Mit einer Tafel)
Im Jahre 1930 ist im ^^äuar-Verlage zu Teheran eine
kleine, 31 Seiten umfassende Schrift erschienen mit dem
Titel: Td'rlhöä-ye Sir ö hgrSld — The History of ''The Lion
and Sun". Der Verfasser, Sayyed Ahmad Kasravi aus Tabriz,
ist zu den noch nicht allzu zahlreichen iranischen Gelehrten
der Gegenwart zu zählen, die gründliche Kenntnisse in Ge¬
schichte und Schrifttum ihrer Heimat verbinden mit der
wissenschaftlichen Schulung des Westens. So hat beispiels¬
weise V. Minorskij in seiner Abhandlung La Domination des
Dailamites^) mehrfach die scharfsinnigen und tiefschürfenden
Untersuchungen Sayyed Kasravis über verschollene iranische
Herrscherhäuser herangezogen, die in drei Lieferungen (bahS)
1928—30 ebenfalls im .gTawar-Verlage in Teheran unter dem
Titel Sahryärän-e gomnäm erschienen ist.
Da über Herkunft und Verbreitung des iranischen Löwen-
Sonnen-Wappens abendländische Arbeiten, soweit ich sehe,
nicht vorliegen*), gebe ich im folgenden den Inhalt der erst-
1) Ebenda S. 13. 2) Selselat S. 22.
3) Publications de la Societe des Etudes Iraniennes et de l'Art Persan, Isr. 3, Paris 1932.
4) Auch Yacocb Artin Pacha berührt in seiner Contribution ä
V&ude du Biosan en Orient, London 1902, S. 62—65, nur Icurz das
erstmalige gemeinsame Auftreten beider Sinnbilder auf rüm-selguki- schen Münzen.
G •
72 W. Hinz, Beiträge zur iranisclien Kulturgeschichte
genannten Schrift Sayyed Kasravis in gedrängter Form
wieder. Gleichzeitig wurden an Hand der Schätze des Münz¬
kabinetts der Berliner Staatlichen Museen zahlreiche Ergän¬
zungen vorgenommen und die Entwicklung durch Münz¬
beispiele belegt (siehe die Tafel). Hierbei habe ich von Herrn
Dr. W. Hellige umsichtige und sachkundige Unterstützung
erfahren, für die ich ihm zu Dank verbunden bin.
Sayyed Kasravi geht in der Einleitung zu seiner Schrift
zunächst auf die in Iran landläufige Erklärung des Löwen-
Sonnen-Wappens ein: danach gelte der Löwe ursprünglich
als Sinnbild der Armenier, wie die Sonne als das der Perser;
Schah 'Abbäs der Große (1587—1629) habe dann, als er die
Selbständigkeit Armeniens vernichtete, zum Gedenken an
diesen Sieg die Sonne hinter dem Löwen als neues Sinnbild
anbringen lassen.
Sayyed Kasravi weist darauf hin, daß diese Erklärung
aus zahlreichen Gründen als Fabel gelten muß, vor allem
deshalb, weil es Münzen mit diesem Sinnbild aus viel früherer
Zeit gibt, ganz abgesehen von dem Umstand, daß Armenien
seine Selbständigkeit nicht erst unter 'Abbäs I. verloren hatte.
Der erste Abschnitt {goftär-e nohostln) behandelt sodann
das voneinander unabhängige Auftreten der beiden Sinn¬
bilder Löwe und Sonne.
Der Löwe als Sinnbild der Kraft und heldischen Mutes
ist bekanntlich sehr alt; der Entwicklung dieses Sinnbildes
nachzugehen, würde hier zu weit ab führen. Darstellungen
eines Löwen als Sinnbild für den gleichlautenden Herrscher¬
namen scheinen sich erstmalig auf den Münzen des armeni¬
schen, in Cilicien seßhaft gewesenen Herrscherhauses der
Rupenier (1080—1393) zu finden*). Der erste König aus
diesem Baronsgeschlecht, Leon II. (als Leon I. 1198 gekrönt),
sowie dessen Nachfolger ließen ihre Münzen fast durchweg
mit dem Bilde eines Löwen prägen (siehe Abb. 1). Daß der
Löwe in Iran aber schon in vorislaniischer Zeit als Sinnbild
bekannt war, geht einwandfrei aus den achämenidischen
1) Vgl. Jacques de .Morgan, Histoire du Peuple Armenien, Paris
1919, S. 193.
W. Hinz, Beiträge zur iranisclien Kulturgescliichte 73
Steinbildern in Persepolis hervor. Für seine Verwendung auf
Bannern in frühislamischer Zeit liefern Belege die Dichtungen
alter Meister; Sayyed Kasravi führt u. a. zwei hierher¬
gehörende Verse Azraqis aus der Selgukenzeit an. Im Säh-
Nämä Ferdousis findet sich eine aufschlußreiche Beschreibung
der Banner im Lager Rostams vor dem Kampf mit Sohräb*).
Da Ferdousi sasanidische Stoffe verarbeitet hat, erscheint es
nach dieser Beschreibung wahrscheinlich, daß die Iraner be¬
reits in vorislamischer Zeit teils den Löwen, teils die Sonne,
teils andere Sinnbilder im Banner führten.
Das Sinnbild der Sonne auf Bannern wird außer bei
Ferdousi nur noch bei Nezämi aus Gangä erwähnt, und zwar
in seinem 1188 entstandenen Dichtwerk Läilä ö Magnün.
Aus der von Sayyed Kasravi angeführten Stelle geht — bei
Abstreifung allen dichterischen Schmuckes — hervor, daß
auf den Fahnen teils eine zehnstrahlige Sonne, teils ein Löwe
mit olTenem Rachen dargestellt war. Nezämi kannte aber
schwerlich die Banner der arabischen Wüstenbewohner, deren
Kämpfe er schildert; vielmehr ist anzunehmen, daß er die
Fahnen seines Landes und seiner Zeit zum Vorbild nahm.
Im zweiten Abschnitt seiner Darlegungen geht Sayyed
Kasravi auf die erstmalige Vereinigung beider Sinn¬
bilder ein. Dies geschah im Jahre 638/1240-1 durch den
Rüm-Selguken Käi Hosrou IL; nicht nur die Münzkunde er¬
weist dies*), sondern auch die Geschichtsschreibung des Abu'l-
Farag (Barhebräus, Muhtasar taVih al-duwal, Ausgabe Säl-
häni, Beyrouth 1890, S. 447) und Mustafä Genäbis ( Ta'rlh,
türkische, vom Verfasser selbst besorgte Übersetzung seiner
arabischen Weltgeschichte, Handschrift 85.'j der Wiener
Nationalbibliothek, vgl. Flügel, Katal.
Der Vorgang wird kurz so geschildert: Der rüm-selgukische
Herrscher Giyäsu'd-Din Käi Hosrou 11. (1236—47) war in
eine georgische Prinzessin so verliebt, daß er ilir Bild auf
1) Le Livre des Rois par About Kasim Firdousi, hrsg. von Jüles
MoHL, Bd. II, Paris 1842, S. 132-36.
2) Vgl. Stanley Lane-Poole, The Coins of the Turkuinän Houses
of Seljoo'; etc. in the British .Museum, London 1877, S. 70.
74 W. HiKz, Beiträge zur iranischen Kulturgeschichte
seinen Münzen anzubringen wünschte. Die Großen des Rei¬
ches wollten jedoch eine solche Durchbrechung der islamischen
Vorschriften nicht dulden. Als er aber auf seinem Vorsatz
bestand, schlugen sie eine mittlere Lösung vor: er solle einen
Löwen als Sinnbild für ihn, den Herrscher, auf den Münzen
anbringen lassen und darüber eine Sonne als Sinnbild für die
strahlende Schönheit der georgischen Prinzessin; dies würde
zugleich sein Horoskop (!) veranschaulichen. Und so geschah
es (siehe Abb. 2).
Der dritte und letzte Abschnitt behandelt die Ausbreitung
des Löwen-Sonnen-Sinnbildes und seine Erhebung zum
iranischen Reichswappen.
Leider fänden sich, so meint Sayyed Kasravi, für die rund
250 Jahre, welche die Herrschaft Käi Hosrous II. von den
Safaviden trennen (d. h. für die Zeit von 1247 bis 1500), so
gut wie keine Quellen zu unserem Gegenstand. Da jedoch das
Löwen-Sonnen-Bild unter den Safaviden (bei Münzen aller¬
dings nur auf kupfernen) sehr bekannt und gebräuchlich war,
so könne man aus zwei Gründen erschließen, daß es auch in
der Zwischenzeit nicht verlorengegangen sei: denn erstens
sei nicht anzunehmen, daß die Safaviden dieses Sinnbild auf
Grund der Münzen Käi Hosrous II. wieder eingeführt haben,
um so mehr, als man damals Münzen noch nicht zu sammeln
pflegte; zweitens sei auf den Münzen des Rümselguken die
Sonne rund und von dem Löwen getrennt, während die
Safaviden (wie noch heute üblich) auf Münzen die Sonne
hinter dem Löwen aufgehen ließen, die dadurch halb ver¬
deckt wird. Die Richtigkeit dieser Beweisführung Sayyed
Kasravis läßt sich wie folgt belegen.
Der mongolische Il-ffän ölgäitü Mohammad Hodäbändä,
der von 1305 bis 1316 über Iran herrschte, hat das Löwen-
Sonnen-Bild auf seinen Kupfermünzen anbringen lassen und
damit die von Käi Hosrou II. geschaffene Überlieferung fort¬
geführt. Abb. 3 zeigt eine solche Münze vom Jahr 714/1314.
ohne Prägeort; eine ähnliche besitzt auch Sayyed Kasravi.
ölgäitüs Sohn und Nachfolger Abü Sa'id behielt diese
Prägungsart bei, so daß auch für die Zeit von 1316 bis 1335
W. Hinz, Beiträge zur iranischen Kulturgeschichte 75
das Löwen-Sonnen-Bild in Iran bezeugt ist. Die in Abb. 4
wiedergegebene Münze, leider ohne Jahreszahl, stammt aus
Tabriz; ein anderes Beispiel ist bereits von St. Lake-Poole
veröffentlicht worden*).
Für die Zeit Timurs (1370—1405) fmden wir einen Beleg
bei Ruy Gonzalez de Clavijo, dem Botschafter Königs
Henrique III. von Castilien. In seiner Geschichte des großen
Tamerlan heißt es: ,,Über dem Tor [des Schlosses zu Quex =
Ke§ oder Sahresabz in Turkestän] war in der Mitte ein Löwe
in einer Sonne abgebildet")." Da dieser von persischen Mei¬
stern ausgeführte Bau auf Timur selbst zurückging, so ist
der Nachweis für das Fortbestehen unsres Sinnbildes auch
für die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts erbracht.
Überraschenderweise konnte Dr. Hellige das Löwen-
Sonnen-Zeichen auch auf Kupfermünzen der Turkmenen¬
fürsten vom Stamme der Aq-Qoyunlu oder „Weißen Horde"
feststellen. Diese hatten zur Kennzeichnung ihrer Herden ein
Tamga folgender Gestalt: IO, das sich auch regelmäßig auf
den Münzen der Aq-Qoyunlu findet'). Die Verwendung des
Löwen-Sonnen-Bildes seitens der Weißen Horde ist um so
beachtlicher, als diese erst seit dem Sieg Uzun Hasans über
Gehänääh Qara-Qoyunlu im Jahre 1467 zur Herrschaft über
Iran gelangte, unsre Münzbeispiele (Abb. 5 und 6) jedoch
zweifellos aus einer Zeit stammen, als die Weiße Horde erst
über das Gebiet von Diyärbekr in Kleinasien gebot, d. h. aus
der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Auf beiden in Rede
stehenden Kupfermünzen ist nämlich 'Osmän und Hamze
(leider gleichzeitig) zu lesen, auf der ersten (Abb. 5) vielleicht
auch „Mardin" als Prägeort. Hieraus wird man schließen
dürfen, daß sie von Fürst Hamze ibn 'Osmän Qara Ilük
stammen, der von 1437 bis 1444 über die Weiße Horde
herrschte, seinen Stammsitz aber in Mardin hatte*).
1) The Coins of the Mongols in the British Museum, London 1881,
Abb. 264 auf Tafel iv.
2) Historia del Gran Tamorlan, Sevilla 1582, S. 41b—42 a: Encima de la portada en medio della estaua figurado un Leon metido en vn Sol.
3) Vgl. mein Irans Aufstieg zum Nationalstaat, S. 106.
4) Ebenda S. 130/31.
76 W. Hinz, Beiträge zur iranisclien Kulturgeschichte
Die Safaviden (1500-—1722) als politische Erben der
Weißen Horde setzten die Überlieferung fort, allerdings nicht
schon Schah Isma'il der Reichsgründer (1500—24) selbst.
Weder auf Münzen noch auf Bannern dieses Großkönigs er¬
scheinen Löwe und Sonne; im ersten Fall zeigen dies die
Münzen aus jener Zeit, im zweiten die ausführlichen Be¬
schreibungen der Banner Isma'ils 1. durch den Dichter
Qäsemi Gonäbadi.
Schah Tahmäsp der Gebildete (1524—76) schenkte dem
Löwen-Sonnen-Bild mehr Beachtung als sein Vater. Da er
aber bezeichnenderweise annahm, es hänge mit dem Horoskop
des betreffenden Herrschers zusammen, er selbst jedoch im
Zeichen des „Widders" geboren war, so ließ er auf der einen
Seite seiner Kupfermünzen die Sonne hinter einem Widder
aufgehen! Sayyed Kasravi besitzt zwei dieser seltenen
Sonnen-Widder-Münzen ; auf der einen ist deutlich der Name
des Schah Tahmäsp zu lesen. Daraus kann man vielleicht
schließen, Schah Isma'il der Reichsgründer habe das Sinnbild
deshalb nicht verwendet, weil auch er die Bedeutung des
Löwen mit dem Horoskop in Verbindung brachte, er selbst
aber im Zeichen des „Krebses" geboren war und offenbar
nicht wünschte, die Sonne auf Münzen hinter einem Krebs
aufgehen zu lassen, was ein unschönes Bild ergeben hätte.
Das Berliner Münzkabinett besitzt kein Beispiel der erwähn¬
ten Tahmäsp-Münzen; als Entsprechung sei vorgreifend auf
Abb. 8 verwiesen, die eine sog. Tierkreismünze des Gro߬
moguls Gehängir aus Agra vom Jahre 1030/1621 mit Sonne
und Widder darstellt.
Schah 'Abbäs der Große (1587—1629) setzte sich jedoch
über Bedenken der Sterndeutekunst hinweg; denn er führte
wieder das Löwen-Sonnen-Bild ein, obwohl er im Zeichen der
..Jungfrau" geboren war. Zwar gibt es Münzen aus der Zeit
dieses Großkönigs, auf denen sich nicht nur ein Löwe allein
befindet (so weisen merkwürdigerweise alle damals in Mäzan¬
darän geprägten Kupfermünzen keine Sonne auf), sondern
auch ein Löwe mit einem Stier — wobei vielleicht an die
Darstellung eines Löwen in Persepolis als Vorbild zu denken
W. Hinz, Beiträge zur iranisclien Kulturgescliichte 77
ist, der seine Pranken in den Leib eines Stieres bohrt. Auch
andere Tiere wurden zu jener Zeit verwendet: Elefanten,
Pfauen usw. Immerhin kommen Löwe und Sonne vereint am
häufigsten vor, und daraus erklärt sich wohl auch, daß man
in Iran Schah 'Abbäs I. die Schaffung dieses Sinnbildes zu¬
schreibt, während er es doch nur wieder allgemeiner bekannt
machte.
Auch unter seinen Nachfolgern bis zum letzten Vertreter
der Safaviden finden sich ohne Unterschied Münzen mit
Löwe und Sonne. In der Dichtung wird ebenfalls dieses Sinn¬
bild auf den Kupfermünzen erwähnt; z. B. bei Mollä Navidi
aus Siräz und bei Mollä Qodrati, die beide zur Zeit des Schah
Soläimän (1666—94) lebten. Als Beispiel zeigt Abb. 9 eine
Münze des letzten Safaviden Schah Hosäin (1694—1722) vom
Jahre 1115/1703-4.
Die kulturliche Abhängigkeit des Mogulreiches vom Iran
der Safaviden beleuchten eindrucksvoll die beiden Beispiele
von Goldmünzen Gehängirs, des Sohnes Kaiser Akbars, die
wir in Abb. 7 und 8 veröffentlichen (letztere ohne Ort aus
dem Jahre 1020/1611-2).
Aus den von Sayyed Kasravi wiedergegebenen Münzbei¬
spielen geht hervor, daß zur Zeit der Safaviden eine genau
festgelegte Form für Löwe und Sonne noch nicht bestand;
an jedem Prägeort hatte das Sinnbild eine andere Gestalt.
Für die Verwendung des Sinnbildes auf den Bannern der
späteren Safaviden haben wir gleichfalls Belege. Im Jahre 1715
war der Statthalter von Erivän, Mohammad Rezä Beg, von
Schah Hosäin als Botschafter zu König Ludwig XIV. ge¬
schickt worden. In dem Buche von Maurice Herbette:
Une Ambassade Persane sous Louis XIV (Paris 1907) finden
sich Abbildungen auf Grund zeitgenössischer Stiche, aus
denen ersichtlich ist, daß die Banner der Iraner zu jener Zeit
gleichfalls Löwe und Sonne aufwiesen*), allerdings wie bei
1) Ein so aufmerksamer Beobachter wie J. Charoin [Voyages du
Chevalier Chardin, en Perse usw., hrsg. von L. Lanol^s, Paris 1811,
Bd. v, S. 321) berichtet jedoch nur von Wimpeln mit Aufschriften
(äi'itisches Glaubensbekenntnis oder Qor'än-Stellen) oder der Abbildung des berühmten zweispitzigen Schwertes 'Alls, des Zü'l-Faqär.
78 W. Hinz, Beiträge zur iranisclien Kulturgeschichte
den Münzen Käi Hosrous 11. die Sonne als Kreis losgelöst
von dem Löwenrücken.
Selbst für das kurze Gastspiel, das die Afghanen nach
dem Sturz der Safaviden in Iran gaben, fehlt es nicht an
Belegstücken für unsere Untersuchung. Abb. 10 zeigt eine
Löwen-Sonnen-Münze des Afghanenfürsten A§raf, die 1138/
1725-6 in Baghdad geprägt worden ist.
Danach tritt allerdings eine Lücke ein insofern, als bisher
weder von Näder Säh (1736—47) noch von Karim Hän Zänd
(1750—79) und dessen Nachfolgern Münzen mit Löwe und
Sonne bekannt geworden sind. Das gleiche gilt auch noch für
den ersten Herrscher aus dem Hause der Qagaren, Äqä
Mohammad Hän (1796-7). Anders Hegt der Fall jedoch bei
dessen Nachfolgern Fath 'Ali Säh und Mohammad Säh.
Abb. 11 stellt eine solche Münze Fath 'Ali Säbs (1797—1834)
dar, die in Erivän mit dem christlichen Datum 1821 geprägt
worden ist. In dem während der Herrschaft Mohammad Sähs
^1834—48) entstandenen Buch La Perse von Louis Dubkux
(Paris 1841) ist auf S. 462 erwähnt, der Großkönig habe
mehrere Banner, auf denen entweder das zweispitzige Schwert
'Alis oder eine aufgehende Sonne hinter einem liegenden
Löwen abgebildet sei. Dieses Wappen sei auf Fahnen ge¬
stickt und in die Mauer des Königsschlosses gehauen; auch
werde es als Ordensauszeichnung verwandt.
Hier erhebt sich nun die Frage, wann das Löwen-Sonnen-
Bild zum Reichswappen Irans erhoben worden ist.
Sayyed Kasravi stützt seine Untersuchung hierzu im
wesentlichen auf Kupfermünzen und kommt zu dem Schluß,
um 1272/1855-6 (also unter Schah Näser od-Din, 1848—96)
sei das Sinnbild der noch heute gültigen Gestalt schon sehr
angenähert, der Löwe allerdings liegend und ohne Schwert;
die Kupfermünzen um 1284/1867 hätten die neue Form end¬
gültig, mit stehendem Löwen und einem Schwert in der
einen erhobenen Vorderpranke. Daher sei die Entstehung des
persischen Reichswappens in die Zeit um 1865 zu legen.
Dies ist jedoch irrig, denn tatsächlich gibt es erstmalig
bereits im Jahre 1258/1842 Silbermünzen in der neuen, noch
W. Hinz, Beiträge zur iranischen Kulturgeschichte 79
heute gängigen Gestalt (Abb. 12, Teheran 1842)*). Das Jahr
1842 ist daher als Entstehungsjahr des iranischen Reichs¬
wappens anzusehen, wenngleich es sich als alleingültige Form
erst später durchgesetzt hat. Sein Schöpfer ist somit nicht
Näser od-Din, sondern bereits dessen Vater Mohammad Säh.
Es stellt sich dar offenbar als die Vereinigung der drei Sinn¬
bilder Löwe, Sonne und 'Ali-Schwert, wie sie damals auf den
Bannern üblich waren. Seit 1842 liegen nun auch alle Einzel¬
heiten der Anordnung fest: der Löwe hat das Haupt stets
auf der linken Seite, sein Schweif ist gekrümmt; er besitzt
eine Mähne, die früher fast durchweg fehlte; er steht und
wendet den Kopf dem Beschauer zu. Nur im iranischen
Außen- bzw. Kriegsministerium behielten die Orden die Ge¬
stalt wie zur Zeit Fath 'Ali Sähs*), d. h. den liegenden Löwen.
1) Vgl. auch R. Stüart Poole, The Coins of the Shdhs of Persia, London 1887, S. 182 bzw. Tafel xv.
2) Vgl. über die Einführung dieses Ordens, die auf die Beziehungen zu Napoleon zurückgehen dürfte, die Angaben Hodtdm-Schindlbr's bei Yacoub Artin Pacha, a. a. O. S. 68/69.
Achämenidisches
Von F. H. WeiBbach-Leipzig
1. Zu den „Inschriften unbestimmter Herkunft"
Unter dieser Überschrift hatte ich in meinen Keihnschriften
der Achämeniden (VAB III, Lpz. 1911), S. XXIX, drei kurze
Bruckstücke (zwei altpersische und ein babylonisches) an¬
geführt und SS. 130 f. umgeschrieben, das dritte etwas längere
(Incerta c) auch zu übersetzen versucht. Dieses Stück hatte
1900 Scheil (DP T. II pp. 126ss.) als den zweiten von zwei
Textes des rois achemenides in Typendruck mitgeteilt,
transkribiert und übersetzt. In seiner Besprechung des
Scheil' sehen Werkes äußerte H. Winckler (OLZ 1901 Sp.452)
die Vermutung, daß das Bruckstück von Darius herrühre,
und teilte einige von Schkil abweichende Auffassungen der
Umschrift und Übersetzung mit. Winckler's Vermutung
wurde 1914 als richtig erwiesen, als Pillet (Le Palais de
Darius P'' p. 55) den 1913 geglückten Fund eines Duplikates
erwähnte, das die Zuweisung an Darius I. sicherte. 1929 hat
dann Scheil (DP T. XXI pp. 3ss. pll. I — XI) aus einer
großen Anzahl altpersischer, elamischer und babylonischer
Bruchstücke eine neue hochwichtige dreisprachige Inschrift
zu einem guten Teil wiederherstellen können, die er zutreffend
Charte de Fondation du Palais benannte. Die vormalige
Incerta c, die rechte untere Ecke einer Steintafel, erscheint
jetzt als Fragment E (Vorderseite und unterer Rand) und
J (Rückseite) auf pll. I und II in DP T. XXI i).
1) Weitere Bruclislüclce der obigen Insclirift liat Schkil bekanntlich
DP T. XXIV pp. 105-115, pll. Iiis. (1933) mitgeteilt. Über die Be¬
arbeitungen der Inschrift durch andere Gelehrte vgl. die Nachweise von Roland G. Kent (Journal of the Amer. Orient. Soc. Vol. 56 p. 211 n. 33).