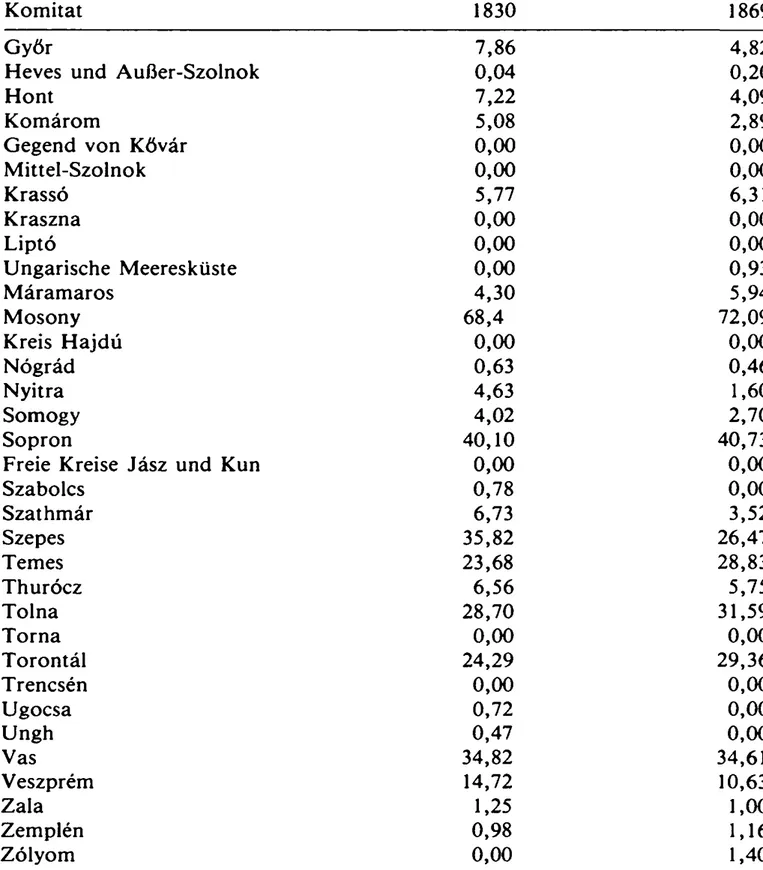(eBook - Digi20-Retro)
Verlag Otto Sagner München ∙ Berlin ∙ Washington D.C.
Digitalisiert im Rahmen der Kooperation mit dem DFG-Projekt „Digi20“
der Bayerischen Staatsbibliothek, München. OCR-Bearbeitung und Erstellung des eBooks durch den Verlag Otto Sagner:
http://verlag.kubon-sagner.de
© bei Verlag Otto Sagner. Eine Verwertung oder Weitergabe der Texte und Abbildungen, insbesondere durch Vervielfältigung, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Verlages unzulässig.
«Verlag Otto Sagner» ist ein Imprint der Kubon & Sagner GmbH.
Georg Brunner (Hrsg.)
Die Deutschen in Ungarn
herausgegeben im A uftrag der Südosteuropa-Gesellschaft
von Walter Althammer
Die Deutschen in Ungarn
Herausgegeben von Georg Brunner
Südosteuropa-Gesellschaft
München 1989
CIP-Titelaufnahme der Deutschen Bibliothek
Die Deutschen in Ungarn / Südosteuropa-Ges. Hrsg. von Georg Brunner. — München: Südosteuropa-Ges., 1989
(Südosteuropa-Studien; Bd. 45) ISBN 3-925450-14-9
NE: Brunner, Georg [Hrsg.]; Südosteuropa-Gesellschaft; GT
© 1989 by Südosteuropa-Gesellschaft, D-8000 München Alle Rechte Vorbehalten
Gesamtherstellung: prograph gmbH, D-8000 München
VORWORT
Der vorliegende Band ist aus einem Symposion hervorgegangen, das am 25./26.
Juli 1988 in der Winterscheider Mühle von der Südosteuropa-Gesellschaft in Zusammenarbeit m it dem Internationalen K ulturinstitut Ungarns veranstaltet worden ist. Er behandelt in neun Einzelbeiträgen die Lage der deutschen Volks- gruppe in Ungarn seit den Anfängen im M ittelalter bis zur Gegenwart. Daß über ein derartiges Thema eine gemeinsame Tagung deutscher und ungarischer Wis- senschaftler nicht nur schlechthin abgehalten werden, sondern auch in einer nüchtern-sachbezogenen und zugleich ausgesprochen freundschaftlichen Atm o- Sphäre ablaufen konnte, ist keine Selbstverständlichkeit. Sie zeugt auf beiden Sei- ten von einer Entemotionalisierung dieses m it vielen historischen Hypotheken belasteten Problems und auf ungarischer Seite von einer grundlegenden Neu- Orientierung der Nationalitätenpolitik im allgemeinen und einer veränderten Grundeinstellung zur deutschen Volksgruppe im besonderen. Die seit geraumer Zeit zunehmend liberale und auf eine Förderung der nationalen Minderheiten gerichtete P olitik der ungarischen Regierung läßt heute die gemeinsame Erörte- rung politisch noch so brisanter Probleme aus Geschichte und Gegenwart völlig problemlos erscheinen. Da ein Problem begrifflich immer etwas Nicht-Selbstver- ständliches bedeutet, ist es selbstverständlich, daß bei der Bewertung historischer Probleme und bei der Suche ńach Lösungen von Gegenwartsproblemen unter- schiedliche Meinungen vertreten werden können. Wichtiger als der Umstand, daß in den Referaten und ihrer anschließenden Diskussion nur in relativ gerin- gern Umfang Meinungsverschiedenheiten aufgetreten sind, ist die Tatsache, daß diese Meinungsverschiedenheiten nicht anhand der Zugehörigkeit zum ungari- sehen oder deutschen Teilnehmerkreis verortet werden konnten. Alle Teilnehmer waren sich einig im Bemühen, der historischen Wahrheit und der zeitweise natur- gegeben unterschiedlichen Interessenlage der ungarischen Staatsnation und der deutschen Volksgruppe Gerechtigkeit angedeihen zu lassen, um auf dem Wege besseren Verständnisses zu befriedigenden Lösungen der Gegenwartsprobleme voranzuschreiten.
Eine Tagung und ein Buch sind immer das gemeinsame Werk mehrerer Perso- nen, die sich in besonderer Weise für das Gelingen des Vorhabens engagieren. In diesem Falle gebührt Frau Éva Rázsó vom Internationalen Kulturinstitut Ungarns und Herrn Professor Dr. Imre Takács von der Eötvös-Loránd-Universi- tat Budapest für den ungarischen Anteil herzlicher Dank. In der Südosteuropa- Gesellschaft haben der Geschäftsführer, Herr Dr. Roland Schönfeld, und Frau Gudrun Kuhlmann M .A . die Hauptlast der organisatorischen Vorbereitungen getragen. Auch ihnen sei für ihren Einsatz herzlich gedankt.
Prof. Dr. Georg Brunner, Köln
11■
II ІГ II V ■ *
I l I
-״י ,
* * Ł -־
1
• и 1 Л
J U Vf (1 I i ł 1׳-! *' tnTyïy, :־Vi- Il ־:
I l n - k T M ii« ׳״
״
״ . h״ t-
:׳)■•■_
ļ l - J j L j ļ
л , ו י -י и . י r • 1 !■ jV If■ '-! ' f
ч
■
■ י י Г
■!
״
״ ^ 3 1
׳ד י ו נ»!^־
v
l i l l
! L i
1-*v :- v 4 - * ,׳ד ו L1״ J ^ r׳ • ■ ■ ч щ
П т г , , п П Н r p ■4YÍ-.I־ a n ׳ [ ! - L iķ ■ ^ > » J
■vi»
1* ׳l < Ь ч ■ » ׳ ļ^ j ļv ■
1. V . ■ ■ļMgR ķ • ׳
״j * -, ■s ī ׳j 6׳ . ־ V . ū ņ ļ t י > B f c J
־r f f î II
\ מ!
•*«
i í i ' *
I 1'
A'
г » ׳,
д- .
ѣЧ
ч׳' *
і -'цс! rj" ן И ■ *נו ł.״ ^ ‘ ,i l Г״ • iî #-״ י «, I. י ,- Д ^ І
1׳ ! " I 11 I * # L' ך JCLl
*י i * * ! ׳4 >“■־׳, L j * ^ ■ ״־
■י
״־-■
ן « i•rj; p=ļ II •I t *У ,, ,י ־י4י " J Ê ^ - ־ Д 1־״י4№ י ״ י
* 15 • i г, ņ j " Ī * U L ' ч > ' ■ J p liM i r - r J » в :
f ,^ י ז 4 # 1 1
^ ׳ ^
׳ ׳ ׳ ,
״
I igÖJP
D
I I I ׳ ך ^ |
־'־ IŪ J I
-J ■V . י■ ןל ו
״ . ' У ļ f U ļ ļ ļ • ill
th ^чѴі
II ■II^ j l l l ^ t l l
• I! .. jjiU L J ft 9 І -
ןיי i .יי יי * Lr т י
Л \ г I “tJ I I I T -,״־־V ' ļ p : "4 ; ־
. У ■ ־ » ■ ״ ־ » . /*פ
ו r r a /tn Y ^ f- Гт і: ־пГ ,ѵ^
■iT*!■ • к a t *
и I .
_י
* 11 ז
.י J ,»!;►*ты II-
I 4
" ־ с 1v fy
=••
1 י.־
й - • w . ^ ļ
"
,
״*
5
• ■ f f
־ ^ ł f i P
!יי י
;|
ī _ ׳
® r t -־
i
׳ Й 4 f c . ! ״
4
■ ^ .
•- JU*L
n f i , ..• ļ j l ^ ŪL| # '-c : , i
י ו
T S Ā Л
_ - я
i V ־ iJJ I 'i. л.
i II
Georg Brunner - 978-3-95479-691-5
IN H A LT S V E R Z E IC H N IS
Is t v á n Dr a s k ó c z y
Das ungarländische Deutschtum im 15. Jahrhundert und am Anfang des
16. Jahrhunderts... 9
J Ó Z S E F K O V A C S I C S
Deutschsprachige Siedlungen in Ungarn im 17. und 18. Jahrhundert im
Spiegel der kirchlichen Quellen ... 29
Im r e W e l l m a n n
Die Ansiedlung von Deutschen in Ungarn nach der Befreiung von der tür-
kischen Besetzung im 18. Ja h rh u n d e rt... 49
Ka t a l i n Ko v a c s i c s
Deutsche in Ungarn — aus der Sicht ungarischer Gelehrter des 18. und 19.
Jahrhunderts... 63
Fe r e n c M a j o r o s
Deutsche in den ungarischen Freiheitskriegen... 73
Ek k e h a r d Vö l k l
Deutsche und Ungarn im West-Banat (1941— 1944)... 87
Ge r h a r d Se e w a n n
Das Deutschtum in Ungarn seit 1945 ... 97
Ge o r g Br u n n e r
Der völkerrechtliche Minderheitenschutz und die deutsche Volksgruppe in
U n g a rn ... 109
Im r e Ta k á c s
Die gegenwärtige Nationalitätenpolitik in U n g a rn ... 125 Autorenverzeichnis 131
■ ׳
• • ' * i . ; ä . «
I I1 ־ י י■׳
ж ; *
« и
ł
I I I I
I I I I
I L
L
_
■
־y * âm
IV ן
I.״-“
* ־,׳,-Jjph ! ״ ■■>'.. ‘ Sî-^ 1 ־ ■5י י י ׳
״
ן ■ » . W а '.и 1
■у
с Л 1 = ״ ־ г *ļipi ־: ‘ « ז ־# ; - Ł *־
г Л - * & '| ļL ־» ; г , -־Ц п ' IP
Il II I
"I*
Г - " ו
Il
J_ f *
г
4 ^ ^ T i .
* ą V *
i î f r Æ K■ > a
Il --- - I I I I
I I-J_
• 11• Í ' * * ־
־ 5
‘
־-' - Va *
r ו
Iá J
■ III
II
III I II
: 1
£»ו
!.
. ■ ■ ו1
,
\ ו
I r.
.лK*
I I
Tl
,LI
t g IjļļJ ļF jF - ļ
■ / ׳ è a n
,Ч Ч ѵ־ Л*■,
י׳׳ » י ל ־ /^ מ г a i , - . ־\
ווו
n 1 I Ш I :l l
* :1־Л г II-
I ■I
II I I I I I I P I l _ f l I I I
I
ןד
■гм _ jj
•
% >л* =
־-4 ־ ־I
1[
IL־'
■ I
II
־М . • ï *
IIIs t v á n D r a s k ó c z y
Das ungarländische Deutschtum im 15. Jahrhundert und am A nfang des 16. Jahrhunderts
Über das mittelalterliche ungarländische Deutschtum liegt umfangreiche Litera- tur vor. Die Forschung hat dieses Thema bereits unter verschiedenen Gesichts- punkten erschlossen.
Die Deutschen wanderten auf den R uf der ungarischen Herrscher ein. W ir wis- sen viel über ihre kulturellen Verhältnisse, aus welchen Teilen des deutschen Sprachgebietes sie kamen und unter welchen Bedingungen sie sich ansiedelten.
Auch über die Personen deutscher Abstammung, die in der Umgebung des Königs an der Regierung des Landes aktiv teilnahmen, wissen wir viel. In Dör- fern und Städten, am königlichen H o f, innerhalb des Adels und der Geistlichen begegnete man im mittelalterlichen Ungarn gleicherweise Deutschen.
Angesichts der in den Quellen vorkommenden Ortsnamen scheint es wahr- scheinlich, daß deutsche Siedler bereits vor der Landnahme in Ungarn lebten.1 Bei den staatsorganisatorischen Arbeiten des Großfürsten Géza und des Königs Stephan waren die deutschen Ritter behilflich, die am Kampf gegen die revoltierenden Stammesoberhäupter teilnahmen.2 Deutsche Ritter kamen auch später noch, einige von ihnen wurden die Gründer berühmter ungarischer Adels- geschlechter. Acht von den fünfzehn nachweisbar fremden arpadenzeitlichen Sippen waren deutschen Ursprungs. Es waren die Sippen Hont-Pázmány, Héder, Győr, Gut-Keled, Hermány, Ják, Balog, H ahót.3 Die meisten Einwanderer betrieben jedoch Ackerbau, Handwerk oder Handel. Bereits während Stephans Herrschaft erschienen sie in Ungarn. Ihre Zahl nahm später noch mehr zu. In den Quellen werden sie hospes genannt.
Die gesellschaftliche Situation eines hospes war im Arpadenzeitalter mit der von ungarischen Gemeinfreien identisch. Diese Rechtsstellung bewahrten sie sogar auf dem königlichen und kirchlichen Gut, obwohl hier die unterschiedli- chen Volkselemente, wenn sie auch nicht servus genannt wurden, unter der Leib- herrschaft des Königs bzw. der Kirche standen. Die hospites entgingen dieser proprius Abhängigkeit und wurden als freie Individuen angesehen. Das wichtig- ste Element dieser Freiheit war die Freizügigkeit.4
1 M a g y a ro rs z á g tö r té n e te (G eschichte U n g a rn s ). Bd. I, hg. G y . Székely, B u d a p e st, 1984. S. 353 f.
2 G y . G y ö rffy : W ir ts c h a ft u n d Gesellschaft d e r U n g a r n u m die J a h r t a u s e n d w e n d e , B u d a p e s t, 1983.
S. 173— 175. (S tud ia H isto r ic a A c a d e m i a e S c ie n tia r u m H u n g a r ic a e . 186.)
3 E . FUgedi: D a s m ittelalterliche K önigreich U n g a r n als G a s t l a n d , l n : Die d e u tsch e O sts ie d lu n g des M ittelalters als P r o b l e m d e r e u r o p ä is c h e n G e sc h ic h te , hg. W . Schlesinger, S ig m arin g en , 1975.
S. 496 f. ( V o r t r ä g e u n d F o r s c h u n g e n . H e r a u s g e g e b e n v o m K o n s ta n z e r A rb e its k re is f ü r m ittelalter- liehe G eschichte. Bd. 18.)
4 I. Bolla: A jogilag egységes j o b b á g y o s z t á l y k ia la k u lá s a M a g y a r o r s z á g o n ( E n tw ic k lu n g der rechtlich einheitlichen L eibeigenenklasse in U n g a r n ) , B u d a p e s t, 1983. S. 46, S. 228 f f ., S. 260, S. 280 f.
(Értekezések a történeti t u d o m á n y o k k ö ré b ő l. 100.)
Eine größere Ansiedlung der Deutschen erfolgte im 12. Jahrhundert. Damals kamen die zusammenhängenden deutschsprachigen Gebiete zustande, aus denen sich das Gebiet der Siebenbürger und Zipser Sachsen herausbildete. Im südlichen Teil Siebenbürgens kam die erste Welle der Ansiedler noch unter der Herrschaft von Géza II. an. Aus derselben Zeit stammen die Bewohner von Radna, ln Bistritz und Umgebung siedelten sich Deutsche am Ende des Jahrhunderts an, im Burzenland dagegen im folgenden Jahrhundert.5 Auch später kamen noch Sied- 1er in diese Gegend.
Auch die Besiedlung der Zips erfolgte nicht auf einmal. Die frühesten Einwoh- ner kamen bis zum Ende des 12. Jahrhunderts aus dem Süden, aus dem Gebiet der Komitate Abauj und Torna, wo sich in der M itte des 12. Jahrhunderts Deut- sehe angesiedelt hatten. Eine durchgehende Besiedlung der Landschaft erfolgte im 13. Jahrhundert, aber nicht nur vom Süden, sondern auch vom Norden, aus Schlesien.6 Die in der Umgebung von Hermannstadt und in der Zips auf königli- chem Gut angesiedelten Sachsen wurden im 13. Jahrhundert gesondert in einer gemeinsamen Verwaltungseinheit zusammengefaßt. Der Freibrief der Siebenbür- ger Sachsen wurde 1224 erlassen (Andreanum), und sie wurden dem Hermann- Städter Gespan untergeordnet. Neben dem Recht auf freie Pfarrerwahl durften sie auch ein eigenes Siegel verwenden. Sie schuldeten dem König Abgaben und den M ilitärdienst.7 Die Rechtslage der in der Zips lebenden Sachsen wurde 1271 von Stephan V. geregelt. Sie wurden einem gesonderten Gespan untergeordnet, der gemeinsam mit von den Sachsen gewählten Richtern urteilte. In den größeren und wichtigeren Angelegenheiten hatten sie aber gemeinsam m it dem Komitats- gespan zu entscheiden. Zu den Verpflichtungen der Zipser gehörte zu dieser Zeit auch der M ilitärdienst.8 Die in der Zips in der Umgebung von Gelnitz bzw. auf den Gütern der Feudalherren lebenden Sachsen genossen die Vorteile dieses Frei- briefes selbstverständlich nicht.
Die zehn Dörfer der Königin im Kom itat Abauj wurden im 13. Jahrhundert ebenfalls von einem gemeinsamen Gespan verwaltet.
Die nächste große deutsche Ansiedlungswelle setzte in der ersten Hälfte des 13.
Jahrhunderts ein und dauerte bis zur M itte des 14. Jahrhunderts.
Im 13. Jahrhundert gingen die königlichen Güter in den Besitz von Gutsherren über, die alles aufboten, um diese zu besiedeln und so fü r sich selbst verwendbar zu machen. Im Interesse der Ansiedlung erteilten sie den hospes unterschiedliche Privilegien (Recht der Richterwahl und richterliche Entscheidungsfreiheit in den
5 F. M a k s a y : Die A n s ie d lu n g der S a c h s e n . In: S ie b e n b ü r g e n u n d seine V ö lk e r , hg. E. M a ly u sz , B u d a p e s t-L e ip z ig - M ila n o , 1943. S. 137. — G y . G y ő r f f y : A z Á r p á d - k o r i M a g y a r o r s z á g tö rté n e ti f ö l d r a j z a . G e o g r a p h i a historica H u n g á r i á é t e m p o r e stirpis A r p a d i a n a e . Bd. 1. B u d a p e s t, 1963.
S. 553, 822.
6 A . F e k ete N a g y : A Szepesség területi és t á r s a d a l m i k i a l a k u l á s a (D ie E n t w i c k l u n g des Siediungs- rau rn s u n d d e r Gesellschaft in der Z ips), B u d a p e s t , 1934. S. 42 ff.
7 U r k u n d e n b u c h zur G e sc h ic h te d e r D e u ts c h e n in S ie b e n b ü r g e n , hg. F r. Z i m m e r m a n n , K. W e r n e r . Bd. 1, H e r m a n n s t a d t , 1892. S. 34— 35.
* G . F ejér: C o d e x d ip lo m a tic u s H u n g á r i á é ecclesiasticus а с civilis. Bd. V / 1 , S. 132. — E. M á ly u sz : A k ö z é p k o r i m a g y a r nemzetiségi p o litik a (Die N a t i o n a l i t ä t e n p o l i t i k U n g a r n s im M ittelalter). In:
S z á z a d o k , J g . 73. 1939. S. 390— 391.
eigenen Angelegenheiten, Freizügigkeit, Testierfreiheit, leichtere grundherrliche Lasten).9
Die Ansiedlung wurde o ft nicht vom Gutsherren selbst ausgeführt, sondern von einem speziellen Unternehmer, dem locator. Nach schlesischem Vorbild erschien in Nordungarn der Siedlerunternehmer, der scultetus. Er leitete die Rodung, vermaß das Feld, warb die Bevölkerung an. Als Gegenleistung erhielt er im D o rf steuerfreies Gut, eventuell erhielten er und seine Nachkommen auf ewig das Richteramt. Er hatte Anspruch auf einen Teil des gutsherrlichen Ein- kommens, auf das Mahlrecht und die Schankkonzession. Die Siedlungen dieses Typs wurden in Ungarn, auf den Ursprung der Institution hinweisend, deutsch- rechtliche Dörfer genannt. Der scultetus konnte seine Rechte auch verkaufen.
Nicht alle Siedler waren Deutsche. In großer Anzahl kamen auch Slawen.10 Im Unterschied zu den früheren Ansiedlungen entstanden die Siedlerdörfer jetzt nicht auf den königlichen Gütern, sondern auf den Privatgütern. Die deut- sehen Städte an den Ausgrabungsorten Schemnitz, Kremnitz, Neusohl, Königs- berg, Pukkantz usw. sind in dieser Zeit entstanden.11 In den Quellen des 13. Jahr- hunderts erscheint eine neue Benennung, libera villa. So wurden die privilegierten Ortschaften bezeichnet. Diese Benennung war auch im 14. und 15. Jahrhundert bekannt, zu dieser Zeit war sie mit der civitas gleichzusetzen. Die ungarischen Städte entstanden zum Teil aus diesen libera villa genannten Siedlungen.12
Die Herausbildung der bedeutendsten ungarischen Städte (z.B. Ofen, Eperies, Kaschau usw.) hängt mit dem Deutschtum zusammen, da ihre Gründer deutsche Siedler waren. O ft wurde die deutsche Bevölkerung durch das Handwerk und den Handel in die ungarischen Siedlungen gezogen. Diese Bevölkerung domi- nierte dann in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts in Städten wie Ödenburg und Preßburg.13
Eine neue Welle deutscher Ansiedlungen hing mit den Veränderungen des Handels zusammen und war in erster Linie auf die großen Handelszentren des Landes gerichtet. In der zweiten H älfte des 14. Jahrhunderts nahm Nürnbergs Rolle zu Lasten von Regensburg zu. Die in Ofen und anderswo angesiedelten Deutschen, die die Bürgerrechte und damit alle Handelsvorteile der Anwohner
9 G y. G y ö r f f y (wie A n m . 5) S. 44. — A . K ubinyi: Z u r F ra g e der d e u ts c h e n S ie d lu n g e n im m ittle ren Teil des K önig reich s U n g a r n (1200— 1541). S. 530 ff. In: Die d e u ts c h e O s ts ie d lu n g (wie A n m . 3).
10 E. Fügedi: N é m e t j o g u falv a k letelepülése a sz lovák és ném et ny elvterületen (Die A n s ie d lu n g d e u ts c h re c h tlic h e r D ö r f e r im s lo w a k is c h e n u n d d e u ts c h e n S p ra ch g e b iet). In: T a n u l m á n y o k a p ara sz tság t ö r té n e t é h e z M a g y a r o r s z á g o n a 14. s z á z a d b a n (Stu dien z u r G e s c h ic h te des B a u e r n t u m s in U n g a r n im 14. J h . ) , hg. G y. Székely, B u d a p e s t , 1954. S. 225 ff. — I. S z a b ó : A fa lu r e n d s z e r k ia la k u lá s a M a g y a r o r s z á g o n (D ie E n t s t e h u n g des D o r fs y s te m s in U n g a r n ) , B u d a p e s t, 1971. S. 115 ff.
" E. Fügedi (wie A n m . 3)
12 E. L ad á n y i: L ib e r a villa, civitas, o p p i d u m . T e r m in o l o g i s c h e F ra g e n in d e r u n g a r i s c h e n S t ä d te e n t - wicklung. In: A n n a l e s U n iv e rs ita tis S c i e n t i a r u m B udapestien sis d e R o l a n d o E ö t v ö s n o m i n a t a e . Sectio H isto r ic a . T . 18, B u d a p e s t , 1977. S . 8 — 10, S. 26— 27.
u E. Fügedi (wie A n m . 3) S. 4 9 9 — 500. — K. M o lla y : S c a r b a n t i a , Ö d e n b u r g , S o p r o n . S iedlungsge- schichte u n d O r t s n a m e n k u n d e . In: A r c h i v u m E u r o p a e C e n tro -O r ie n ta lis . Bd. 9 — 10. 1943— 1944.
S. 291. — J . Szücs: V á r o s o k és kézm ű v esség a X V . századi M a g y a r o r s z á g o n ( S t ä d t e u n d H a n d - werk im U n g a r n des 15. J a h r h u n d e r t s ) , B u d a p e s t , 1955. S. 25.
besaßen, waren eigentlich Ofener Agenten großer süddeutscher Handelsgesell- schäften. Deshalb bewahrten sie sowohl ihre verwandtschaftlichen als auch ihre Geschäftsbeziehungen zur Heim at.14
Die Wohnorte der Deutschen können im 15. Jahrhundert in drei Typen einge- teilt werden. Zum ersten Typ gehören die Ortschaften, in denen die Bevölkerung ausschließlich oder beinahe ausschließlich aus Deutschen bestand. In die zweite Gruppe gehören die Siedlungen, wo Deutsche und andere Nationalitäten gemein- sam lebten. Die letzte Gruppe bilden schließlich die Siedlungen, in denen Deut- sehe kaum vorkamen, und wenn doch, ihre Nationalität verloren hatten. Die Deutschen, die in ungarischen Dörfern oder Städten den Personennamen
״ Német“ (Deutscher) trugen, gehören der Gruppe der madjarisierten Deutschen an. Es steht auch fest, daß die in den Steuerkonskriptionen der Städte gelegent- lieh vorkommenden Unger oder Blesch (rumänisch) genannten Bürger nicht unbedingt Ungarn oder Rumänen waren. Eher wurde ein stufenweise verdeutsch- ter Bürger so bezeichnet.15
In einigen Regionen des Königreichs Ungarn kamen deutsche ethnische Einhei- ten im 15. Jahrhundert o ft vor, in anderen seltener. Im 13. Jahrhundert gerieten Deutsche im Laufe der Bevölkerungsbewegung auch in Gegenden, in denen sie sich allmählich in das umgebende Ungarntum assimilierten. Laut András Kubi- nyi begegnet man in der M itte des 14. Jahrhunderts auf der Tiefebene von Visonta im Mátragebirge bis zur Siedlung Apostag an der südlichen Donau einem einzigen Deutschen, dem teutonicus Lebel. Es lohnt sich, das Beispiel von Vi- sonta und Umgebung etwas ausführlicher zu untersuchen. Das im 13. Jahrhun- dert entstandene D o rf liegt in der unmittelbaren Nachbarschaft von Gyöngyös, dem Zentrum eines Weinanbaugebietes.16 Gyöngyös erhielt 1334 Städteprivile- gien; zu Beginn des 14. Jahrhunderts kamen hier deutsche Namen (Prysil, Detrich, Berthold) vor. Die Müller des nördlich von Gyöngyös in der Mátra lie- genden Dörfchens Bene hießen unter anderem Eburharth, Jensul, Gahan, Guch usw.17 Der Urkunde des Jahres 1358 aus Visonta, die über den teutonicus Lebel berichtet, ist zu entnehmen, daß die andere Hälfte des Dorfes ,,M agyarfalu“
(Ungarndorf) genannt wurde.18 In den sich entwickelnden Siedlungen der Gegend siedelten sich Deutsche an. In der Ortschaft Visonta, die zu dieser Zeit bereits M arkt war, bildeten sie ein gesondertes Viertel; der von Ungarn bewohnte Teil wurde demgegenüber ,,M agyarfalu“ genannt. Im 14. Jahrhundert war die- ses Deutschtum bereits im verschwinden, sonst hätte die Urkunde aus dem Jahre 1358 den teutonicus Lebel nicht besonders erwähnt. Die aus dem 15. Jahrhundert
14 A . K ubinyi (wie A n m . 9) S. 559 f.
15 E . M á ly u s z (wie A n m . 8) S. 402.
16 A . K u b in y i (wie A n m . 9) S. 556. — A n j o u k o r i O k m á n y t á r . C o d e s d i p l o m a t i c u s H u n g . A n d e g a - vensis, hg. I. N a g y , B u d a p e s t , 1878— 1920. Bd. VII. S. 59— 62. — G y . G y ö r f f y (wie A n m . 5) Bd.
III. B u d a p e s t , 1987. S. 145.
17 C o d e x d i p l o m a t i c u s H u n g , (wie A n m . 16) Bd. I. S. 3 f. — I. D r a s k ó c z y : G y ö n g y ö s település — és b i r t o k l á s t ö r t é n e t e a k ö z é p k o r b a n (Die Siediungs- u n d B esitzgeschichte v o n G y ö n g y ö s im M ittel- alter). In: T a n u l m á n y o k G y ö n g y ö s r ő l (Studien ü b e r G y ö n g y ö s ) , hg. P . H a v a s s y , P . Kecskés, G y ö n g y ö s , 1984. S. 104— 107.
18 C o d e x d i p l o m a t i c u s H u n g , (wie A n m . 16) S. 59.
erhaltenen Leibeigenenlisten aus dieser Gegend nennen keinen einzigen Deut- sehen.19
In einem anderen Teil der Tiefebene, neben dem Fluß Szamos, lag der M arkt- flecken Szatmárnémeti, der im 13. Jahrhundert von Deutschen bewohnt war.
Am Ende des 15. Jahrhunderts sind aus der Siedlung ausschließlich ungarische Namen bekannt.20
Ähnlich der Ungarischen Tiefebene, wo die sporadisch vorkommende deut- sehe Bevölkerung Gefahr lief, sich zu assimilieren, war die Situation in Ober- Ungarn, dem Gebiet der heutigen Slowakei. Bekanntlich gab es 1337 in Groß- michel eine Deutsche Gasse. Bereits 1449 gab es hier nur noch einige Personen, die deutsche Namen trugen (,,domus seu sessio Gabrielis Thewtunici, Kristel Thewtunus, Michael Sorman, Bartholomeus Németh“ ).21
In Oberungarn wurden die unbewohnten Gegenden durch scultes besiedelt.
Die scultes waren im allgemeinen deutscher Abstammung und ursprünglich Bewohner einer Stadt in der Nähe der zu gründenden Dörfer. Unter den ersten Siedlern dieser scultes-Dörfer können m it Recht Deutsche angenommen werden, aber selbstverständlich auch andere Nationalitäten. Diese scultes-Siedlungen übernahmen o ft das ursprünglich deutsche Privileg irgendeiner in der Nähe lie- genden Stadt, das ebenfalls auf die Anwesenheit von Deutschen hinweisen kann.
Die auf dem Magdeburger Recht basierende Rechtsgewohnheit der Stadt Sillein wurde von 13 Siedlungen übernommen.22 Demgegenüber steht auch fest, daß sich die spärliche Bevölkerung der scultes-Dörfer im nördlichen Teil des Komi- tats Trencsén bis zum 15. Jahrhundert in das umgebende Slawentum assimi- lierte.23
Im Privitz-Becken bewahrten die Deutschen eher ihre Eigenart. Deutsch-Pro- ben entstand vor 1337. Die von dort stammenden scultes besiedelten die Umge- bung. Den aus der Zeit von 1508— 1518 erhalten gebliebenen Leibeigenennamen des Dorfes Kasov ist aber zu entnehmen, daß den vier deutschen dreizehn slawi- sehe Namen gegenüberstanden. Die Bevölkerung der Dörfer mag also gemischt gewesen sein.
Ebenfalls gemischt war wahrscheinlich die Bevölkerung in der Umgebung der Bergstädte. Um Neusohl lagen deutsch benannte Siedlungen wie Ulmannsdorf,
19 U n g a ris c h e s S t a a t s a r c h i v , S a m m l u n g a u s der Zeit vor M o h á c s (k ü n ftig : Dl.) 2013, Dl. 11595, Dl.
22322. —־ G y ö n g y ö s i K a l e n d á r i u m , 1938. S. 283. — G . F e jé r (wie A n m . 8) Bd. X / 2 . S. 221.
20 F. M a k s a y : A k ö z é p k o r i S z a t m á r m egye (Das K o m ita t S z a t m á r im M itte la lte r), B u d a p e s t , 1940.
S. 211— 212.
21 A N a g y m ih á ly i és S ztára i g r ó f S z t á r a y család o k le v é ltá ra ( U r k u n d e n s a m m l u n g d e r g rä flic h e n F am ilie S z t á r a y v o n N a g y m i h á ly u n d S z tá ra ), hg. G y. N a g y , B u d a p e s t, 1887— 1889. Bd. 1. S. 147, Bd. II. S. 442 f. — B. V arsik : Sozial- u n d N a t i o n a l k ä m p f e in d e n S t ä d t e n d e r S low akei im M ittel- alte r. In: S b o r n i k F ilo z o fic k e j F a k u l t y Univerzity K o m e n s k é h o . H is to ric a . Bd. 16, B ratislav a ,
1965. S. 150.
22 H . W einelt: Die m itte la lte rlic h e d e u ts c h e K anzleisprache in d e r S lo w ak ei, B rü n n - L e ip z ig , 1938.
S. 241.
״ A . Fek ete N a g y : T r e n c s é n m eg ye (D a s K o m ita t T re n csén ). In: D. C s á n k i : M a g y a r o r s z á g tö r té n e ti f ö l d r a j z a a H u n y a d i a k k o r á b a n (Die historische G e o g r a p h i e U n g a r n s z u r Zeit d e r H u n y a d i ) Bd.
IV. S. 61.
Kostführersdorf, Henczmannsdorf. Die Dörfer bewahrten den Namen irgend- einer führenden Familie der Stadt und wiesen so auf ihren Ursprung hin. Der Name Sachsendorf oder Deutschdorf bezeichnet ebenfalls die Nationalität. Die dazwischen liegende Siedlung Kincelová hatte jedoch keinen deutschen, sondern einen slowakischen Namen, was darauf hinweist, daß die Bevölkerung dieser Gegend gemischt war.24
Die dem Herrscher gebührende Steuer wurde in Ungarn lucrum camerae genannt. Leider sind die Steuerbemessungslisten verlorengegangen. Dank eines glücklichen Zufalls sind jedoch die Steuerkonskriptionen dreier zusammenhän- gender Komitate (Sáros, Gömör, Abauj) aus dem Jahre 1427 erhalten geblieben.
Für unsere Betrachtung sind die drei Komitate deshalb interessant, weil sie neben der Zips liegen, wo die zahlenmäßig meisten Deutschen geschlossen lebten.
Das Kom itat Sáros wurde nicht nur von Deutschen aus Polen und Schlesien, sondern auch aus der benachbarten Zips besiedelt. Die deutsche Sprache von Abauj und Gömör ist mit einem Zipser Dialekt verwandt.25 Im folgenden soll versucht werden, den Anteil der deutschen Bevölkerung mit H ilfe der Steuer- konskriptionen zu schätzen. Die Angaben der siediungs- und ortsgeschichtlichen Fachliteratur sind wegen der spärlichen Quellen einigermaßen unsicher. Deshalb sind auch meine Ergebnisse nicht gesichert. Einige Schlußfolgerungen glaube ich aber ziehen zu können. Viele (insgesamt 43) auf die Rodung hinweisende Namen mit der Nachsilbe ,,hau“ sind im Komitat Sáros erhalten geblieben (z.B. Hen- nisghau, Bajerhau, Hertelhawo, Friskau).26 Im Komitat gibt es auch viele Orts- namen deutschen Ursprungs (Hermány, Herknecht, Henning, Langnow, Singler, Frydnau). Es ist aber schwer festzustellen, welche von ihnen am Anfang des 15.
Jahrhunderts deutsch waren. Das in den Steuerkonskriptionen des 16. Jahrhun- derts vorkommende Namensmaterial weist bereits auf einen slawischen Charak- ter hin. Das Deutschtum konnte vorwiegend in den der Zips benachbarten Gebie- ten erhalten bleiben. Die wichtigste Siedlung war Siebenlinder, wo die Steuerein- nehmer 1427 achtzig Fronhöfe registrierten. Siebenlinder war ein Marktflecken (oppidum). Deutsche lebten wahrscheinlich auch in anderen Marktflecken (Hanusdorf, Sáros, Palocsa, Sóvár, Kapi), aber nicht mit solch hohem Einwoh- neranteil. Zeben, Bartfeld und Eperies kamen in den Steuerkonskriptionen nicht vor. Ohne sie ist der Anteil der Deutschen an den Zusammengeschriebenen 6618
24 J . H a n i k a : O s t m i tt e ld e u ts c h - b a ir i s c h e V o lk s tu m s m is c h u n g im w e s tk a rp a tis c h e n B e rg b a u g eb ie t, M ü n s t e r , 1933. S. 22. ( D e u t s c h t u m u n d A u s la n d . S tu d ie n z u m A u s l a n d d e u t s c h t u m u n d z u r A us- l a n d k u l t u r ) — E. F ü g e d i: N y i t r a megye betelepülése (Die Besiedlung des K o m ita ts N e u tr a ), ln:
S z á z a d o k , J g . 72. 1938. S. 494 ff. — Ders.: A Felvidék te le p ü lé s tö rté n e té n e k u j a b b n ém e t iro- d a l m a (D ie n e u e re d e u t s c h e L i t e r a t u r ü b e r die S iedlungsgeschichte O b e r u n g a r n s ) . In: S z á z a d o k , J g . 75. 1941. S. 420.
25 A . F e k e te N a g y (wie A n m . 6) S. 4 3 — 44. — B. Varsik: O sidlenie Kosickej kotlin y (Die Besiedlung des K a s c h a u e r Beckens), B ra tisla v a , 1964— 1977. Bd. 111. S. 391.
26 J . H a n i k a (wie A n m . 24) S. 39. — R .F . Kaindl: G e sc h ic h te d e r D e u tsch e n in d en K a r p a t h e n l ä n - d e r n . Bd. II, G o t h a , 1907. S. 169— 170. (A llgem eine S ta aten g e sc h ic h te. A b t. III. D e u ts c h e L a n - d esg es c h ic h te 8.)
Pforten nach vorsichtiger Schätzung auf 15% anzusetzen.27 Infolge der Verwü- stungen durch die Hussiten verringerte sich dieser Anteil später wahrscheinlich.
Ebenfalls viele Opfer forderte 1490 der ungarisch-polnische Krieg. So wurden in Hesleng 1427 77 Pforten zusammengeschrieben. Bei der Steuerkonskription von 1492 wurden zwar einhundert Höfe registriert, aber von ihnen waren nur fiin - fundzwanzig Höfe bewohnt. Derselben Urkunde ist zu entnehmen, daß in O rtolth zweiundzwanzig von fünfundzwanzig Fronhöfen unbewohnt waren.
Ersetzt wurde die Bevölkerung durch Slowaken und Ruthenen.28
Der größte Teil der Bevölkerung des Komitats Gömör wohnte laut Bálint lias Monographie über die Geschichte des Komitats im Bergbaugebiet. Sie wurde von den Eisen- und Kupfererzlagerstätten angezogen. Als die Erzlagerstätten nicht mehr ergiebig genug waren, die angewachsene Bevölkerung zu unterhalten, such- ten sich die Deutschen teilweise andere Berufe, teilweise wanderten sie weg. Die beiden bedeutendsten Bergorte, Dopschau und Rosenau, hatten sich zu Städten entwickelt. Rosenau wurde erst im 17. Jahrhundert madjarisiert, Dopschau dagegen bewahrte die ursprüngliche Sprache auch noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Unter den Marktflecken des Komitats war Schetting ebenfalls eine deutsche Siedlung. Die Anzahl der vorwiegend oder vollkommen deutschen Siedlungen schätzte Bálint Ila auf zehn bis zwölf. Die zeitgenössischen geogra- phischen Namen des Bergbaugebietes stammen zum größten Teil aus den beiden Hauptorten. Im Jahre 1427 fanden die königlichen Steuereinnehmer im Komitat 4883 Pforten. Die Pfortenzahl der als deutsch anzusehenden Orte betrug 314.
Rosenau fehlt aber auf dieser Liste.
Rosenau war im 16.— 17. Jahrhundert die bedeutendste Siedlung des Komi- tats. Deshalb spiegeln die gezählten 314 Pforten den tatsächlichen Bevölkerungs- anteil der Deutschen nicht richtig wider. Es muß auch berücksichtigt werden, daß die Bergarbeiter nicht zusammengeschrieben wurden, weil sie die Steuer (lucrum camerae) nicht zahlten. Deshalb ist es wahrscheinlich richtig, wenn man den Anteil der Deutschen im Komitat auf mehr als 10970 schätzt. In Gömör bildeten also Ungarn und Slowaken die Mehrheit der Bevölkerung.29
Die Bevölkerung des benachbarten Komitats Abauj scheint (von der königli- chen Freistadt Kaschau abgesehen) einheitlicher zu sein. Die deutsche Bevölke- rung kann bei oberflächlicher Betrachtung als unbedeutende Minderheit angese- hen werden. Die Einheit der einst zehn Dörfer umfassenden Gespanschaft in Viz- soly, die früher im Besitz der Königin war, hörte nach der Belehnung der Siedlun- gen auf. Sie assimilierten sich teilweise in das umgebende Ugarntum. Das
27 B. Varsik (wie A n m . 25) S. 385 ff. — S. T ó t h : S á ro s v á rm e g y e m o n o g r á f i á j a (Die M o n o g r a p h i e des K o m ita ts S áros) Bd. I, B u d a p e st, 1909. S. 102— 103, Dl. 32690.
״ B. Varsik (wie A n m . 25) Dl. 3022. — J a n Benko: O sidlenie s e v e r n é h o S lo v e n s k a (Die Besiedlung d e r N o r d s lo w a k e i) , Bratislava, 1985. S. 220 ff.
2י В. Ha: G ö m ö r megye (D a s K o m ita t G ö m ö r ) Bd. I, B u d a p e s t, 1976. S. 167 ff. — L. T h alló c zy : A k a m a r a h as z n a tö r té n e te (Die G e sch ich te des lu c ru m c a m e r a e ) , B u d a p e s t , 1879. S. 186— 192.
— J. M ik u lik : M a g y a r kisvárosi élet 1526— 1715. (D a s L eb e n in d e n K le in s tä d te n U n g a r n s 1 5 2 6 - 1 7 1 5 ) , R ozsnyó , 1885. S. 22.
Deutschtum erhielt im 13. Jahrhundert einen erneuten Nachschub. So verlor der einst von Ungarn bewohnte Ort Moldau (Szepsi) seine Nationalität. Die Bewoh- ner der vor 1332 entstandenen neuen Siedlung Metzenseif bewahren noch heute ihre ursprüngliche Sprache. Die gesamte Pfortenzahl der als deutsch anzusehen- den zehn bis elf Siedlungen betrug zur Zeit der Steuerliste von 1427 sechshunder- zehn. Sie bildeten mehr als 10% der 5184 registrierten Fronhöfe des Komitats.30 Gönc31, wo allein 101 Höfe registriert wurden, war am dichtesten besiedelt. An zweiter Stelle stand Moldau mit 91 Pforten. In Unter- und Obermetzenseif gab es 86 zu besteuernde Fronhöfe. In Szena gab es 91, in Jászó dagegen 70 Haus- halte.
Wie aufgezeigt, lebten die Deutschen in dicht bevölkerten Ortschaften, bei- nahe ein D rittel lebte in einem O rt. Jede dieser erwähnten Siedlungen war Markt- flecken (oppidum). Ihre Bewohner waren de iure zwar leibeigen, infolge ihrer inneren Autonomie und ihrer Wirtschaftsprivilegien (die grundherrlichen Abga- ben bezahlten sie in einer Summe, sie besaßen Marktrecht usw.) war ihre Situa- tion aber besser als in den einfachen Leibeigenendörfern. In Jászó gab es zu die- ser Zeit auch Eisenerzbergbau.
Ich habe diese drei Komitate relativ ausführlich behandelt. In allen drei Komi- taten waren die Deutschen eine Minderheit. Für das Weiterbestehen ihrer Spra- che und Bräuche war es aber günstig, daß sie in verhältnismäßig dicht bevölker- ten Ortschaften lebten. Die Bevölkerung kleinerer Orte assimilierte sich nämlich leichter in ihre Umgebung. Es kann auch festgestellt werden, daß die Mehrheit der Deutschen (besonders in Abauj) in städtischen Siedlungen lebte, wo die land- wirtschaftliche Tätigkeit durch Handwerk oder lokalen Handel ergänzt wurde.
Bei der Landwirtschaft muß auch der Weinbau erwähnt werden, der in Abauj (so in Gönc) Tradition hatte. Die Forschung bestätigt, daß in den ungarländischen Marktflecken o ft Deutsche lebten. Selbstverständlich kann aber die städtische Entwicklung nicht einer einzelnen Nationalität zugeschrieben werden.32 In der beschriebenen Zeit ist fü r das untersuchte Gebiet die ausschließliche Rolle der Deutschen im Bergbau charakteristisch.
Die Zips kann als traditionell geschlossenes, ethnisch deutsches Gebiet des mit- telalterlichen Ungarn angesehen werden. In dieser Gegend lebten in vierundsech- zig Ortschaften Sachsen. Nicht nur auf privilegiertem Gebiet, auch in den Berg- Städten (Schmölnitz, Gölnitz) und in den Leibeigenendörfern. A u f die K raft die- ser Bevölkerung weist der Umstand hin, daß die im 13. Jahrhundert aus ihrem Kreis stammenden scultes die ersten Bewohner mehrerer Leibeigenendörfer in der Zips und den umliegenden Komitaten waren. Die neue slowakische siediungs- geschichtliche Literatur hat nachgewiesen, daß ein Teil von ihnen alsbald slawi- sehen Charakter annahm.33 Aufgrund unserer gegenwärtigen Kenntnisse wäre es
30 B. Varsik (wie A n m . 25) Bd. II. passim . — G y. G y ö r f f y (wie A n m . 5) S. 44. — L. T h a lló c z y (wie A n m . 29) S. 172— 180.
Jl В. Iványi: G ö n c z s z a b a d a l m a s m e z ő v á ro s t ö r té n e t e (G eschich te der o b e r u n g a r is c h e n S t a d t G ö n c z ) , K a rca g, 1926. S. 3— 4.
״ A . Kubinyi (wie A n m . 9) S. 552.
״ E. Fügedi (wie A n m . 3) S. 502. — A. Fek ete Nagy (wie A n m . 6) S. 340— 343.
leider zu gewagt, ihre Anzahl oder ihren Anteil innerhalb der Bevölkerung des Komitats einzuschätzen. Aus dem Jahre 1432 besitzen wir zwar eine Angabe, nach der die dem Herrscher zustehende Abgabe (lucrum camerae) im Komitat Szepes von 2332 Pforten bezahlt wurde, leider enthält aber die Urkunde keine weiteren Informationen.
Aus der Pfortenzahl wurden gerade die vorwiegend deutschen Siedlungen aus- gelassen, da diese keine Leibeigenendörfer waren und deshalb auf andere Weise besteuert wurden. Bekanntlich verpfändete Sigismund 1412 dreizehn ,,Städte“
an Polen. In der M itte des 16. Jahrhunderts wurden in der unter gutsherrlicher Obrigkeit stehenden Stadt Käsmark 260 Familienoberhäupter mit fast aus- schließlich deutschen Namen registriert.34
Ausführlicher muß das Siebenbürger Deutschtum behandelt werden, denn die im 15. Jahrhundert entstandene Sächsische Nationsuniversität war der bedeu- tendste deutsche Block des mittelalterlichen Königreiches Ungarn. Neben dem Siedlungsgebiet Südsiebenbürgen, Burzenland, der Gegend von Bistritz, Nösner- land und Radna lebten Deutsche auch in anderen Teilen Siebenbürgens, sowohl in Dörfern als auch in Städten. Ab Ende des 14. Jahrhunderts und im 15. Jahr- hundert wurden Siedlungen wie Dés, Szék, Thorenburg, Torda und Großschlat- ten madjarisiert. Diese Welle erreichte aber den einheitlichen sächsischen Block nicht.35
Der Aufschwung und die Stärkung der sächsischen Städte Siebenbürgens wurde durch den Handel mit der Walachei und der Moldau begünstigt.36 Dem Transithandel folgte bald der Aufschwung des Gewerbes. Das Gewerbe verbrei- tete sich im 15. Jahrhundert von den sächsischen Städten auch auf die D örfer.37 In der M itte des 15. Jahrhunderts betrug die Steuer der sächsischen Stühle von Königsboden (sieben Stühle und die zwei Stühle von Mediasch und Schelken)
13.000 Goldgulden. Zur Zeit König Sigismunds betrug die Gesamtsumme der königlichen Einnahmen 243.000 Goldgulden, aber ,,Ladislaus’ (1452— 1458) Gesamteinkommen wird auf 110— 120.000 fl. geschätzt.“ 38
Welchen Anteil hatten die Sachsen an der Bevölkerung Siebenbürgens und Ungarns? Diese Frage kann mit H ilfe der im Archiv von Bistritz bewahrten Konskription vom Ende des 15. oder Anfang des 16. Jahrhunderts beantwortet werden. In dem einmaligen Dokument, das am Ende des 19. Jahrhunderts veröf- fentlicht wurde, werden die zur universitas der Sachsen gehörenden Siedlungen,
34 Dl. 12473. — B. Iványi: K é sm á rk város lakói és a z o k n a k v agyoni viszonyai 1542-ben (Die Bewoh- ner der S ta d t K ä s m a r k u n d ihre V erm ö g e n sv e rh ältn isse im J a h r e 1542). In: K özlem ények Szepes várm egye m ú l t j á b ó l , Jg . 8. 1916. S. 68— 87.
35 Erdély tö rté n e te (G eschich te S ie benbü rge ns) Bd. I, hg. L. M a k k a i , A. M ócsy, B u d a p e s t, 1986.
S. 338.
36 G eschichte d e r D eutschen a u f dem G e b ie te R u m ä n ie n s , hg. C . G ö lln e r, Bd. I, B u k a re s t, 1979.
S. 49, 79 ff.
37 Ibidem , S. 18, 69.
31 J . M . Bak: M o n a r c h i e im W ellental: M aterielle G r u n d l a g e n des u n g a risc h e n K ö n ig tu m s im fünf- zehnten J a h r h u n d e r t . In: D a s sp ä tm ittelalterlich e K ö n i g t u m im e u r o p ä is c h e n Vergleich, hg.
R. Schneider, S ig m arin g en , 1987. S. 357— 358, 382. ( V o r t r ä g e u n d F o rs c h u n g e n . K o n s ta n z e r A rbeitskreis f ü r m ittelalterliche Geschichte. Bd. 32.)
Städte und Dörfer einzeln und die Zahl der Haushaltsoberhäupter durchweg genau angegeben. Es werden folgende gesellschaftliche Gruppen erwähnt: das über Hausbesitz verfügende Familienoberhaupt (hospes), der über keinen selb- ständigen Hausbesitz Verfügende (inquilinus), der Arme und der H irt. Angege- ben wird die Zahl der unbewohnten Höfe und der Mühlen. Das Dokument ent- hält auch Angaben über die scolastici und über die einwandernden Rumänen.
Nach diesen Angaben39 gehörte der größte Teil der Bevölkerung zu den hospes.
Diese Gruppe umfaßte Menschen mit unterschiedlich großem Vermögen. Die Mehrzahl der Armen (sie konnten die Steuer nicht bezahlen) und der inquilini lebten in den Städten (in Kronstadt 160, in Bistritz 138, in Hermannstadt 173).
Indem er die Zahl der registrierten Familienoberhäupter mit fü n f multiplizierte, schätzte Fr. Schuller die Anzahl der Siebenbürger Sachsen auf 70.000.40 Berück- sichtigt man, daß die frühere ungarische Forschung die Zahl der in Siebenbürgen lebenden Rumänen auf 100.000 und die Zahl der Ungarn auf 260.000 schätzte, ergibt sich ein ansehnlicher deutscher Bevölkerungsanteil.41
Die Gesamtbevölkerung des mittelalterlichen Ungarn wird gegen Ende des 15.
Jahrhunderts auf 3,5—4 Millionen geschätzt. Meiner Meinung nach wird diese Schätzung bestätigt werden, wenn weitere Forschungen zur Größe der beiden anderen Nationalitäten genauere Ergebnisse erbringen. Selbstverständlich treffen auch Ergebnisse früherer Forschungen zu, nach denen die Zahl der Haushalte bzw. der Familien auch von den Vermögensverhältnissen abhängig ist. So muß Schullers Wert eventuell vermindert und die Fünf als höchste Multiplikationszahl betrachtet werden. Die Untersuchung der einzelnen Siedlungen wird die Zahl 70.000 sicher präzisieren. György Granasztói schätzte in seiner Untersuchung der Kronstädter Gesellschaft die Bevölkerung dieser Stadt im Jahre 1475 auf 6.000.
Zur Berechnung der als arm anzusehenden Familien (sie zahlten höchstens 38 Denar Steuer) empfahl er aufgrund der Fachliteratur die Multiplikationszahl 2,5;
fü r alle anderen die Multiplikationszahl 5.42 Die Bevölkerungszahl der Sachsen vermindert sich also nicht wesentlich, wenn die Kategorie der Armen und der inquilini zusammengefaßt und die von Granasztói vorgeschlagene M ultiplika- tionszahl angewandt wird. Es ist leicht festzustellen, daß die pauperes und inqui- lini in den Städten und Dörfern gemeinsam kaum mehr als 1.000 Familienober- häupter bildeten. Dies ergibt eine Gesamtzahl von etwa 2.500. Da wir von den in anderen Gegenden Siebenbürgens lebenden Deutschen keine so genauen Anga- ben besitzen, scheint die Zahl 70.000 in etwa akzeptabel zu sein. Allgemein
w A . Berger: V o l k s z ä h l u n g in d en 7 u n d 2 S iü h le n , im Bistritzer u nd K r o n s t ä d t e r Distrikt v o m E n d e des X V . u n d A n f a n g des X V I. J a h r h u n d e r t s . In: K o r r e s p o n d e n z b l a t t des Vereins fü r siebenbürgi- sehe L a n d e s k u n d e . Jg . 17, 1894. N r. 5— 6. — Fr. Schuller: V olksstatistik d e r S ie b e n b ü r g e r Sach- sen, S t u t t g a r t , 1895. ( F o r s c h u n g e n zur d e u ts c h e n L an d e s- u n d V o l k s k u n d e Bd. 9 .1 .) — Z u r F ra ge d e r h o s p e s u n d in q u ilin u s vide. In: G e sc h ic h te d e r D e u tsch e n (wie A n m . 36) S. 52.
40 F. M a k s a y (wie A n m . 5) S. 148. — F r. Schuller (wie A n m . 39) S. 32.
41 F. M a k s a y (wie A n m . 5) S. 148.
42 G y . G r a n a s z t ó i : T á r s a d a l m i t a g o z ó d á s B r a s s ó b a n a X V . század végén (Die gesellschaftliche Glie- d e r u n g in K r o n s t a d t a m E n d e des 15. J a h r h u n d e r t s ) . In: S z á z a d o k , Jg . 106, 1972. S. 397 f. — G e s c h ic h te d e r D e u ts c h e n (wie A n m . 36) S. 54.
bekannt ist auch, daß die inquilini durchaus vermögend sein konnten, besonders wenn sie bedeutende Weingüter besaßen.43
M it H ilfe der Quellen können auch die Tendenzen der M igration beobachtet werden. Aus der Zeit von 1332 bis 1337 sind die ungarischen Abrechnungen der päpstlichen Zehnteinnehmer erhalten geblieben. Sie belegen, welche Summe die Pfarrer der einzelnen Pfarrbesitze in das päpstliche Ä rar einzahlten. Da die Pfar- rer unterschiedliche Geldsorten einzahlten, ist es nicht leicht, diese Angaben umzurechnen. Einer Urkunde aus dem Jahre 1334 ist zu entnehmen, wieviel Herdstellen (hospes und inquilinus) es in den einzelnen Dörfern des Dekanats von Broos gab. Aufgrund der Zehntliste und dieser Urkunde empfahl György G yörffy, in den der Wirtschaftsführung des Brooser Dekanats ähnlichen Gebie- ten auf eine Herdstelle 1,6 Denare Zehnt zu rechnen. Diese Einschränkung ist deshalb nötig, weil der Zehnt nach Getreide, Wein, Schafen und Bienen zu bezahlen war. Wie allgemein bekannt ist, war der Weinanbau ertragreich. Wo es einen intensiven Weinanbau gab, war der Zehnt deshalb höher als in anderen Gebieten. Daraus errechnet sich dann eine größere Zahl von Herdstellen, als es der W irklichkeit entspricht.44 Ernst Wagner schätze die Zahl der Sachsen auf- grund der Zehntliste in der M itte des 14. Jahrhunderts auf 70— 80.000.45
Es lohnt sich, die Untersuchung in einigen Ortschaften fortzusetzen. Dem Sie- benbürger Kapitel zahlten im Jahre 1330 fünfundzwanzig Dörfer des Mühlba- eher Dekanats (nur zw ölf davon lagen auf sächsischem Gebiet, obwohl Deutsche auch in den anderen Gebieten lebten) insgesamt zweiundfünfzig M ark Zensus, und zwar eine Mark je sechzig Hospes- und Inquilinus-Herdstellen. Demzufolge gab es auf dem Gebiet des Dekanats 3120 Herdstellen, also ungefähr 14— 15.000 Personen.46 Den ländlichen Bereich des Mühlbacher Dekanats bildeten im wesentlichen der Mühlbacher und Reussmärkler Stuhl. Die Bevölkerung beider Stühle zusammen betrug am Ende des 15. Jahrhunderts 4079. In Broos wurden 1334 insgesamt 344 Herdstellen (hospes und inquilinus) registriert. Ebenda betrug die Zahl der Haushaltsoberhäupter am Ende des 15. Jahrhunderts 184.
Davon waren 159 Hauswirte und 26 Arme. 1532 wurden ebenda nur 161 Haus- wirte registriert. In der neben Broos liegenden Ortschaft Kastendorf verringerte sich die Zahl der Herdstellen am Ende des 15. Jahrhunderts von 64 auf 54; in Rumes dagegen von 155 auf 87. Bereits 1539 wurden hier nur noch 58 Familien- Oberhäupter gezählt.47
43 Ich d a n k e hier fü r die A n r e g u n g e n , die m eine Kollegin Erzsébet L a d á n y i m i r g eg e b en h a i.
44 U r k u n d e n b u c h zur G e schich te (wie A n m . 7) Bd. II, H e r m a n n s t a d t , 1897. S. 4 64— 465. — Gy.
G y ö r f f y : Z u r F ra ge d e r d e m o g r a p h is c h e n W e r t u n g d e r p äp s tlich e n Z e h n tlis te n . In: É t u d e s H isto ri- q u e s H o n g ro ise s 1980. Bd. I, B u d a p e st, 1980. S. 76, 79.
43 E . W a g n e r : W ü s t u n g e n in d en Sieben S tü h le n als Folge d e r T ü r k e n e i n f ä l l e des 15. J a h r h u n d e r t s . In: F o rs c h u n g e n z u r Volks- u n d L a n d e s k u n d e . Bd. 21, H e r m a n n s t a d t , 1978. S. 4 0 — 48.
46 U r k u n d e n b u c h zur G e sc h ic h te (wie A n m . 44) S. 433— 435.
47 Ibid. S. 464. — Fr. Schuller (wie A n m . 39) S. 31— 32. — A . Berger (wie A n m . 39) N r. 5. S. 51.
— R e c h n u n g e n a u s d e m A rchiv der S ta d t K r o n s ta d t. Bd. 2, K r o n s t a d t , 1889. S. 282. (Q u e lle n zur G e sc h ic h te der S ta d t K r o n s ta d t in S ie b e n b ü rg e n . Bd. 2.) — Fr. S te n n e r: Zwei B eiträge z u r Bevöl- k eru n g sstatistik des 16. J a h r h u n d e r t s . In: K o r r e s p o n d e n z b la tt des Vereins fü r sie b e n b ü r g is c h e L a n d e s k u n d e , Jg. 10. 1887. S. 112.
Diese Zahlen, die einen augenfälligen Verfall anzeigen, bedürfen einer Erklä- rung. Ein Grund dieses Prozesses war die wirtschaftliche Entwicklung einiger Siedlungen seit dem 14. Jahrhundert. Solche Siedlungen waren Hermannstadt und Kronstadt m it jeweils 6.000 Einwohnern. Bistritz zählte 3—4.000 Einwohner.
Die sächsischen Städte und Märkte hatten eine Bevölkerung von 21.080 Seelen.48 Die Bevölkerungszahl anderer, von den frequentierten Handelsstraßen ferner gelegener Orte verringerte sich dementsprechend. Auch in der Konskription ist der Fortgang der städtischen Entwicklung zu beobachten. Im Hermannstädter Stuhl lebten, obwohl es hier auch rumänische Dörfer gab, weniger Bewohner als in der Stadt selbst. Dieselbe Situation finden wir im Mühlbacher Stuhl. In zehn Dörfern von Broos lebten doppelt so viele Bewohner wie in der Stadt selbst. Die achtzehn D örfer von Schässburg erreichten nur 60% der Bevölkerung der Stadt.
Eine andere Ursache für die Verringerung der Bevölkerung sind die in den 20er Jahren des 15. Jahrhunderts einsetzenden türkischen Angriffe. Im Jahre 1420 wurde Broos, im Jahre 1438 Mühlbach vernichtet und Hermannstadt von den Tür- ken belagert. Im Jahre 1431 wurde Sächsisch-Erkes, wo es früher 110 Herdstellen gab, völlig vernichtet. In 33 von den 135 Dörfern der Stühle gab es sicher einen Bevölkerungsaustausch. An die Stelle der Sachsen zogen zum kleineren Teil Ungarn, vorwiegend jedoch Rumänen. So kamen Ungarn zu Beginn des 16. Jahr- hunderts nach Tordesch und Unterbrodsdorf. In den Konskriptionen des 16. Jahr- hunderts (1532 und 1539) gibt es zahlreiche Hinweise auf das Rumänentum.
Die größeren Städte bewahrten anscheinend ihren sächsischen Charakter.
Während Fremde in den Dörfern wegen der Steuerzahlung aufgenommen wur- den, versuchten die Städte, dies zu verhindern. Hermannstadt erlaubte 1474 den Einzug des Dominikanerklosters in die Stadt nur unter der Bedingung, daß die Mönche vorwiegend Deutsche waren. In Schässburg wurde 1517 entschieden, daß in der Unter- und Oberstadt nur Deutsche Häuser kaufen und damit das Bür- gerrecht erwerben können.49
Den immer wieder neuen Verwüstungen, die die Sachsen wegen ihrer Lage eher gefährdeten als andere Gebiete Siebenbürgens, ist es zuzuschreiben, daß am Ende des 16. Jahrhunderts von den beinahe 700.000 Bewohnern des im engeren Sinne verstandenen Siebenbürgen nur 85.000 Sachsen waren (davon lebten 20.000 in den Komitaten)50.
Innerhalb der Sachsen kann von einer bedeutenden Dissimilation nicht gespro- chen werden. Ein Grund dafür ist das relativ einheitliche Siedlungsgebiet. Ein anderer Grund ist, daß die hier lebenden Deutschen an den einheitlichen Privile- gien der sächsischen Gemeinschaft teilhatten. Allein die in den ungarischen Adel
48 F r . S ch ü lle r (wie A n m . 44) S. 31— 32. — Erdély tö rté n e te (wie A n m . 35) S. 337.
49 G e s c h ic h t e d e r S ie b e n b ü rg e r Sachsen f ü r das sächsische V o lk , hg. F. T e u t s c h , Bd. I, H e r m a n n - s t a d t , 1899. S. 120 ff. — E. W a g n e r: W ü s t u n g e n (wie A n m . 45) S. 40— 48. — G . M üller: Die säch- sische N a tio n s u n iv e r s itä t in S ie b e n b ü rg e n . Ih re verfassungs- u n d v erw altu n g srec h tlich e E n tw ic k - lu n g 1224— 1876, H e r m a n n s t a d t , 1928. S. 6 f f ., 139. (Beiträge z u r V e rfassu n g s- u n d V e rw a ltu n g s - g e sch ic h te d e r D e u tsch e n in R u m ä n i e n . 2. H e f t.)
50 E rd é ly t ö r t é n e t e (wie A n m . 35) S. 510.
erhobenen und mit diesem verheirateten Gräven tauschten ihre Nationalität und gaben ihre m it der sächsischen Ständenation verbundenen Rechte a uf.51
Ich habe die Siebenbürger Sachsen ausführlicher behandelt. Das war aufgrund ihrer wirtschaftlichen Bedeutung im Königreich Ungarn notwendig, und weil sie mit ihren 200 Dörfern den größten ethnischen Block des einheimischen Deutsch- tums bildeten. Die ausführliche Erörterung war auch durch die günstige Quellen- läge motiviert.
Die dritte geschlossene deutsche ethnische Gruppe befand sich an der westli- chen Grenze des mittelalterlichen Königreichs Ungarn, im wesentlichen in der Gegend des heutigen Burgenlandes und nördlich von Preßburg.
Während in den bisher behandelten Gebieten eine Abnahme des Deutschtums festgestellt werden mußte, ist hier aufgrund der österreichischen Einwanderung eine kontinuierliche Zunahme der Deutschen zu verzeichnen. Die ständigen Grenzkriege waren für das Bevölkerungswachstum nicht günstig, das Gebiet war deshalb auf die Einwanderer angewiesen. Die Grundherren (sowohl Deutsche als auch Ungarn) trugen zur Ansiedlung bei. Für die Ansiedlung der deutschen Bau- ern und Handwerker war es günstig, daß die Kircheninstitutionen (z.B. die Zisterzienserabtei von Heiligenkreuz) und die Adeligen der benachbarten öster- reichischen Gebiete hier Güter erhielten. Wahrscheinlich warben die neuen Besit- zer die Siedler aus ihrer Heimat an. Ab 1441 kam ein großer Teil von Westungarn in den Besitz der Habsburger, die diese Gebiete (Ödenburg ausgenommen) auch endgültig behielten. Die Habsburger verpfändeten ihre Güter an österreichische Grundherren. In dieser Gegend ist durch Eheschließungen zwischen dem Adel beider Länder sogar eine gewisse Verdeutschung zu beobachten. So wird der Nachfolger eines Landesrichters im 14. Jahrhundert (Paul von Mattersdorf) in einer Quelle als Nikolaus der Deutsche bezeichnet.52 Dem Deutschtum gingen im 15. Jahrhundert aufgrund der Hussiteneinfälle lediglich nördlich von Preßburg einige Gebiete verloren. Erst durch die Türkenkriege wurde das ethnische A n tlitz dieser Gegend zugunsten der Slowaken verändert.53
Ohne die Erwähnung der Einwohner der entwickeltsten Siedlungen, der mit Mauern umgebenen königlichen Städte und Bergstädte, wäre die Darstellung des ungarländischen Deutschtums vor der Katastrophe von Mohács (1526) nicht voll- ständig. Dieser Stadttyp stand an der Spitze der Hierarchie ungarischer Städte.
Mehrere dieser Städte wurden regelmäßig zu den Landtagen eingeladen. Ihre Einwohner wurden, sofern sie die Bürgerrechte besaßen, unabhängig von ihrer
51 G eschichte der D eutschen (wie A n m . 36) S. 55— 56. — E. M á ly u sz (wie A n m . 7) S. 4 0 4 — 409. — E. M ályusz: Le p r o b lè m e d e l ’assim ilation a u m o y e n âge. In: N o uv elle Revue d e H o n g r i e s , J g . 34.
1941. S. 298.
52 E. M o ó r : W e s t u n g a r n im M ittelalter im Spiegel d e r O r t s n a m e n , Szeged, 1936. S. 298 f f ., 398 ff.
— H a n d b u c h d e r H isto risc h e n S tä tte n Ö sterreichs. Bd. I. D o n a u l ä n d e r u n d B u r g e n l a n d , hg.
K. L e c h n er, S t u t t g a r t , 1970. S. 701— 703. — K. M ollay: Z u r C h r o n o l o g i e d e u ts c h e r O r t s n a m e n - typen im m ittelalterlichen U n g a r n . In: A c t a linguistica A c a d . Sc. H u n g . , T . 11. 1961. S. 90.
53 В. V arsik: Z o sidlen ia z á p a d n é h o a s tr e d n é h o S lo ven ska v s tr e d o v e k u (Ü b e r die B esiedlun g d e r West- u n d M ittelslow akei), Bratislava, 1984. S. 133.
Muttersprache der Städteprivilegien teilhaftig.54 Die Bevölkerungszahl dieser Städte wird fü r das Ende des 15. Jahrhunderts von der Forschung auf 70.000 geschätzt. M it Ausnahme des völlig ungarischen Ortes Szeged (mit 7.000 Ein- wohnern) lebten in jeder dieser Städte Deutsche. Sie bildeten meist sogar die nationale Mehrheit55 und müssen deshalb unbedingt erwähnt werden. Zu diesen Städten gehören Gran, Stuhlweißenburg, die Hauptstadt des Landes, Ofen und Pest; in der Nähe der westlichen Grenze Ödenburg, Preßburg und Tymau; im Norden Kaschau, Eperies und Bartenfeld. Zu den Bergstädten gehörten Neusohl, Kremnitz, Schemnitz, Königsberg, Pukantz, D ilin, Libethen, Karpfen. Zu die- sem Stadttyp gehören Neustadt an der Grenze Siebenbürgens und aufgrund des Gesetzesartikels X III/1 5 1 3 A ltofen (Etzilburg), Altsohl, Skalitz, Zeben aus dem Komitat Sáros sowie Leutschau in der Zips. In diesem Zusammenhang ist auch der siebenbürgische Ort Klausenburg zu behandeln.
Die ungarischen Städte waren im Vergleich zu den deutschen klein bis mittel- groß.56 Zum Ende des 15. Jahrhunderts betrug die Einwohnerzahl der größten Stadt, Ofen, 12— 15.000. Pest stand mit 10.000 Einwohnern an zweiter Stelle.
Die Bevölkerungszahl von Sopron schwankte 1379 um 2.000, aufgrund der Steu- erliste von 1424 kann diese Zahl später auf mehr als 4.000 geschätzt werden.
Noch später stagnierte sie jedoch bei etwa 3.000. In Preßburg lebten M itte des 15. Jahrhunderts 4.000, in Kaschau am Ende des Jahrhunderts 5.000 Bewoh- ner.57 Die nächstfolgende Stadt im nordöstlichen Landesteil war Bartenfeld, deren Einwohnerzahl nach den Berechnungen von Gácsova im Jahre 1487 3221 betrug, sich aber bis zur M itte des folgenden Jahrhunderts auf 2708 verringerte.
Diese Entwicklung hing sicher mit dem Aufschwung der Leinenweberindustrie von Bártfa zusammen, deren Produkte im 15. Jahrhundert sowohl in Ungarn als auch in Polen populär waren.58 Die südlicher liegende Stadt Eperies konnte diese Größe nur annähernd erreichen.
Nach dem Fall von Buda wurde das bewegliche Gut der städtischen Einwoh- nerschaft wegen der Türkengefahr 1542 gesondert besteuert. Jede Gesellschafts- Schicht mußte V60 ihres Vermögens einzahlen. Aus diesen Angaben läßt sich ent
54 B. Iványi: A váro si p o l g á r j o g keletkezése és fejlődése figyelemmel B u d a és Pest v á r o s o k r a (D ie E n t s t e h u n g u n d die E n t w i c k l u n g des stä d tisc h en B ü rg erre ch tes mit b e s o n d e r e r R ü c k sich t a u f die S t ä d t e O f e n u n d P e st), B u d a p e s t, 1937. S. 34 ff. (Statisztikai K özlem ények)
55 I. S z a b ó : M a g y a r o r s z á g népessége a z 1330 és a z 1526. évek k ö z ö t t (Die B e v ö lk e ru n g U n g a r n s zwi- sehen d e n J a h r e n 1330 u n d 1526). In: M a g y a r o r s z á g tö rté n e ti d e m o g r á f i á j a ( H is to ris c h e D e m o g r a - p h ie U n g a r n s ) , hg. J . K ovacsics, B u d a p e s t , 1963. S. 95— 97. — Szeged t ö r t é n e t e (G e sc h ic h te v o n Szeged). Bd. I, hg. G y . K r is tó , Szeged, 1983. S. 450.
56 I. S z a b ó (wie A n m . 55) S. 95. — A . K ubinyi: Einige F ra g e n zur E n tw ic k lu n g des S tä d te n e t z e s U n g a r n s im 14.— 15. J a h r h u n d e r t . In: Die m ittelalterliche S tä d te b i ld u n g im sü d ö s tlic h e n E u r o p a , hg. H e in z S t o o b , K ö l n - W i e n , 1977. S. 164— 165. — J. Szücs (wie A n m . 13) S. 44.
57 J . Szücs (wie A n m . 13) S. 40— 42. — F. K ováts: Városi a d ó z á s a k ö z é p k o r b a n (Die B e s te u e ru n g d e r S t ä d t e im M itte la lte r), P o z s o n y , 1900. S. 81. — E . Fügedi: K a s c h a u , eine o s t e u r o p ä i s c h e H a n - d e lsstad t a m E n d e d es 15. J a h r h u n d e r t s . In: S tu d i a Slavica, T . 2. 1956. S. 188.
58 A. G á c s o v á : S p o l o č e n s k a S tr u k tu ra B a r d e j o v a v 15. sto ro či a v prvej p olovici 16. s to ro č ia (D ie gesellschaftliche S t r u k t u r d e r S ta d t B a rtfe ld im 15. u n d in d e r ersten H ä l f t e des 16. J a h r h u n d e r t s ) , B ratislav a , 1972. S. 48. — J . Szücs (wie A n m . 13) S. 220— 243.