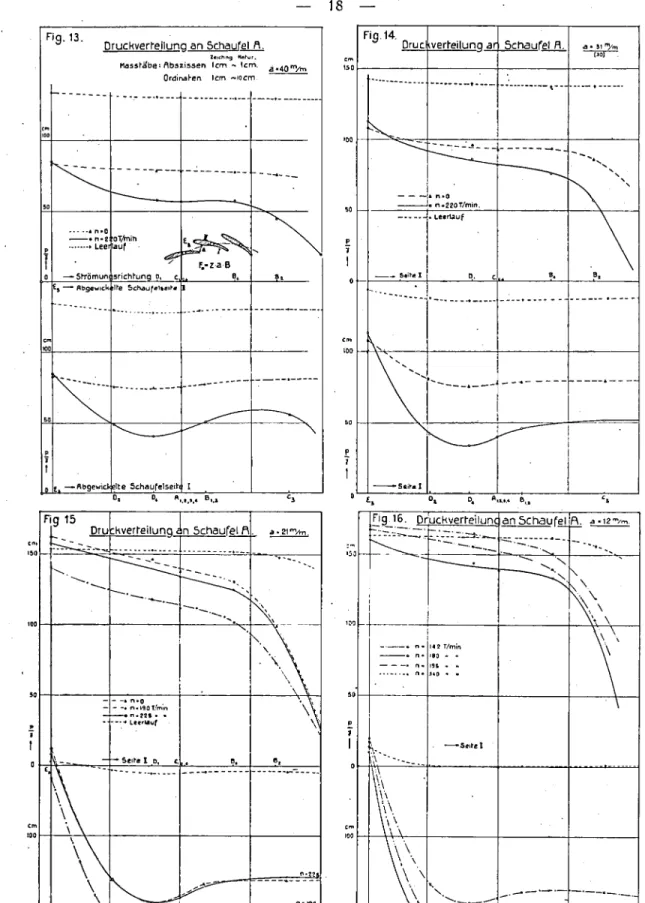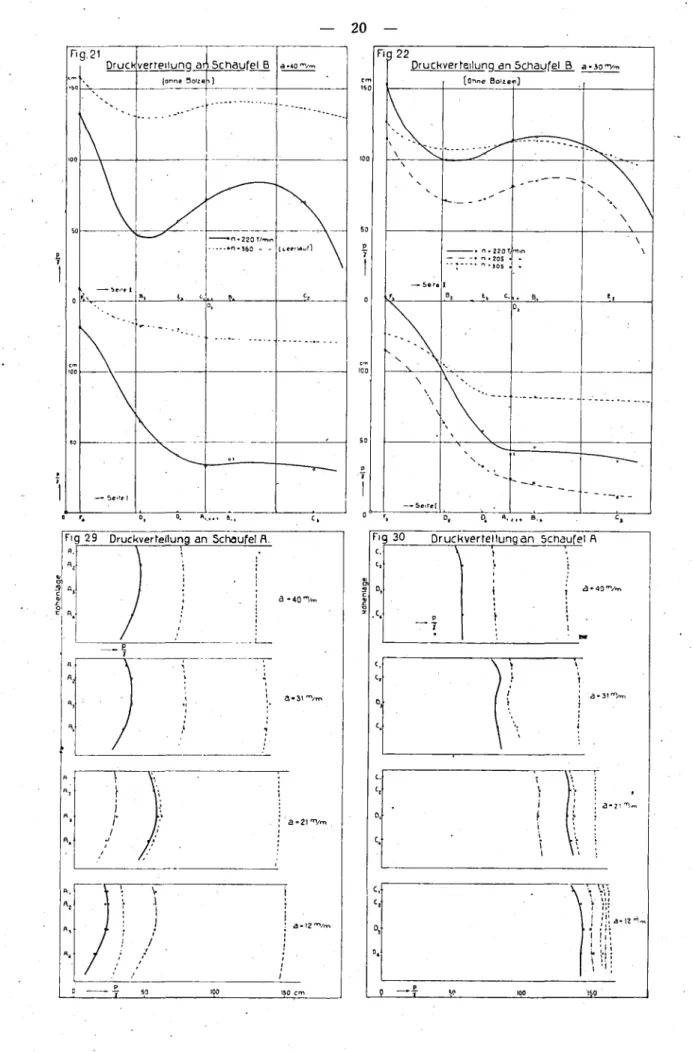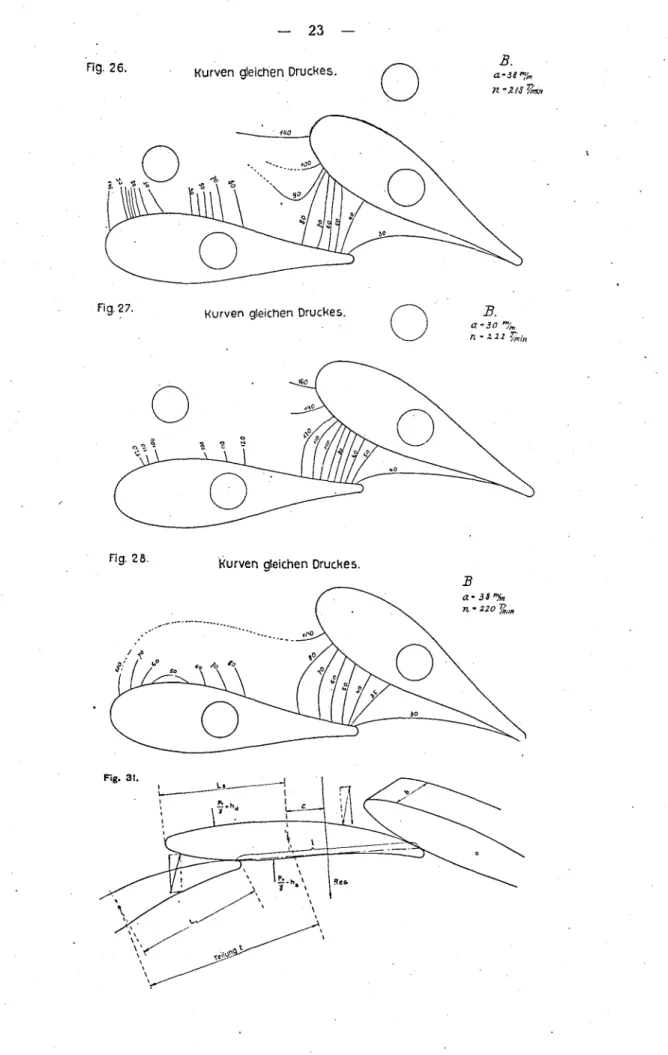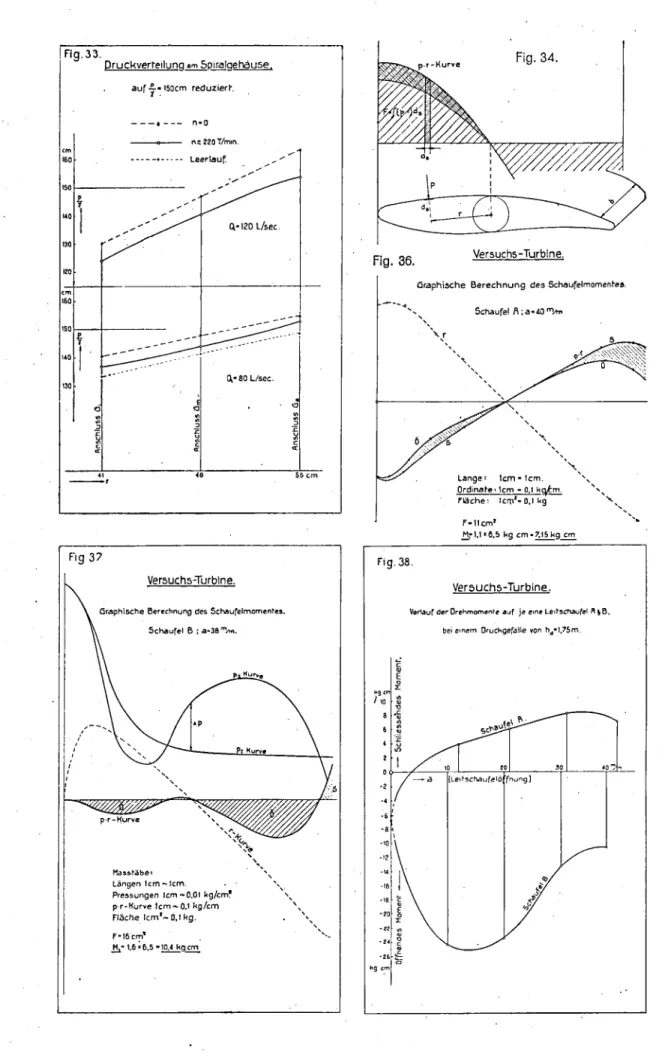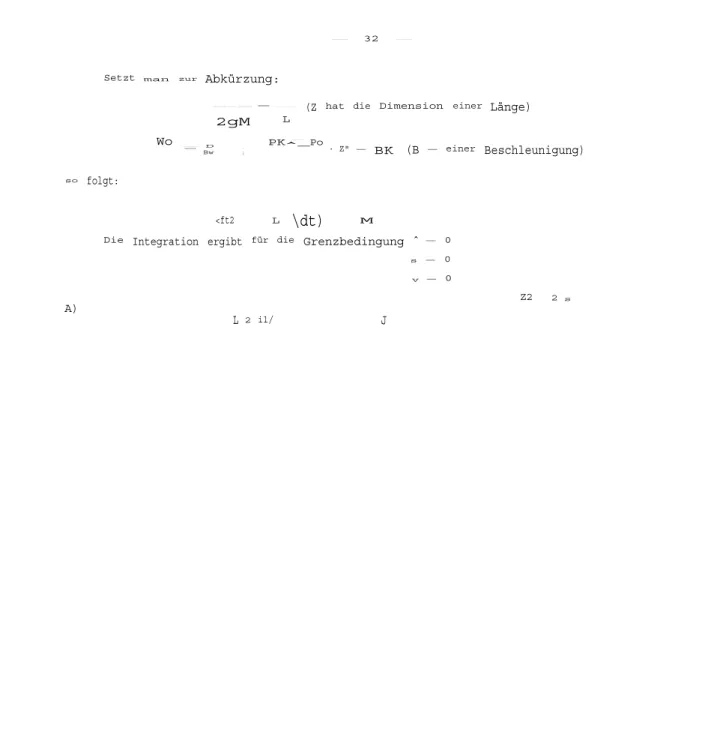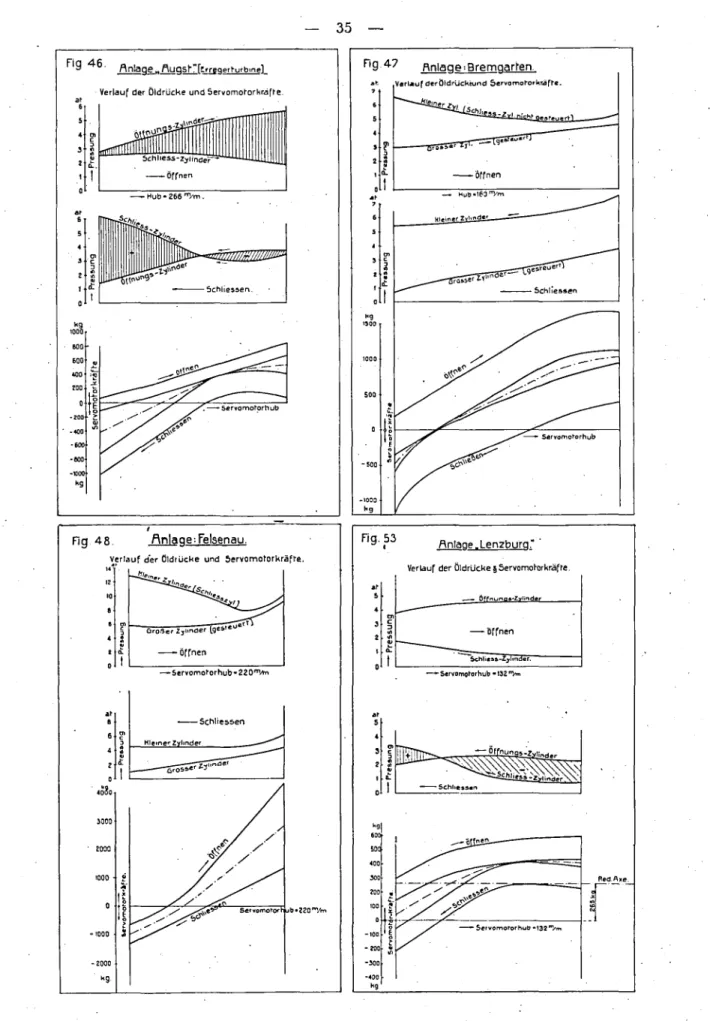Research Collection
Doctoral Thesis
Vergleichende Untersuchungen an Leitapparaten von Francisturbinen
Author(s):
Strickler, Albert Publication Date:
1916
Permanent Link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000097138
Rights / License:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted
This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection. For more information please consult the Terms of use.
ETH Library
Vergleichende Untersuchungen an Leitapparaten von Francisturbinen
Von der
Eidgenössischen Technischen Hochschule
in Zürich
zur
Erlangung
derWürde eines Doktors der technischen Wissenschaften
genehmigte
Promotionsarbeit
vorgelegt
vonA. Strickler, dipl. Masch.-Ingenieur
aus Hirzel (Zürich)
Referent:
Herr Prof. Dr. F.Prâsil
155
Korreferent
: Herr Prof.R.
EscherZURICH 1916
Jean Frey,
Buch- und Kunstdruckerei— II —
Curriculum vitae.
Ich wurde am 25.
Juli
1887 in Wädenswil(Kt. Zürich) geboren
und durchlief die
dortigen
Primär- und Sekundärschulen. NachErlangung
desMaturitätszeugnisses
der zürcherischen Industrie¬schule
bezog
ich im Herbst 1906 dieEidg.
Techn.Hochschule,
an derenAbteilung
fürMaschinen-Ingenieure
ich im Sommer 1911 dasDiplom
erwarb.Die Studienzeit war durch
einjährige praktische Tätigkeit unterbrochen,
die ich in der Tuchfabrik vonPfenninger $
Co. inWädenswil und in den Werkstätten von Gebrüder Sulzer in Winter- thur absolvierte. Nach einer
längern
Studienreise in Deutschland undSkandinavienimSommer 1911 trat ich imAugust
diesesJahres
als
Ingenieur
in die Dienste der Maschinenfabrik von EscherWyss
$
Cie. inZürich,
wo ich bis Sommer 1913 in derenAbteilung
fürWasserturbinen
tätig
war. Seit Oktober 1913 habe ich dieStellung
eines Konstrukteurs und Assistenten für Maschinenbau bei Herrn Prof. Dr. Prâsil an der
Eidg.
Techn. Hochschule inne.(1
Ill
Vorliegende
Arbeit verdankt ihr Entstehen teilweise den Erfah¬rungen während meiner frühern
praktischen Tätigkeit
alsIngenieur
der Maschinenfabrik Escher
Wyss b, Co.,
z. T. auch derAnregung
durch meinen verehrten
Lehrer,
Herrn Prof. Dr. F. Prahl. Ichspreche
ihm und allenandern,
die mich bei derVorbereitung
und Durch¬führung
der Versuche mit Rat und Tat unterstützthaben,
meinentiefgefühlten
Dank aus. Diesergebührt
in erster Linie auch der Firma EscherWyss 8f Co.,
welche die Versuchsturbine dem Maschinen- Laboratorium zum Geschenk machte; sodann verdanke ich dem Wohl¬wollen der Herren Generaldirektor Dr.
Zoelly
und DirektorHuguenin,
sowie der
bereitwilligen
Mithülfe von HerrnOber-Ingenieur Gagg
dasweitere Fortschreiten und die
Beendigung
meiner Arbeit.ZURICH, Juni
1915.A.
STRICKLER, Ing.
— IV -
Inhaltsübersicht.
Seite
Einleitung
1Kapitel
I.Die Versuchsturbine und die
Versuchseinrichtungen
im Maschinen-Laboratorium der
Eidg.
Techn. Hochschule 3Kapitel
II.Die
vergleichenden
Bremsversuche an der Versuchsturbine . . 9Kapitel
HLDie
Druckmessungen
anLeitapparat
und Gehäuse der Versuchs¬turbine 15
a) Durchführung
derVersuche; Fehlerbestimmung
. . 15b) Darstellung
der Resultate 16c) Verwertung
der Resultate 27Kapitel
IV.Versuche über die
Regulierarbeiten
grosser Francisturbinen . . 29a)
VersucheLaufenburg
u. a .... 29b)
Der reine Schaufelwiderstand 36c)
Der Leerwiderstand 40d)
Der zusätzliche Widerstand 45Kapitel
V.Hydrodynamische Untersuchungen
491
Einleitung.
Bei dem
heutigen
scharfenKonkurrenzkampf
im Wasserturbinenbau wird dasAugenmerk
des Konstrukteurs immer mehr auf
möglichst
ökonomischabgepassten
Ausbau der einzelnen Teilegelenkt,
um dieKonstruktion
zu vereinfachen und hiermit dieHerstellungskosten
zuertnässigen.
Hierbei muss natürlich aufmöglichste Erhaltung
der Güte derTurbine,
also ihresWirkungsgrades
und ihrerRegulierfähigkeit geachtet
werden.So ist z. B. die
Konstruktion
desLeitapparates
von Francis-Turbinen einflussnehmend auf dieRegulatorgrösse. Kleinere,
alsobilligere Regulatoren
können dann verwendetwerden,
wenn die
Regulierarbeit
amLeitapparat gering
ist. Dies kann erreicht werden durch Ver¬wendung
einermöglichst geringen
Anzahl von Leitschaufeln inentsprechender Dimensionierung
und
Formgebung.
Dieweitgehende Berücksichtigung
diesesKonstruktionsgrundsatzes
kannaber unter Umständen eine unwirtschaftliche
Verminderung
desWirkungsgrades
zurFolge
haben. Wie fast überall im
Maschinenbau,
muss daher auf einenKompromiss hingearbeitet werden,
der die Güte derWirkungsweise
der ganzen Einheit sichert.Den Einfluss dieses
Prinzipes
und der mit demselbenzusammenhängende Fragen
etwasnäher zu
studieren,
ist der Zweck dervorliegenden Arbeit,
für diefolgendes Programm
als Richtlinie genommen wurde. Es soll untersucht werden :1. Der Einfluss verschiedener Leitrad-Schaufel/or/ne« auf den
Wirkungsgrad
beiSpiral¬
turbinen.
2. Der Einfluss der Leitrad-SchaufelzaA/ resp.
Schaufel/a/^e
auf denselben.3. Die
Strömungsverhältnisse
und namentlich dieDruckverteilung
in denLeitkanälen,
durch welche die Grösse des Drehmomentesbedingt ist,
das vom Wasserdruck auf dieLeit¬
schaufeln
ausgeübt
wird.4. Die Grösse des Arbeitsbedarfes für einen
Reguliergang
an grossen,ausgeführten
Turbinen.5. Der Einfluss verschiedener
Anordnungen
des Antriebes desLeitapparates
auf dieBewegungswiderstände.
Das
Programm
erfordert dieDurchführung folgender
Versuche:1. Bremsversuche an einer im Maschinenlaboratorium der E.T. H zu diesem Zwecke
aufgestellten, vollständig betriebsmässigen Spiralturbine
mit zwei verschiedenen Leitschaufel¬sätzen von
je
12 Schaufeln(in
derFolge
als Versuchsturbinebezeichnet).
2. Bremsversuche mit kleinerer Schaufelzahl
(ein
Teil der Schaufelnherausgenommen).
3.
Druckmessungen
mit Piezometer an verschiedenen Stellen des Leitkanales der Ver¬suchsturbine,
besonders an den Schaufelnselbst,
mitmöglichster Vermeidung
vonStörungen
im Durchfluss des
Wassers,
und unterbetriebsmässigen Bedingungen.
4.
Indizierung
der Druckölservomotoren an den Turbinen derAnlage Laufenburg
am Rhein(vom
Verfasserdurchgeführt),
und ausführlicheBearbeitung
ähnlicher Versuche an den Turbinen derAnlagen Äugst
amRhein, Chippis
an derRhone, Bremgarten, Lenzburg
undFelsenau bei Bern
(von Ober-Ing. Gagg
von EscherWyss durchgeführt).
— 2 —
5. Aufnahme der Widerstandskräfte
längs
desRegulierhubes
mitregistrierendem Dynamo¬
meter,
und zwar für den ganzenLeitapparat
unterWasserdruck,
sowie ohneWasser,
und für einzelne Teile des Antriebes.Es kennzeichnet sich somit diese Arbeit als eine
praktisch-technische.
DerHydro¬
dynamik
als reiner Wissenschaft konnte darinnaturgemäss
nursoweit Raumgewährt werden,
als ihre Theorien zurErläuterung
undqualitativen Verarbeitung
des Versuchsmateriales dienen mussten.(Literaturhinweise
werden anentsprechenden
Stellen in den Texteingefügt.)
KAPITEL I.
Die Versuchsturbine und die Versuchseinrichtungen
im Maschinen-Laboratorium der E. T. H.
Für den Entwurf und die
Ausführung
der Versuchsturbine war für mich in erster Liniewegleitend,
soviel alsmöglich
von bereits vorhandenem Material derhydraulischen Abteilung
des Maschinen-Laboratoriums zu benützen. In den
Figuren 1,
2 und 3 sind diese benutzten Teile ersichtlich:1. die
gesamte Rohrleitung
mitAbsperrschieber
und Anschluss an dieWasserkammer,
2. Laufrad mitWelle,
3. Hals- und
Spurlager,
4.
Gehäusedeckel,
5.
Saugrohr
mitKrümmer,
6. Bremsscheibe mit Zaum.Neuanzufertigen
waren:1. ein
Spiralgehäuse,
2. zwei Sätze
Leitschaufeln,
3. zweiLeitradseitenwände,
4. zwei
Regulierringe
unddazugehörige
Hebel und Lenker'),
5. ein
Anschlusskrümmer,
6.
Einrichtung
zuDruckmessungen.
Alle diese Stücke wurden von der Maschinenfabrik Escher
Wyss 8j
Co. dem Maschinen- Laboratoriumschenkungsweise
als einBeitrag
zurFörderung
technisch-wissenschaftlicherBestrebungen geliefert,
und ichspreche
auch an dieser Stelle derGeschäftsleitung
meinenbesten Dank aus.
Bezüglich
derBerechnung
der neu zu konstruierenden Teile ist zu bemerken:1. das vorhandene Laufrad entstammt der
Versuchseinrichtung
von Dr. Dübi. Es wurdedamals konstruiert für
C =-
Y2 JH
=6,27 m/sec
Nc =2,5
PSff=--
2,0
m<?
=--128,5 I/sec
n == 200
jm
inund hat die Dimensionen:
Affl
=0,40
mA
=0,066
mAm
=0,24
mDs
=0,325
mrmi 0,083
m"F*
=0,048 m2.
'nii =
0,085
nfA
=73°
h
==34°
*) Zum Antrieb der Leitschaufeln ist je nur 1
Ring notwendig;
die beiden wurden alternativ eingebaut._ 4 —
2. Der dazu
gehörige Leitapparat
besass einen lichtenAustrittsquerschnitt
vonF9
=0,036
mz.Aus diesen
Konstruktions-
undAusführungsdaten ergeben
sich diespezifischen Geschwindig¬
keiten.
ux =
0,67
Cvlm
=0,246
C\
vx =0,57
Cw2 =
0,40
C|
v-im = 0,240 C(
w, =0,425
C VUm diese Grössen auf ihre
hydraulische Uebereinstimtnung
zukontrollieren,
wurdeversucht,
sie nach demDiagramm
von Camerer(graph. Darstellung
desTurbinenhauptsatzes) zusammenzutragen.
Will man dasgegebene
Laufradbeibehalten,
soergibt
sichjedoch
eingrösserer
Wert von vlt nämlich0,645
C.(Fig. 4.)
Für die Neukonstruktion der zwei
Leitapparate
wurde daher dieser Wert zu Grundegelegt,
aus dem einQuerschnitt F0
=0,032 m2 folgt,
sowie ein Winkel a = 23°.Dieser Winkel wurde über die ganze Höhe konstant angenommen. Die beiden Versuchs¬
leitapparate,
deren Schaufelformen ausFig.
1 ersichtlichsind,
wurden immerhin für eineUeberöffnung
bis aufF0
=0,040
m2eingerichtet.
Die eine Schaufelform(A)
ist mit ge¬krümmter Mittellinie
ausgebildet,
wie sie fürSpiralturbinen
heute vielfachangewendet
wird(in
derFolge
als„spiralförmige
Schaufel"bezeichnet);
Schaufel B hatgerade
Mittellinie alsSymmetrieaxe
für dasProfil,
undentspricht
der für offene Turbinengebräuchlichen
Form.3. Das neue
gusseiserne Spiralgehäuse
ist inFig.
2dargestellt.
Es hat einen recht¬eckigen Eintrittsquerschnitt
von0,050 m2
und ist somit für die relativ sehr hohe Wasser-20,5
Cgeschwindigkeit
von vc = —^r— =0,41
Cgebaut.
Diese abnormeGeschwindigkeit
wurdezu Grunde
gelegt,
um die vorhandeneRohrleitung
benutzen zu können. Die zwei Seiten¬wände des
Leitapparates
sind durch Bolzengegeneinander
fixiert.4. Der Antrieb der Leitschaufeln
geschieht
durchaussenliegende
Hebel(Fig.
1 u.2),
die auf den Schaufelbolzen mit
Klemmschrauben befestigt
sind.Des
geringen
Wasserdrucks wegen sind die Schaufelbolzen in den Büchsen weiter nichtabgedichtet.
Der eine der beidenRegulierringe (K) ist,
wie 2umeistgebräuchlich,
konzentrischzu Welle und Laufrad
(Fig. 5),
dieVerbindung
mit den Hebelngeschieht
durch Lenker. Die Dimensionen sind sogehalten,
dass die Hebel sowohl radial wie auch als Kniehebel auf¬montiert werden können. Der andere
Regulierring (E)
ist exzentrisch zurTurbinenaxe;
die Hebel werden in diesem Falle sämtlichparallel
zu einander(Fig. 6),
und es sind keine Lenkernotwendig. (Diese Anordnung
wird von Th. Bell8)
Co.verwendet.)
Beim Antrieb desRinges
K(laut Fig. 5)
kann dieHebellänge
/ verändert werden.5. Die
Einrichtung
zurDruckmessung
besteht in einem Sammelrohr mitaufgesetztem
Piezometer I(Fig.
3c)
; die einzelnen Rohre sind an verschiedenen Stellen der obern Leitrad¬wand,
sowie amSpiralgehäuse angeschlossen (s. Fig.
1 ; die Anschlüsse der Leitradwand sindvon 1 bis 7
numeriert)
; ein weiteres Rohr kommt von einer besondernSchaufel,
derenZapfen
hohl ist. In diese zentraleBohrung
münden 21Kanäle
von 3 mmDurchmesser,
dievon verschiedenen Stellen der Schaufeloberfläche herführen und von denselbenimmer normal
abzweigen.
DieseAnordnung
sichert dieAngabe
reinerPressungswerte
In die zentraleSchaufel-Zapfenbohrung
kann von aussen ein satteingeschliffenes Messingrohr
mit verlötetemBoden und einer seitlichen
Oeffnung eingeführt
werden(Fig. 12).
DasMessingrohr
wird sotief
gesenkt
und so weitgedreht,
bis seineSeitenöffnung
mit derMündung
der zu unter¬suchenden
Schaufelbohrung
übereinstimmt. Aussen am Rohr befindet sich eine Skala mitMarken,
damitjederzeit
dieLage
derangeschlossenen Bohrung
erkannt werden kann. Piezo¬meter II ist
unabhängig
von allen andernAnschlusspunkten
direkt amSpiralgehäuse
ange-Grundriss
— 6 —
schlössen,
und zwar andemjenigen Teil,
wo einegeradlinige Strömung
vorhanden ist. Ausser¬dem sind an Piezometer I drei Punkte des
Spiralgehäuses angeschlossen.
DerNullpunkt
derPiezometer ist auf Mitte
Leitapparat eingestellt.
6. Zur
Wassermessung
diente der Ueberfall im Ablaufkanal; es wurde dazu die Eich¬kurve
benützt,
die bei frühererGelegenheit gefunden
wurde.*)7. Das Turbinen-Drehmoment wurde mit einem Bremszaum gemessen, der dem Inventar der
hydraulischen Abteilung
des Maschinen-Laboratoriumsangehört.
Das verwendete Feder¬dynamometer
wurde am 30. Oktober 1914 und 20. März 1915geeicht
und beidemal alsrichtig
befunden. DieMessung
der Umlaufzahlgeschah
mit einemHandtachometer,
d.is mit einem Zähler vorher kontrolliert worden war.8. Die
Einrichtung
zurMessung
desRegulierwiderstandes
ist ausFig.
5 ersichtlich.Die schliessende
Bewegung
desLeitapparates
wurde durch eine kleine Handwinde bewerk-Fig. 3
stelligt;
letztere war inVerbindung~mit"einem Gegengewicht,
welches so grossgewählt
wurde, dass es dengeschlossenen Leitapparat
mit Sicherheit öffnete. In denZugdraht
war einFederdynamometer
mitIndiziervorrichtung,
bestehend aus Trommel und Schreibstifteinge¬
schaltet, und ausserdem noch eine zweite,
gewöhnliche Federwaage angebracht
zur Vornahmevon
Kontrollablesungen.
Dasregistrierende Dynamometer
entstammt dem Inventar derhydrau¬
lischen
Abteilung
; seineEinrichtung
ist aus der schematischenFigur
5 ersichtlich : die Trommel ist auf der einen, der Schreibstift auf der andern Hälfte montiert; die Schnur zumAntrieb der Trommel ist an einem
passend gewählten Fixpunkt befestigt.
Der Stift schreibt während des ganzen Hubes die im Draht herrschendeZugkraft
auf.9. Die
Aufstellung
der Versuchsturbine wurde über dem grossen Messkanal des Maschinen-Laboratoriums vorgenommen. Um bei derbegrenzten
Wassertiefe im Kanalgünstige
Abflussverhältnisse zu erzielen, wurde amSaugrohrende
noch ein Krümmer in der Abfluss-Prof.Dr. 1".PräMI, Vergleichende Untersuchungen an Reaktions-Niederdruckturbinen. Schweiz.
Bauzeitung 1905.
7
Geschwindigke^sdiagramme
Fig.5
Schemades Leirapnarar-Antriebes
mil'konzentrischem Requlierring schemaderjntjiziervornchtung
Rad alhebel
Fig 6
Schema desLeirapparar-flnrriebes mirexzentrischemRequlierring
RegsrrFederwage
Fig 12.
f ill Hi
-£5i
J
j
h^^WKKK^KW»^^^.vmma^
.w,v,TOwmw^w^
Y
. x_
--ÔÎ-
4
— 8 —
richtung angebracht.
DasSaugrohr
hat konstantenQuerschnitt.
DieZuleitung
des Betriebs¬wassers
erfolgte
durch eine 250 mm weitegusseiserne Rohrleitung,
die an denKessel
der Niederdruckturbineangeschlossen
war. Dem Behälter wurde das Betriebswasser durch dieNiederdruck-Zentrifugalpumpe zugeführt.
Das
Druckgefälle
derSpiralturbine
konnte durch Höher' oder Tieferstellen der Ueberfall- kante imNiederdruck-Reservoir,
sowie durch denAbsperrschieber reguliert
werden. DieVersuche wurden in der
Folge
mitTotalgefällen
zwischen den Grenzen2,6
und3,2
mdurchgeführt.
In diesem Intervall dürfte diegebräuchliche
Methode derUmrechnung
auf kon¬stantes Gefälle ohne wesentlichen Fehler anwendbar sein.
KAPITEL II.
Die vergleichenden Bremsversuche an der Versuchsturbine.
1.
Durchführung
derVersuche.
Die Methode der
Bremsung
selbst bietet kein weiteresInteresse,
da dieallgemein gebräuchliche
Art benützt wurde. Die ziemlichstark,
aber ganzunregelmässig pulsierende
Wassersäule im Piezometer erforderte eine äusserst
zeitraubende, lange Beobachtung
fürjede Ablesung,
deren Mittelwert nacheiniger Uebung
ziemlich genau durchSchätzung gefunden
werden konnte.
2.
Die Resultate der Bremsung
mit den
Leitapparaten
A und B sind inFig.
7 bis 9zusammengestellt.
Da das Gefällewährend der Versuche nur mit grossem Zeitaufwand hätte konstant
gehalten
werdenkönnen,
wurden nur die Resultate auf ein konstantes Gefälle
umgerechnet,
und zwar nach denbekannten
Beziehungen
_3_
-Ç-
-A IJL
•IL
-\ IJL
•Jh-
-t.LX\
2Q'
-
V
H' ' n ~V
ff ' ffc~
W!
(Tabelle
1 enthältbeispielsweise
eine Versuchsseriezahlenmässig dargestellt.)
Eine solcheUmrechnung
war unerlässlich zurFührung richtiger Vergleiche
zwischen den beiden Leit¬apparaten.
AlsH'
wurden3,00
m angenommen.Legt
man dasGeschwindigkeitsdiagramm
in
Fig.
4 zuGrunde,
soergibt
sich für dieses Gefälle eine Umlaufzahlri
=245/mfn.
Bei
Leitapparat
Azeigt
sich der besteWirkungsgrad
fürdenQuerschnitt F0
=0,032 m2 (a
= 40mm)
bei ca. 240Touren/W/7,
der Wasserkonsum ist 153I/sec;
die Ueberein-stimmung
mit derRechnung (158 J/sec)
ist somit einebefriedigende,
wenn man in Betrachtzieht,
dass nurmit einem mittlerenAustrittsdiagramm gerechnet
wurde. DasLeistungsmaximum
tritt
dagegen
für a = 40 mm bei ca. 225Touren/m/o
auf. BeiLeitapparat
B sind die Maxima bei einer umje
ca.20 Touren tiefergelegenen Umlaufzahl,
d. h. bei220,
resp. bei 205. Ausserdem scheint der Wasserkonsum für dieselbeOeffnung
bei B wesentlichgeringer
zu sein als bei A. Im
übrigen zeigen
die£?-r\urven
ähnlichen Charakter fürbeideLeitapparate.
Von
praktischem
Interesse ist natürlich einVergleich
der beiden Schaufelformen über ihren ganzenRegulierbereich
für eine konstante Umlaufzahl. Als solche wurde statt dergegebenen (245)
die dem Maximum desWirkungsgrades
amLeitapparat
Bentsprechende,
d. i. 220
gewählt.
Um diese Resultate noch etwas sichererzugestalten,
wurden nochje
eineSerie
beikonstanter
Umlaufzahl220/m/n
undmöglichst
konstantem Gefälle3,00
m auf¬genommen.
— 10 —
*ü |c
CT'tcMt»ot^in,'*ovo•>— vQ o CM vo •*» 00 O er" *" *" *"*"* •*" -*f ri o_^i
o- u u
*>•
"1 "1
cT"*mmmmwiow"'* 5
e c
S
o w o.
SSSONWO- OO
or^incTCMoo>i^o
CTCMCMCMCMCM — — —
o t^
CT
£
s OOOOOOOQOOo_o_o_oooo_oooCT"cT"eT"cTCT"cT"cT"(T'cT"eT'
O O
s- o
o
in_ in in_ in_ in in_
N T-" *" iO « ri o * u o
£ £
CMOOinCM00-*OCMint^vt^vq^o,^-^^©.
*o o \d" o vu" uf ic io in"
s« Ï
ooo — ooovooooovoOOOOvOvOCMOnCTOv
^f * +" m" •* •*" ri n cm" o o
0.
£
O0qCMCMO_in_O_CM.CT_io ov" n io io" io \d in" in" w
— T-CMCMCMCMCMCMCMCT
o
u o
•5.
in^invonwijiinncoo
^j,miominm'^,^i''^*^t'
CM a*
e U
1 V
z 5. sD vO vO vo v© vD vo vo vo vO vO t- I'¬
Qtotal
CM — CMCTO00>OCMOint^— CMCMCMCM — — — — •>— vo CMCMCMCMCMCMCMCMCMCM
ve -vi¬
vo t--
•Ü S
m
no--"o>sonNinn
CMCMCMCMCMCMCMCMCMCM —
CT CT CM —
O.W.
ISOOOOOOOOOOO 0000000000000000000000
do'öddödoodd
vo vu vo vO vO vO vo vO vO vO vu
^f ^T ^* *^ "^* ^* ^" ^* ^" ^* ^"
CM m—
CM CM O o"
vO vO
//total
s t^t-oomt~.o-*cTinnNMNCCOIOvOvDOv
ririririCM"cvfCNfCM"CMCM"
vo o
«
lb*
|cm
ser o o o oo t- m'cr cm in J-
•*minm-<*-*-*-*-*-* J>
o" o" o" o" o" o" o" o" o* o" w
— u
o «
o
£
su
— O O O O O © — — O to
CMCMCMCMCMCMCMCMCMCM O
- - - - „" _" _" _~ CM" -" *»
u
CM <U
—" M
u m
£
6J3
crt~-oor~owooo.Si
i^-inmincMCM — ooctj:
X)
vo te
^ Ü
V)
ç c
§
o b- o.
mom — ooctoqo
CTCMCMCMCMCM — — —
m t- CT
« 6 CMCMCMCMCMCMCMCMCMCMO CM O
11
"
Versuchsturbine
Bremsungmifl_eihapparar.fl"(12Schaufeln]
Charaktenshkenbeikonstantem GaMIle. H.r300m a-47
Fig 9
Verjuchsrurbine.
Bremsungmirnormalem
Lelrapparar.ft"
mit6Schaufeln undohne Schaufeln Charakrenshk bei konstantem Gefalle.H*3.00m
L/sec
sa W»»»«fhan»u"t
J'S.ScnauftlS'
Fi9-8- Versuchsrurbine
Bremsung mirLeirapparar.B".(t2
Schaufeln)
Charakrtnshkenb«. koniranrtm Garalla.U.^ißflfll»
L/wc 150
a a-»,
"""*
1 1
100 \
ft a.20 \
50
<X a-io
\.
VN- n
^=*^_^
4-?«-- "a-'sa"""'—-n^^ s-
y-''~
———"" ' _a-«o
^a-io
2-
1-
^
—n '00 2t o 3ia 40
54
70 a>38
-6a
..-eä^
^a-W^"^^
•«o"l 1
-301 ,'
Î0 ,-'
10/
»' n
\
s \
U
100 200 3 00 400
Flg 11
Energieverlusre der Leitepparafe
flundB
n»konstant.JZOTAnin
ubrigan
150l/mc
— 12 —
An Hand der
Fig.
10 lässt sich einVergleich
ohne weiteres ziehen. DerLeitapparat
Azeigt
in derHauptsache
eine merklicheUeberlegenheit gegenüber
B; bei *denspiralförmig gekrümmten
Leitschaufeln ist der maximaleWirkungsgrad 76%.
bei densymmetrischen
nur
66%.
i
Ein Unterschied war
ja
natürlich von vornherein zuerwarten,
aber durchaus kein so grosser. Bei kleinernBelastungen
scheint B etwas besser zu sein; die^-Kurven
kreuzen sich bei ca. 501/sec.
Um einen genauem Einblick in die
Energieverlüste
desLeitapparates
und deren Ver¬hältnis im
Vergleich
zu denübrigen
Verlusten zubekommen,
wurdefolgendes
Verfahreneingeschlagen:
aus denspäter
zu beschreibendenDruckmessungen
wurden hiervorgängig
die mittlem Drücke am Ende der Leitschaufeln
benützt,
die in diesenQuerschnitten
auf¬tretenden
Geschwindigkeitshöhen
aus derKontinuitätsgleichung
berechnet und die SummeP V2
___i —
verglichen
mit denentsprechenden
Grössen amAnfang
des Gehäuses(Piezo-
Y
2g
meter
II)
; die Differenzergibt
denEnergieverlust
prokg
durchfliessenden Wassers, und dieentsprechende Total-Leistung
wurde als„Gehäuse-
undLeitapparatverlust"
bezeichnet(Fig. 11).
Die Gesamtverluste
ergeben
sich ausFig.
10 als Differenz zwischenNa
und/ye
; sub¬trahiert man davon die
obigen
Gehäuse- undLeitapparatverluste,
soergeben
sich in beidenFällen nahezu dieselben Summen aller
übrigen
Verluste; daja
nurderLeitapparat ausgetauscht wurde,
sollen dieübrigen
Verluste auch von vorneherein dieselben sein. Die sich durch dieMessung ergebende Abweichung beträgt
im benützten Intervall vonQ
= 911/sec
bis 150Ijsec
im Mittel
5,5 °/0
der Totalverluste.Fig.
11zeigt
diese Verluste. Um sie auch mit denübrigen
Einzelverlustenvergleichen
zukönnen,
wurden letztere soweit alsmöglich
nochgetrennt.
Der mechanische Verlust wurde der Promotionsarbeit von E. Dübi entnommen; letzterer hatte dasselbe Rad und dasgleiche
Hals- undSpurlager benützt;
es wurde nurentsprechend
demgrössern
Gewicht derjetzigen
Bremsscheibe und der stärkernSpurbelastung
das Widerstandsdrehmoment im Verhältnis 45 : 35 erhöht.
Der Verlust beim Austritt aus dem Laufrad wurde aus den Austrittsdreiecken
(Fig. 4)
entnommen. Der Rest der Verluste entfällt
hauptsächlich
auf das Laufrad{Stoss
amEintritt, Reibung
undKrümmung),
sowie auf denSpalt.
Vorgängig
der genauemUntersuchung
derStrömungsverhältnisse
in den Leitkanälen soll hier nur kurz die Ursache derUeberlegenheit
von Aangegeben
werden. Sieliegt darin,
dass bei B eine dreifache
Energieumsetzung längs
der Strombahnen eintritt, d. h. zuerst Abnahme des Druckes und Zunahme derGeschwindigkeit,
sodann wieder Zunahme des Druckes und zuletzt nochmals Druckabnahme. EineUmsetzung
vonGeschwindigkeits-
inDruckenergie
ist aber für denselbenKanal
immer verlustreicher als dieumgekehrte.")
Nachden Resultaten der
Druckmessungen (Kap. III)
verläuft imLeitapparat
A die Druckabnahmelängs
der Strombahnenstetig;
daher sind hier die Verluste kleiner.DieSchaufelform A hat auch den
Vorteil,
dass siegrössere Geschwindigkeit
im Gehäusegestattet;
letzteres kann daher leichter undbilliger gehalten
werden als beiVerwendung symmetrischer
Schaufeln. Dieser Umstand dürfteweniger Bedeutung
haben fürgrössere Gefälle,
wo dieGeschwindigkeit
im Gehäuse an und für sich schon gross ist;dagegen
dürftefür die sog. halboffene
Anordnung
mit vertikalen Achsen inBetonspiralen (bei
Niederdruck-t anlagen)
dieErhöhung
derEintrittsgeschwindigkeiten
unter Umständen bedeutendeErsparnisse
*) Darüber
gibt spezielle
Auskunft die Arbeit:Andres,
Versuche über dieUmsetzung
vonWassergeschwindigkeit
in Druck.in den Baukosten
bedingen (näheres
über dieGeschwindigkeitsverteilung
im Gehäuse imKapitel V).
In ähnlicher Weise wie die ersten Versuchsserien wurden noch zwei weitere
durchgeführt,
einmal mit nur 6 Schaufeln
A,
das andere Malüberhaupt
ohne Schaufeln. Die Resultate sind inFig.
9 und 10dargestellt.
Daraus Iässt sicherkennen,
dass der Verlauf derWirkungsgrad-
Kurven fürA6
sich mitderjenigen
vonA12
fast deckt biszu einerWassermenge
von 130I/sec,
von da an fällt sie ab. Ohne Leitschaufeln erhält man für ff=
3,0
m und n = 220T/min
in diesem
Diagramm
natürlich nur einen Punkt; derWirkungsgrad
ist hiebei immer noch soF'9 1" Bremsungder Versuchsfurbine
Leistungs-^VIrkungsgradkun/enbei konstantem Gfllalle H«300m, undkonsl-anterUmlaufzahl n-220T/min
i I 1
hoch wie bei 12 und 6 Schaufeln bei der
gleichen Tourenzahl; merkwürdigerweise
ist derWasserkonsum nur so gross wie für a = 30 mm bei 12
Leitschaufeln,
aber auch imn-Q
und im n-i]
Diagramm
stimmen, dieQ-
und^-Linien
nahezu mit denentsprechenden
füra = 30mm überein. Dieser Wert von
Q
ist imübrigen
so gross wiederjenige,
bei welchem diej^-Kurve
fürA0
sich vonderjenigen
vonA12
merklich zu entfernenbeginnt,
und auchabsolut
anfängt
zu sinken.Aus diesen
Versuchen
lassen sich alsBeantwortung
derProgrammpunkte
1 und 2(s.
Seite1)
dieSchlussfolgerungen
ziehen:2
- u —
/. Die
Schaufelform
hat beiSpiralturbinen
einen grossen Einfluss aufdie Verluste imLeitapparat,
und somit auf denGesamtwirkungsgrad.
Eseignen
sich am bestenspiralförmige
Schaufeln. Schlechte Schaufelnbedingen grössere
Verluste als gar keine Schaufeln.2. Bei
einigermassen
korrekterAusführung
desSpiralgehäusos spielt
die Schaufel¬zahl resp. die
Schaufellänge
fast gar keineRolle
inBezug
auf denWirkungsgrad,
wenndie Schaufelform der
Strömung angepasst
ist.15
KAPITEL HI.
Die Druckmessungen an Leitapparat und Gehäuse
der Versuchsturbine.
a) Durchführung
derVersuche.
Die
Druckmessungen verfolgen
denZweck,
über dieVerteilung
des Druckes in denLeitkanälen und im Gehäuse Aufschluss zu
geben;
sie sollen einen Schluss ziehen lassenüber die Art und
Verteilung
derEnergieverluste
imLeitapparat. Geechwindigkeitsmessungen
wurden keine vorgenommen, da die
Einführung
eines Pitot'schen Rohres nicht ohneStörung erfolgen könnte,
sodass die Resultate doch mehr oderweniger getrübt
erschienen. Da essich im
übrigen
in erster Linie um einetechnische,
und nicht einephysikalische Untersuchung handelt,
so wurdestreng
daraufgeachtet, möglichst betriebsmässige
Zustände zu untersuchen unddarzustellen,
und es wurde daraufverzichtet,
dieMessungen
sovollständig
und so feindurchzuführen,
wie dies für eine reinwissenschaftliche, hydrodynamische
Arbeit erforderlich und auchmöglich
wäre.Die
Durchführung
derDruqkmessungen geschah
mit den besonderenEinrichtungen,
die imKapitel
I beschrieben sind. DieMessungen
wurdenbegonnen
mit demLeitapparat
A; für die vier verschiedenenOeffnungen
a =40, 30, 20,
10 mm wurden die Drücke an den Leitschaufeln gemessen bei festgebremstem Laufrad,
bei normaler Umlaufzahl und im Leerlauf.Es wurden der Reihe nach die Anschlüsse 1 bis
7, Au B1
. . .Di
an das Piezometer Ihergestellt
und der Mittelwert desWasserspiegels
während einerBeobachtungsdauer
von ca.1 Minute
schätzungsweise abgelesen.
Diese Methode erwies sich vielzweckmässiger
undgenauer als öfteres
Ablesen,
z. B. alle 10 Sekunden undBildung
des arithmetischen Mittel¬wertes. Um über die Art der Pulsationen ein Bild zu
erhalten,
wurden die Piezometer-schwankungen
für eineProbemessung graphisch aufgezeichnet:
der Maschinist zog einenPapierstreifen
mitmöglichst
konstanterGeschwindigkeit
unter dem Piezometerrohr horizontalfort,
während der Beobachter mit dem Bleistiftmöglichst gleichzeitig
demWasserspiegel folgte.
DiesesDiagramm
Hess eineperiodische Bewegung
durchaus nicht erkennen; imübrigen gingen
auch die Pulsationen in Piezometer I nichtsynchron
mitdenjenigen
in Piezometer II.Eine
planimetrische Mittelwertbestimmung ergab
fast genau dasselbe Resultat wie die Beob¬achtung
vonAuge
während einer Minute.Nach einer
Ablesungsserie
wurde inumgekehrter Reihenfolge
wiederabgelesen,
alsonach einander die Anschlüsse
Dit C4
. . .Av
7 bis1,
G. Dadurchergab
sich eineKontrolle,
ob die Kanäle luftfrei waren. Bei der erstenausgeführten Messung ergaben
nämlich dieerste und die zweite Serie ganz verschiedene
Werte,
während erst die dritte mit der zweiten übereinstimmte. Um Zeit zu sparen, wurdenspäter
in der ersten Serie nurjeweilen
dieAnschlüsse
hergestellt
zurEntlüftung, dagegen
noch keineAblesungen gemacht.
— 16 —
Mit dem
Leitapparat
B wurden ausser den normalenMessungen
noch solcheausgeführt,
bei denen der vor der Messchâufel stehende Gehäusebolzen entfernt war.Bei allen
Messungen
war eine Reihe vonUngenauigkeiten
unvermeidlich. Die Fehler¬quellen liegen
in erster Linie in derMessung
der Austrittsweite a der Leitschaufeln. Diesekonnte,
wie schonerwähnt,
an einem mit demRegulierring /(
inVerbindung
stehendenIndikator
abgelesen
werden; dieGenauigkeit
in derAngabe
des Wertes a kann'daher keine grosse sein. Hur füreinige wenige Messungen
wurde am Ende der Versuche derLeitapparat
so
demontiert,
dass die Schaufelweite direkt mit dem Tastzirkel gemessen werden konnte.Für die
übrigen
Versuche sind die Werte von a nur in runden Zahlen(40, 30, 20, 10) angegeben
; die Resultate dieserMessungen
sind zu keiner weiternBerechnung
benützt worden.Die
Genauigkeit
derMessung
von a kann auf ca.^ 0»2
mmgeschätzt
werden; füra= 20mmist der
mögliche
Fehler somit^ l°/0;
bei a = 40 mm0,5%.
Eine
grössere Fehlerquelle liegt
auch in der verschiedenen Grösse von a in den ein¬zelnen Leitkanälen; die
Abweichungen
können bis zu 1 mmbetragen.
Für die
Wassermessung
ist im benutzten Bereich der Ueberfallshöhe ein Einstellfehler in h von ca.1,0/mm
sehr wohlmöglich,
da derWasserspiegel
am Ueberfall kein absolutruhiger
war.Beträgt
z. B.(bei Leit-App. B,
a = 20 mm, n =220/m/n) hx
=265,0 (4- 1,0)
mmh0
=.195,0 (± 0,5)
mm, so ist:Qtot.
= 203(± 1) I/sec Qneb.
= 125(± 0,5) I/sec
somit
Qrurb.
= 78(4^ 1,5) I/sec
im extremen Fall derFehlerhäufung
oder
Qrurb.
= 78(4^ 0,5) I/sec
im Fall derFehlertilgung.
Der Fehler von 1 mm in der
Ablesung
wurdeexperimentell ermittelt,
indem mehrere Mal nacheinander beimgleichen Beharrungszustand
diePegelspitze
frischeingestellt,
und ander Skala die
Ablesung gemacht
wurde. Für dieMessung
derLeerwassermengen ergab
sichdie
Genauigkeit
der Grösse h zu0,5
mm, da in diesem Fall derWasserspiegel
bedeutendruhiger
war.Der Fehler in der
Wassermenge
im oben erwähnten Fallliegt
zwischen0,64%
u°d1.9%.
Die Fehler in den
Piezometerablesungen
sind ihrer Grösse nachschwieriger
zuschätzen; stellt man denselben Anschluss kurz nacheinander zweimalher,
so unterscheiden sich die beidenAblesungen (wie
Seite 15beschrieben)
nicht um mehr als ca.0,5
cmWassersäule bei denSchaufelanschlüssen,
und um ca.1,0
cm beim Gehäuseanschluss. Bei Druckhöhen von1,0
resp.1,6
m ist der wahrscheinliche Fehler somit nur0,3
bis 1%;
die Resultate derDruckmessungen
sind also genauer als die andern Grössen.b)
DieDarstellung der Druckmessungen.
Die gemessenen Druckhöhen sind in den
Fig.
13 bis 22graphisch dargestellt;
siewurden als Funktion der
abgewickelten Schaufellänge aufgetragen.
Die tabellarische Dar¬stellung
ist dieser Arbeit nur für eine bestimmte Versuchsreihebeigegeben (Tab. 2).
Die ermittelte
Druckverteilung längs
derSchaufeln,
sowie die in den Punkten 1 bis 7 gemessenenPressungen
an der Leitradwandergaben
dieFührung
für dieAufzeichnung
der Kurvengleichen
Druckes(Fig.
23 bis28).
18
Fig.
13. DruckverheilunganSchaufel fl Zeiehng KarurMasstébe-Abszissen 1cm *1cm a,4nm/m Ordinal-en 1cm~iocm
•n-f'OT/rrnn
*Leerlauf
—•Stromunjisrichl'ung d, c,
£)—flbgewick'lf"e5chaufel»«'f*
tt—-AbgewickelteSchaufelseih I F.-za B
Fg 15
Dru:kverreilunrjt nSchaufelft a•21 m/m cm ^^^V^.*.^_ _..___.
"~"^~~~i^r-
—---..
'---
"~""-
.
*~
\\
X
\ \
1
- --.n.o --.n.i90TWi
•n.!2f. >
-—•LecrUuf 1
*
_
_—SeifeId, c ?< BI
cm
'
A
\\
\\
\\
\
\
n-î?«
s**"
P
7
!
\
—»«>«i
\
\ y
Fia 14
Druckverteilunaar Schaufelfl {JOJ
*"" *
»n»0 an.220T/mm
s
.S»if« I .Leerlauf
P. c Bt B,
\v
\ ^x^
-SaiteI
Ü £S 0, D. «u« B,, <>
Fig 16 DruckverreiluncanSchaufel ft. a-]2rr'/rn
r.-.T.-^=t_
—.
*"- -N„
\
-
\\
\V*
. n-H 2T/min
\\
« n-i80 - -
. n.19S . - ..-. ., n>J«0 - -
P 1
1 \. —Setel
w """-—
\'^
W
\ \\
\\^
\\
\'^ ,
p
7
1
"—«—..^Scirat
°4 *!... B<« 0« A...> \*