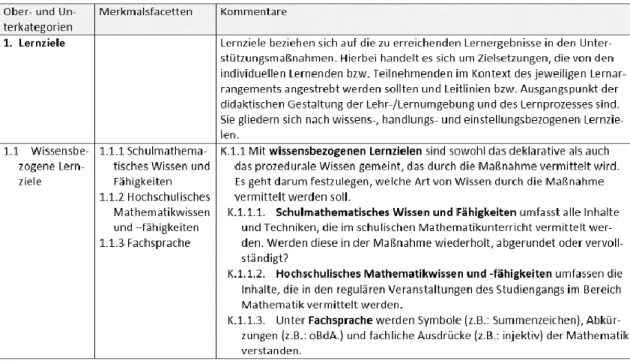ÄHNLICHE DOKUMENTE
Dans la plupart des cas, les élèves estiment, tout comme les enseignant-e-s et les parents, qu’ils et elles ont fait plus de progrès pendant les cours à distance que pendant les
L teilt die Schülerinnen und Schüler in zwei Gruppen ein und spielt nun einzelne bekannte Werbemusik so lange ab, bis eine der Gruppen signali- siert, dass sie die richtige
Die Qualität dieser Gelegenheitsdichtung braucht nicht weiter beurteilt werden, auch soll hier keine zeilengenaue Exegese geleistet werden, das kann an anderer Stelle
Der Austausch über die Lerntätigkeiten der Kinder und Jugendlichen zwischen Eltern und Lehrpersonen stellte einen grundlegenden Aspekt dar, insbesondere dann, wenn die Eltern
Nachfolgend wird auf die Rolle mathematisch- statistischer Kompetenzen im Psychologiestudium und deren Bedeutsamkeit für ein erfolgreiches Studium eingegangen (Kapitel
Diese wird zwischen der Aufnahme in der Notfallaufnahme und der Verlegung auf eine Station geschalten, da die Suche nach einem geeigneten Zimmer sehr viel Zeit und Kosten in
1 Mit der Flexibilisierung des Einstiegs in das Bildungsprogramm der Stiftung nimmt die Stiftung ihre Zielgruppen in eine größere Eigenverantwortung. Gemäß dem
Das dritte Drittel setzt sich zu- sammen aus Leuten, die im digitalen Kapitalismus nicht gebraucht werden, also arbeitslos sind,und aus Leuten,die die Beschleunigung nicht